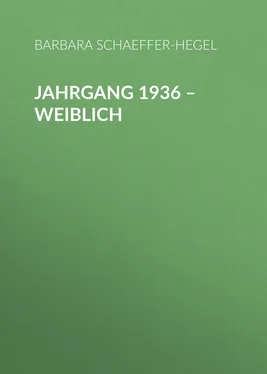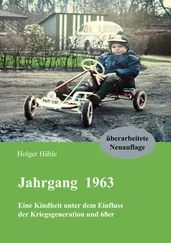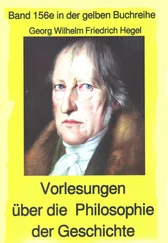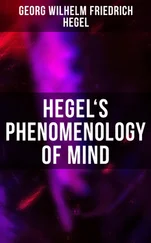Und dann gab es natürlich Rosel. Rosel, ein Flüchtlingsmädchen aus Schlesien, war erst siebzehn Jahre alt, als sie zu uns kam. Sie blieb bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahr in unserer Familie. Damals, als Rosel noch neu bei uns war, hatte sie einen Freund, den sie, wie sie mir einmal gestand, sehr liebte. Aber sie wollte so jung noch nicht heiraten. Sie musste sich doch erst eine Aussteuer zusammensparen. Der Freund wollte aber nicht warten, verließ Künzelsau und heiratete eine andere. Trotz einer ganzen Anzahl von Verehrern, die heftig um Rosel warben, konnte sie sich für keinen anderen Mann entscheiden. Und dann, nach über zehn Jahren, hielt eines Abends ein Motorrad vor der Alten Amrichshäuser Straße Nr. 17. Rosels Jugendliebe! Seine Ehe war gescheitert, ob Rosel ihm verzeihen könne. Sie konnte und zog mit ihm nach Norden. Für mich war Rosel eine warme Freundin und Trösterin gewesen. Sie blieb mir und meiner Familie bis zu ihrem Tod im Jahre 2004 eng verbunden. Für die Mutter war Rosel eine unersetzliche Hilfe. Sie brachte der „Frau Doktor“, wie Rosel meine Mutter nannte, grenzenlosen Respekt entgegen. Obwohl meine Mutter doch gar keinen Doktortitel besaß. Den Titel hatte sie, wie das zu ihrer Zeit üblich war, mit meinem Vater geheiratet.
Mit Hilfe von Rosels landwirtschaftlichen Kenntnissen wurde unser Speisezettel bald kostengünstig angereichert. Frau Kurtz hatte uns im vorderen Garten fast die Hälfte der Nutzbeete überlassen. Auf denen nun Tomaten und Salat, Kohlrabi, Bohnen und Erdbeeren angepflanzt wurden. Und auf dem schmalen, links neben dem Haus gelegenen Rasenstreifen durften wir Hühner halten. Aus alten Brettern und Holzresten zimmerte mein Bruder mithilfe von Herrn Wüster, der im Souterrain wohnte, einen Hühnerstall und umgab ein etwa fünf mal sechs m² großes Rasenstück mit einem Zaun aus Maschendraht, damites den Hühnern – zwei weißen Leghornhennen, drei schwarzen Blesshühnern und einem bunten Gockelhahn – als Auslauf dienen konnte. Im unteren Teil des Obstgartens, der hinter dem Haus bis zur Neuen Amrichshäuser Straße anstieg, konnten meine Brüder und ich Hasen halten. Jedes der Kinder hatte einen eigenen Stall mit ein oder zwei Stallhasen – Deutsche Silber, Blaue Wiener oder Angorakaninchen –, für die wir jeweils allein zuständig waren. Wir mussten die Kaninchen füttern, den Stall ausmisten und, wenn es Junge gab, für besondere Streu und besondere Nahrung sorgen. Wenn es ans Schlachten ging, was unausweichlich anstand, gab es vor allem bei mir tränenreichen Protest.
Aber meine Mutter hatte noch weitere, sehr nützliche Ressourcen für uns erschlossen. An jedem Samstag gingen sie, mein älterer Bruder Peter und später auch ich selbst in eines der umliegenden Dörfer, um dort bei den Bauern Butter und Milch und Mehl zu kaufen. Trotz der nicht ganz unbedeutenden Ernte an Gemüsen und Obst, die wir aus unserem Garten bezogen, reichte das, was man in der Stadt im Laden kaufen konnte, nicht aus, um uns alle – Mutter, Rosel, die beiden Brüder, und mich – satt zu kriegen. Und Mutter kannte die meisten Bauern aus den Dörfern der Umgebung. Sie waren alle bei ihr im Kurs gewesen. Als es nach dem Ende des Krieges in der Schule keinen Unterricht mehr gab und Mutter keine Stelle und daher auch kein Einkommen mehr hatte, bot sie Englischkurse für Erwachsene an. Allabendlich um sechs Uhr in den Räumen des Kindergartens. Alle Leute, auch die Bauern, wollten damals Englisch lernen. Vor allem die Bauern. Da jetzt die Amerikaner die Herren im Land waren, wollten sie deren Sprache wenigstens so weit beherrschen, dass sie mit ihnen reden und verhandeln konnten. Mutters Kurse waren immer überfüllt und die Bauern bezahlten mit Milch und Eiern und Mehl. Manchmal auch mit einem Schinken oder mit Würsten, wenn geschlachtet worden war. Im zweiten Jahr nach dem Krieg, ließ dann allerdings der Andrang nach. Die Bauern hatten die Angst vor den fremden Eroberern verloren; es schien nicht mehr so wichtig, deren Sprache zu können. Aber unsere Mutter behielten sie in dankbarer Erinnerung. Wir durften jederzeit kommen und uns mit den in der Stadt noch immer raren Lebensmitteln versorgen.
Familie Wüster wohnte im Souterrain. Das Souterrain hatte einen eigenen Zugang auf der rechten Seite des Hauses und bestand aus mehreren Kellerräumen, einer großen Waschküche und einem geräumigen Wohnzimmer mit Erkerfenstern zum vorderen Garten hin. Dort war das Ehepaar Wüster mit dem achtjährigen Pflegesohn Horst einquartiert worden. Auch die Wüsters waren Flüchtlinge und hatten, wie ich später erfuhr, im Krieg zwei Söhne verloren. Der kleine Horst war ihnen zugelaufen. Sie hatten ihn im Flüchtlingstreck ohne Eltern oder sonstige Begleitperson aufgefunden und sich seiner angenommen, obwohl das Kind offensichtlich schwer gestört war. „Horstle“, wie der Bub von allen genannt wurde, war extrem scheu, stotterte, wenn er mit jemandem reden musste, und war hoch aggressiv. Er duckte sich hinter die Gartenhecke und bewarf vorüberkommende Kinder, aber auch Erwachsene, mit Dreck. Er beschimpfte meine Brüder und andere Jungen aus einem sicheren Versteck heraus mit den schlimmsten Schimpfwörtern, und wenn er eine Katze erwischte, ging es dieser schlecht. Wenn Peter oder Jochen Horstle zu fassen kriegten – was ihnen allerdings nur selten gelang –, hatte der nichts zu lachen. Es setzte Ohrfeigen und manchmal schlimme Prügel. Was Horstle dazu veranlasste, sie noch kräftiger zu beschimpfen und sie – wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot – mit allem erdenklichen Abfall zu bewerfen. Wodurch sich meine Brüder wiederum zu noch strengeren Strafaktionen genötigt sahen.
Nur mir gegenüber war Horstle zahm. Ich war die einzige, die ihn nicht verhöhnte, ihn nicht wegen seiner groben Sprache beschimpfte, und die ihn nicht schlug. Ich hatte Mitleid mit Horstle. Dieser kleine Junge war immer allein. Er hatte keine Geschwister, seine Pflegeeltern waren schon fast im Großelternalter und in der Schule erging es ihm genauso wie bei uns auf der Straße. Kein Kind wollte etwas mit ihm zu tun haben. Ich nahm mir Zeit, um mit Horstle zu sprechen. Ich fragte ihn nach seinen Eltern, nach der Schule, versuchte ihm zu erklären, warum er den Tieren nicht weh tun dürfe und erzählte ihm Geschichten, die er nicht kannte. Horstle schien mich zu mögen; jedenfalls suchte er meine Nähe. Und ich verteidigte ihn gegen die Brüder.
Obwohl Frau Kurtzens Haus dreigeschossig war und seinen damals zwölf Bewohnern gut Platz bot, besaß das Haus nur eine Toilette. Ein Plumpsklo auf der mittleren Treppe zwischen dem ersten und dem zweiten Stock. Das Klo bot Anlass zu mancherlei Reibereien und Auseinandersetzungen zwischen den Hausbewohnern und vor allem zwischen der Hausbesitzerin und unserer Mutter. Abgesehen davon, dass man häufig – auch wenn es dringlich war – lange anstehen musste, wurden die Reinlichkeitsstandards, die Frau Kurtz verordnet hatte, nicht immer eingehalten. Vor allem von den drei Kindern aus dem Oberstock. Was meiner Mutter regelmäßig schwere Vorwürfe einbrachte. Unsere Mutter hatte sich daher angewöhnt, wenn sie von der Schule nachhause kam, als erstes das Plumpsklo zu inspizieren.
Und dann passierte es.
Von einer alten Dame, einer Nachbarin, der sie als junges Mädchen mit kleinen Dienstleistungen behilflich gewesen war, hatte meine Mutter eine wunderschöne Kamee geerbt. Eine aus einer Muschel geschnitzte Mondgöttin, die in Gold gefasst und als Brosche gearbeitet war. Meine Mutter trug sie fast täglich. Als Verschluss ihrer Bluse direkt am Hals. Ohne die Kamee war die Mutter nicht zu denken. Sie gehörte zu ihr wie die Joppe zum Jäger.
Als meine Mutter an diesem speziellen Tag nachhause kam und das Klo inspizierte, trug sie nicht nur, wie üblich, die Brosche an der Bluse, sie fand auch hinreichenden Grund, sich mit der Bürste in der einen Hand und dem Wasserkrug in der anderen über das offene Klobecken zu beugen. Mit dem Säubern kam sie allerdings nicht sehr weit. Ein Entsetzensschrei entfuhr ihrem Mund, ihre Hände flogen zum Hals. An die Stelle, an der die Kamee ihren Stammplatz hatte. Aber sie wusste ja schon, dass es zu spät war. Sie hatte die mattweiße Schönheit nach unten stürzen sehen und den dumpfen Ton gehört, als ihre Lieblingsbrosche in dem stinkenden Grab aufschlug.
Читать дальше