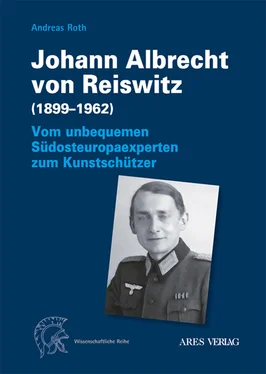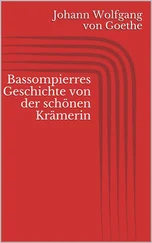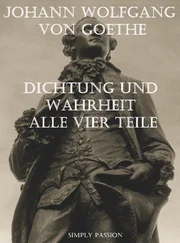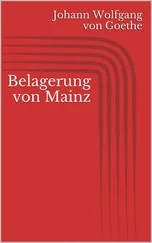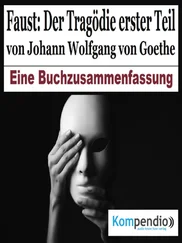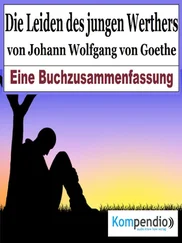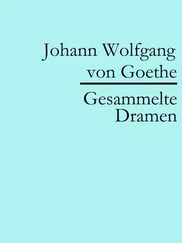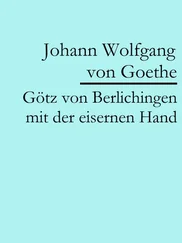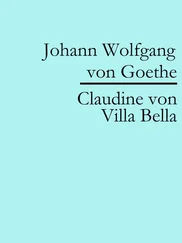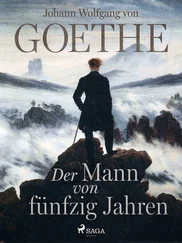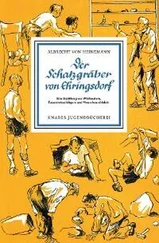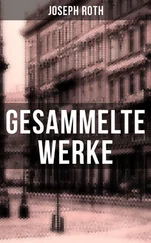Andreas Roth - Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)
Здесь есть возможность читать онлайн «Andreas Roth - Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962): краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962) — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ferner wurden diverse Archivalien aus Deutschland ausgewertet. Am reichhaltigsten sind sicherlich die Bestände des Bundesarchivs in Berlin bzw. des Bundesarchivs – Militärarchivs in Freiburg. Ersteres beinhaltet den „Ahnenerbe“-Bestand über die Grabungen in Serbien während des Zweiten Weltkrieges und die Ahnenerbe-Akten der wichtigsten daran beteiligten Wissenschaftler, aber auch die Akten der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu den Reiswitz gewährten Stipendien. In Freiburg ruht die militärische Personalakte von Reiswitz ebenso wie ein Teil seiner Lageberichte und der Kunstschutzakten. Aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes wurde Material zur Auseinandersetzung zwischen Reiswitz und Fritz Valjavec herangezogen und die überschaubaren Bestände zum Kunstschutz in Serbien durchgesehen.
Das Bayerische Hauptstaatsarchiv in München führt die Personalakte von Reiswitz, die schon Fuhrmeister heranzog. Im Archiv der Humboldt-Universität liegen die Bestände von Reiswitz’ Promotions- und Habilitationsverfahren, seine Personalakte und seine Dozentenschaftsakte. In der Bibliothek der Humboldt-Universität fand sich auch Reiswitz’ ungedruckte Dissertationsschrift. Das Archiv des Museums für Vor- und Frühgeschichte bewahrt Akten über Reiswitz’ Ohridausgrabung auf, ebenso das Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts, dass auch Akten über die schon vor Kriegsbeginn mit Jugoslawien 1941 geplanten Ausgrabungen am Kalemegdan, ebenso wie auf die Biographica-Mappe des Kunstschutz-Mitarbeiters Friedrich Holste enthält. Um die Ohridgrabung geht es auch in der Korrespondenz von Wilhelm Unverzagt, die im Archiv der Römisch-Germanischen Kommission in Frankurt am Main aufbewahrt wird. Im Berliner Geheimen Staatsarchiv ist das Reiswitz vom preußischen Kultusminister über Jahre hinweg gewährte Stipendium dokumentiert.
Hinzu kommen Archivalien aus dem Archiv des Peabody Museum for Archaeology and Ethnology in Cambridge, USA, über die Reise des Reiswitz-Konkurrenten Fewkes in Mazedonien und ein Hinweis zu Fewkes aus dem Archiv der University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. Schließlich wurden die Direktionsakten des Österreichischen Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien konsultiert, welche Auskunft über die Arbeit des Archivschutzes in Belgrad geben.
Über den Privatnachlass Reiswitz und die archivalischen Quellen hinaus wurde für die vorliegenden Studie eine Vielzahl von zeitgenössischen, vornehmlich jugoslawischen Zeitungsartikeln ausgewertet, die in der Bibliographie nicht im Einzelnen nachgewiesen, aber in den Fußnoten dokumentiert sind. Zitate in serbokroatischer Sprache wurden vom Verfasser in der Regel ins Deutsche übertragen.
Methodik
Die vorliegende Untersuchung geht im Wesentlichen biographisch vor. Dieses Genre wird – so zumindest urteilt Ernst Peter Fischer – in Deutschland vernachlässigt: „Wissenschaftshistoriker lassen hierzulande lieber ihre Finger von Würdigungen in Gestalt von Lebensbeschreibungen.“ 80Sie versteht sich aber nicht als klassische Biographie eines „großen“ Wissenschaftlers. Reiswitz veröffentlichte zeit seines Lebens lediglich eine Monographie und eine sehr überschaubare Zahl kleinerer Schriften. Als Hochschulprofessor wirkte er in München nur vierzehn Jahre. Auch wird das Leben von Reiswitz weder in allen Einzelheiten noch stringent chronologisch rekonstruiert. So kommt es kapitelbezogen zu thematisch bedingten, zeitlichen Überlappungen.
Doch das biographische Genre bietet durchaus die Gelegenheit, „eklektizistisch“ zu arbeiten: Eine Biographie „vereint ein Sammelsurium von Ansätzen, Methoden, Erkenntnisinteressen, ohne ein einziges ausschließlich und durchgängig zu verfolgen.“ 81Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit ist daraufhin ausgerichtet, anhand der Person Reiswitz die Eigenart des deutschen Kunstschutzes in Serbien im Zweiten Weltkrieg zu verdeutlichen. Dabei versucht, ähnlich wie Abel, auch diese Arbeit „ein Leben, bzw. repräsentative Abschnitte hieraus, innerhalb der Geschichte zu präsentieren“. 82Viele Aspekte der Vita von Reiswitz werden in diesem Zusammenhang ausgeklammert, wie beispielsweise sein Familienleben, beziehungsweise nur gestreift, wie seine Jugend- und Militärzeit oder die Jahre nach 1945. Es wird der Versuch unternommen, Reiswitz’ „äußeren Lebenslauf“, die auf ihn „einwirkenden historischen und gesellschaftlichen Bedingungen, Prozesse und Ereignisse“ in Verbindung zu seinem „inneren Lebenslauf“ 83zu setzen. Reiswitz’ Übernahme des Kunstschutzes der Wehrmacht in Serbien im Jahre 1941 stellt in diesem Zusammenhang sicherlich den Zeitpunkt dar, den Pyta unter Hinweis auf Hähner als „Krise“ beschreibt, eine „Zuspitzung“, in der sich „Individuen neuartige Handlungsoperationen“ eröffnen, in denen „das personale Element in geradezu exemplarischer Weise zum Tragen“ 84kommt. Für Reiswitz ergab sich bezogen auf den Kunstschutz ein „biographischer Möglichkeitsraum von bislang ungeahnter Weite“. 85
Bei aller Fokussierung auf die Genese des Kunstschutzes ist die vorliegende Arbeit aber auch keine bloße Fallstudie über diesen, da sie versucht, sich seiner spezifischen Vorgeschichte und Praxis, soweit wie methodisch möglich, aus dem Blickwinkel des Protagonisten zu nähern, ohne dabei allerdings die unabdingbare „gewisse Distanz zur biographierten Person“ 86zu verlieren.
Ein Ansatz, der für die vorliegende Arbeit in Erwägung gezogen wurde, ist die Netzwerktheorie. 87Allerdings reicht die Quellenlage für eine Analyse nach Düring quantitativ nicht aus.
Aufbau der Arbeit
Der Kunstschutz nimmt entsprechend der Schwerpunktsetzung den relativ breitesten Raum der Darstellung ein. Vier von insgesamt 63 Jahren des Lebens von Reiswitz beanspruchen darstellerisch rund zwei Fünftel des Textes. Doch Reiswitz legte schon im Anschluss an seine erste Jugoslawienreise 1924 konzeptionell den Grundstein für seine spätere Arbeit als Kunstschutzbeauftragter und arbeitete in gewisser Weise seither gezielt auf diese Beschäftigung hin.
Von daher wird die Zeit bis 1924 nur knapp referiert, unter besonderer Berücksichtigung von Reiswitz’ Sozialisation als Soldat und junger Intellektueller ohne parteipolitische Bindungen ( Kapitel 1.1.). Die folgenden Kapitel ( 1.2.– 2.1.) befassen sich mit der Ausformung seiner besonderen Zuneigung zu Südslawien, einer Leidenschaft, die, von einer persönlichen Liebesbeziehung ausgehend, zu einem wissenschaftlichen Programm wurde. Dieses Programm, das Reiswitz als seine drei „Einbruchstellen“ bezeichnete, wird in Kapitel 2.2. ausgefächert. Die beiden Folgekapitel ( 2.3.– 3.1.) beinhalten eine vertiefte Untersuchung von Reiswitz’ Jugoslawienreisen in den Jahren 1928 und 1929, die seiner Suche nach wissenschaftlichen und politischen Ansprechpartnern dienten. Zudem widmete er sich ersten praktischen Umsetzungsversuchen seines an den drei „Einbruchstellen“ orientierten Programms einer deutsch-jugoslawischen Annäherung vermittels bilateralen Kulturaustausches. In Kapitel 3.2. wird am Beispiel der von Reiswitz unterstützten serbischen Gesellschaft zum Schutz der Altertümer ein exemplarischer Einblick gegeben in die potentielle Tragweite einer Implementierung seines Programms. Kapitel 3.3. und 3.4. dokumentieren im Kontext der multilateralen Kulturbeziehungen die von Reiswitz initiierten deutsch-jugoslawischen archäologischen Ausgrabungen am Ohridsee, die einerseits Ausfluss seiner persönlichen Forschungsinteressen waren, andererseits aber auch einen Schritt hin zum von Reiswitz erstrebten rapprochement der ehemaligen Kriegsgegner darstellten.
Die Kapitel 4.1– 4.3. richten das Augenmerk auf Reiswitz’ akademischen Werdegang im nationalsozialistischen Deutschland und die damit verbundenen wissenschaftlichen, politischen und finanziellen Kalamitäten. Kapitel 4.4. widmet sich einem exemplarischen Exkurs, um am Beispiel seiner Beziehung zu dem Historiker Wilhelm Treue deutlich zu machen, mit welchen Strategien Reiswitz seiner politischen und akademischen Isolierung begegnete, aus der er durch seine Habilitationsschrift, deren Rezeption in Kapitel 4.5. thematisiert wird, auszubrechen versuchte. Nachdem Reiswitz durch die Publikation seiner Habilitationsschrift auf sich aufmerksam gemacht hatte, versuchte er dieses akademische Kapital in politisches umzumünzen, stets mit Blick auf die deutsch-jugoslawische Annäherung. Diesem Unterfangen ist Kapitel 5. gewidmet.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962)» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.