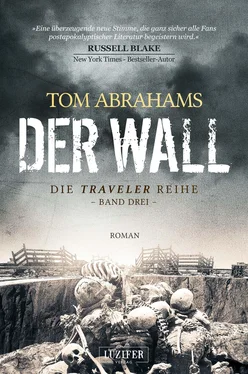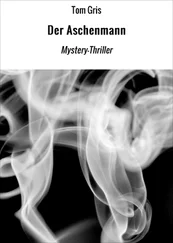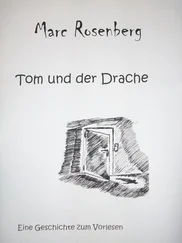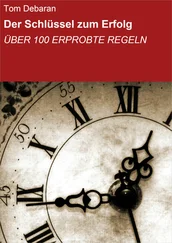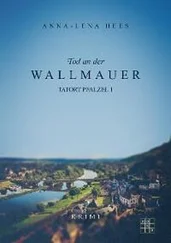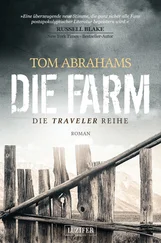Er erinnerte sich wieder an das hypnotische Geräusch des Regens auf dem Zeltstoff, an das atmosphärisch rote Leuchten, das den Raum erfüllt hatte und auch an Paagals ruhige Bestimmtheit. Sie hatte ihm schon zu diesem Zeitpunkt zu verstehen gegeben, dass der Krieg zu ihren Bedingungen beginnen würde.
»Die ganze Zeit seit dem Waffenstillstand«, hatte sie gesagt, »haben wir Undercover-Zellen aufgebaut. Sie haben unter dem Kartell in den von Ihnen genannten Städten gelebt und gearbeitet. Jede dieser Zellen hat wiederum sehr sorgfältig Verbündete rekrutiert, und alle sind bereit, loszulegen, sobald wir ihnen ein Zeichen geben. Wir können das Kartell besiegen. Sie sind genau zur richtigen Zeit hierhergekommen.«
Sie hatte ihnen das Zeichen gegeben. Die Viruszellen, die sie in das Kartell implantiert hatte, waren zum Leben erwacht. Sie breiteten sich aus. Sie taten, was das Kartell am wenigsten erwartete, und griffen sie ohne Vorwarnung auf ihrem eigenen Territorium an.
Paagal war schlau. Battle hörte auf, sich vor und zurück zu wiegen, lockerte den Griff um seine Beine und fiel zurück auf die Matratze, die nach Schimmel und Schweiß roch und nur mäßig angenehmer war als der schmutzige Felsboden. Aber sie würde ihren Zweck erfüllen, und er hatte schon an schlimmeren Orten geschlafen.
Er drehte sich auf die Seite und schloss die Augen. Battle versuchte sich das Chaos in den großen Städten des Kartells auszumalen. Er lächelte bei der Vorstellung und dachte weiter darüber nach.
Irgendwann fiel er in einen leichten Schlaf und wog ab, wie wahrscheinlich es war, dass sie tatsächlich gewannen. Sie hatten eine gute Chance auf den Sieg, zumindest aber darauf, das Kartell so weit zu schwächen, dass sie es auf die andere Seite des Walls schaffen konnten.
***
Felipe Baadal saß Paagal nun in ihrem Zelt gegenüber. Sie biss die Zähne aufeinander und klopfte mit den Fingerknöcheln ungeduldig auf den Schreibtisch. In der halben Stunde, seit Battle sie beinahe zum Explodieren gebracht hatte, hatte sie kein Wort zu ihm gesagt. Aber Baadal war insgeheim genauso begierig darauf, ihre Pläne zu erfahren wie Battle.
»Was liegt überhaupt jenseits des Walls?«, fragte er. Er versuchte sich über einen Umweg dem eigentlichen Punkt zu nähern. Das Klopfen von Paagals Knöcheln auf dem Tisch verstummte. »Warum willst du das wissen?«
»Ich bin halt neugierig«, gab er zu. »Ich habe niemals darüber nachgedacht, doch jetzt will Battle auf einmal auf die andere Seite. Ich frage mich, was er dort vorfinden wird.«
Paagal stützte sich auf ihre Ellenbogen auf und seufzte. »Was er dort vorfinden wird, kann ich dir nicht sagen«, erklärte sie. »Es kommt nämlich darauf an, wo genau er den Wall überquert, und es hängt auch von der Tageszeit ab. So viele verschiedene Faktoren spielen dabei eine Rolle.«
»Du warst schon drüben?«, fragte Baadal. Wie es aussah, hatte er das Gespräch ins Laufen gebracht. »Du warst also auf der anderen Seite?«
»Zweimal«, sagte sie. »Und das war mehr als genug.«
Baadal runzelte die Stirn. »Was willst du damit sagen?«
»Du hast den Wall also noch nie überquert?«, fragte Paagal zurück. »Ich hätte gedacht, dass du als Scout auch nördlich davon unterwegs gewesen bist.«
Baadal senkte den Blick und schüttelte den Kopf.
»Battle wird nicht das dort finden, was er sich vorstellt«, erwiderte sie, und ihr Blick ging über Baadals Schulter hinweg in die Ferne. »Es ist …«
»Es ist wie ?«
Paagal wirkte plötzlich abwesend. Vielleicht war sie in Gedanken gerade jenseits des Walls und betrachtete dort Dinge, die sie so schnell nicht wiedersehen würde. Vielleicht dachte sie aber auch an den bevorstehenden Krieg. Baadal fuchtelte mit der Hand vor ihrem Gesicht herum. Sie blinzelte träge und zwang sich in die Gegenwart zurück; in die Enge ihres Kommandozeltes.
»Entschuldige bitte«, sagte sie. »Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen.« In ihrer Stimme lag ein leichtes Zittern und ihre Augen waren plötzlich starr und glänzten feucht.
»Ich bin derjenige, der sich entschuldigen sollte«, meinte Baadal. »Ich wusste nicht, dass dich die Frage so berührt.«
»Das konntest du auch nicht wissen«, sagte sie und wischte sich mit den Fingern die Augenwinkel. »Niemand kann es verstehen, es sei denn, er war selbst dort.«
Baadal zuckte mit den Schultern. »Warum will überhaupt jemand auf die andere Seite?«
»Die Menschen wollen immer das, was sie glauben, zu brauchen«, sagte sie. »Und nur selten sind sie mit dem zufrieden, was sie haben. Es liegt einfach in der menschlichen Natur. Es ist die Idee, dass da draußen etwas ist, das sie glücklich, ihr Leben besser machen und die Lücken in ihrem Wesen füllen kann.«
Baadal lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Nennt man das nicht Hoffnung?«
»Wie meinst du das?«
»Ich meine …« Baadal suchte nach den richtigen Worten. »Ich habe kein sehr anständiges Leben geführt. Ich habe gesündigt. Ich war Täter, aber ich war auch Opfer. Doch im Hinterkopf hatte ich immer diese Vorstellung, dass ich ein besserer Mensch sein könnte. Ich dachte, ich könnte mich verändern. Ich wollte glauben, dass mein Leben …« Er suchte nach den richtigen Worten.
»Glücklicher sein könnte?«, schlug Paagal vor.
Baadal nickte. »Ja«, antwortete er. »Das ist das richtige Wort. Glück. Ein glücklicheres Leben. Es ist nicht so, dass ich undankbar bin, ich habe immerhin die Seuche überlebt, in den meisten Nächten ein Dach über dem Kopf und an den meisten Tagen genug zu essen, trotzdem hoffe ich immer noch auf … mehr.«
Paagal saß schweigend da. Sie rückte ihre Ellenbogen auf dem Tisch ein Stückchen zur Seite, erwiderte aber nichts.
»Vielleicht ist das ja alles, was Battle will«, fuhr er fort. »Vielleicht hofft er einfach nur auf ein besseres Leben.«
»Auf der anderen Seite des Walls wird er das aber nicht finden«, sagte sie nachdrücklich.
Baadal beugte sich vor und legte seine Hände flach auf den Tisch. »Warum sagst du ihm das dann nicht?«
»Weil er es selbst herausfinden muss«, erklärte sie.
»Das ist aber nicht sehr …«
»Nett?«
Baadal zuckte mit den Schultern.
»Wie ich dir schon gesagt habe, Felipe«, antwortete sie. »Ich bin kein guter Mensch. Eine Anführerin muss nicht gut sein, sie muss stark sein. Sie muss das tun, was für ihr Überleben notwendig ist.«
Baadal nickte. Er verstand, wie stark die Versuchung war, Selbsterhaltung vor Moral zu setzen. Er entschied sich dagegen, nach den Details der bereits laufenden Planungen zu fragen. Er würde es zusammen mit den anderen erfahren. Vielleicht war es sogar besser, nicht zu viel zu wissen.
25. Oktober 2037, 17:35 Uhr
Jahr fünf nach dem Ausbruch
Houston, Texas
Dass einem jemand zur Last fällt, war ein umgangssprachlicher Ausdruck, der für Ana Montes erst dann seine komplette Bedeutung erlangte, als sie dabei war, eine solche buchstäblich zu tragen. General Harvey Logan war alles andere als ein kleiner Mann, und seine Leiche zu entsorgen, war alles andere als eine leichte Aufgabe.
»Nur noch ein paar Fuß«, sagte Sidney Reilly und stöhnte, während er rückwärts ging und Mühe hatte, Logan an den Armen hinter sich herzuziehen. »Nur. Noch. Ein. Stück.«
»Du wiederholst dich«, stöhnte Ana. Logans Fersen rutschten ihr immer wieder aus der Hand, als sie den schmalen Flur entlanggingen, der das Wohnzimmer von den Schlafzimmern trennte.
Immer wieder stießen sie mit ihrer schweren Last gegen die Wände. Irgendwann erreichten sie jedoch ihr Ziel und kämpften sich durch die Tür ins größere der Schlafzimmer.
Als Ana die Schwelle überquert hatte, ließ sie Logans Füße fallen. »Warte.« Sie hob die Hand und beugte sich nach unten. »Ich muss nur kurz Luft holen. Er ist so verdammt schwer. Warum konnten wir ihn nicht einfach im Wohnzimmer zurücklassen? Wir verschwinden doch sowieso von hier.«
Читать дальше