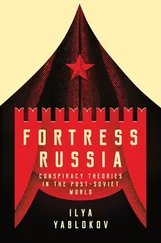Mittlerweile war ich aus der großen Zelle, die sich im Keller des Konsulatsgebäudes befand und in der ich anfangs verwahrt worden war, in eine wesentlich kleinere im Keller der Rieger-Villa verlegt worden. Diese Verlegung aus der bequemen Zelle, in welcher man zwischen den Befragungen hin- und herspazieren und nachdenken konnte, was sich im Hinblick auf die intensiven Verhöre als sinnvoll erwies, war auch deshalb bedauerlich, weil ich nun nicht mehr Harrys Zellennachbar war und damit um die Möglichkeit gebracht wurde, mit ihm Absprachen zu treffen. Anfangs war es nämlich tatsächlich so, dass wir uns problemlos durch zwei geschlossene Türen hindurch verständigen konnten, weil der Raum, in den unsere beiden Zellentüren mündeten, durch eine weitere Tür vom restlichen Keller getrennt war. Diese Tür wurde, aus welchen Gründen auch immer, dauernd geschlossen gehalten, und so konnten wir es wagen, laut miteinander zu sprechen. Das Risiko dabei war natürlich, dass man uns belauschen und unsere größten Geheimnisse erfahren hätte können. Den Umzug hatte wahrscheinlich Neda befohlen, der eines Tages wissen wollte, ob ich schon mit Harry gesprochen hätte, schließlich seien wir doch Nachbarn. Ich verneinte und behauptete, von Harrys Nachbarschaft nichts gewusst zu haben, was er mir zu glauben schien. Später habe ich von Harry erfahren, dass ihm die gleichen Fragen gestellt worden waren und dass auch er verneint hatte.
Meine neue Zelle war ein elendes Loch. Ich musste direkt von der Tür ins Bett, welches quer zur Tür stand, steigen. Der Raum war so klein, dass ich außerhalb des Bettes höchstens noch einen Fuß auf den Boden stellen konnte. Durch ein sehr kleines Fenster, welches nach oben hin schachtartig verlängert war, kam zwar Luft in mein Verlies, aber kein Licht. So brannte Tag und Nacht eine kleine Lampe in einem winzigen Fenster, das sich über der Tür zum Korridor befand, welches noch zusätzlich mit einem Drahtnetz gesichert war, um zu vermeiden, dass vielleicht ein verzweifelter Untersuchungshäftling mithilfe des elektrischen Stromes sich durch Selbsttötung den Organen der Securitate entzog. So „saß“ ich nun also buchstäblich in meiner winzigen, sehr feuchten Zelle und fror trotz der Decke auf dem Rücken.
Bedingt durch die geschilderte Kälte und wegen des wässrigen Essens, das man mir reichte, begannen sich die ersten körperlichen Beschwerden bemerkbar zu machen. Jedenfalls verspürte ich häufiger das Bedürfnis des Wasserlassens, als dies gemäß der Vorschriften für die Gefangenen vorgesehen war, nämlich zweimal täglich. Um nun häufiger austreten zu können, musste der Häftling an seine Zellentür klopfen und den Diensthabenden bitten, diese Extratour zu gestatten. Manche Unteroffiziere waren einsichtig genug und erlaubten den Austritt, wenn auch oft mit Verzögerung, andere aber machten sich einen Spaß daraus, die Bittenden auf später zu vertrösten oder mit Schimpftiraden zum Schweigen zu bringen. Oft konnte man daher Häftlinge bitten und betteln hören, und es war schlimm anzuhören, wie sie beschimpft und zum Teil geschlagen wurden. Auch ich kam immer häufiger in die Lage, um zusätzliche Austritte bitten zu müssen, und geriet dabei häufig an einen bulligen brutalen Schlägertyp im Range eines Feldwebels, welcher trachtete, mir das Leben so schwer wie nur möglich zu machen. Die ganze Quälerei hatte natürlich System, denn man zielte darauf ab, den Verhafteten mit allen Mitteln zu zermürben. Tagsüber durfte sich zum Beispiel niemand auf das Bett legen, geschweige denn schlafen. Für solche „Vergehen“ wurde man von den Wärtern beschimpft oder sogar geschlagen. Viele wurden auch bei Nacht zu Vernehmungen gebracht, natürlich ohne am nächsten Tag den verlorenen Schlaf nachholen zu dürfen.
Eines Morgens, als ich zum heiß ersehnten WC geführt wurde, entdeckte ich im Mülleimer unter dem Waschbecken eine leere Bierflasche. Sie stank nach Öl, das man vermutlich zum Feuermachen verwendet hatte. Ich nahm die Flasche zu mir, und es gelang mir, sie vom Diensthabenden unbemerkt in meine Zelle zu schaffen. Dort verbarg ich sie in meinem Strohsack und bediente mich ihrer immer, wenn der Druck gar zu groß ward. Beim Toilettengang leerte ich die Flasche dann heimlich. Trotzdem wurde mein Problem von Tag zu Tag schlimmer und mein Harndrang gefördert durch die Kälte eines Tages so unerträglich, dass ich mich auch durch den Zuruf des „Bulligen“, ich solle Geduld haben („Ai răbdare“), nicht vertrösten ließ und mit der Faust gegen die Zellentür zu trommeln begann. Die Folge war, dass er plötzlich die Tür aufriss und mit Fäusten und Fußtritten auf mich losging, während ich an ihm vorbei und zum WC drängte. Als er mich auch noch packte und mit dem Kopf an die Wand stieß, begann mein Urin unkontrolliert zu laufen, was ihn nur veranlasste, noch wilder zu toben und mich weiter zu schlagen. Dann musste ich mit einem Waschlappen den langen Korridor von meiner Zelle bis zum WC aufwischen, wozu es noch reichlich Fußtritte und ordinäre Beschimpfungen gab, die erst endeten, als ein zweiter Unteroffizier erschien, der sich nach dem Grund des Krachs erkundigte. Als ich mit dem Aufwaschen fertig war, fragte ich den neuen Unteroffizier, ob ich meine durchnässte Hose waschen dürfe, was er erlaubte und gleichzeitig fragte, ob ich denn eine Hose zum Wechseln hätte, was ich verneinte. Diese Auskunft schien ihn nachdenklich gemacht zu haben. Wieder in der Zelle wickelte ich mich in meine Decke und legte meine nasse Hose darüber, in der Hoffnung, dass sie bald trocknen würde. Aber in meiner feuchten Zelle ging das nicht so schnell, und so musste ich am kommenden Vormittag mit einer nassen Hose zum Verhör gehen. Außerdem hatte ich inzwischen festgestellt, dass aus meinem Ohr infolge der erhaltenen Schläge ziemlich viel Blut geflossen war.
Als ich im Büro von „Goldzahn“ auftauchte, bemerkte dieser meinen Zustand sofort, und ich musste ihm den Vorfall schildern. Am Nachmittag – ich war längst wieder in meiner Zelle – kam der diensthabende Unteroffizier zusammen mit einem zivil gekleideten Herrn mit Brille an meine Tür. Dieser stellte mir einige Fragen im Zusammenhang mit meinen körperlichen Beschwerden, aus denen ich erkannte, dass es sich bei ihm um einen Arzt handelte. Wie ich später erfuhr, hieß der Mann Dr. Paul Singer und war Arzt bei der Securitate. Ich erzählte ihm von den schmerzenden Nieren, dem Brennen in der Blase und dem unwiderstehlichen Harndrang, worauf er nur meinte: „In dieser Kleidung kannst du nicht gesund werden. Ich werde veranlassen, dass du Kleider bekommst. Vorläufig nimm diese Tabletten jetzt sofort ein.“ Er schüttete aus seiner Arzttasche etwa ein Dutzend Tabletten in meine Hand und forderte mich auf, diese sofort runterzuschlucken. Ich zögerte noch, denn ich konnte nicht glauben, dass ich einen solchen Haufen Tabletten auf einmal und noch dazu ohne Wasser schlucken sollte. Er ließ mich aber durch den Wachmann zur Wasserleitung bringen, und dieser achtete darauf, dass ich auch wirklich die ganze Medizin zu mir nahm. Jedenfalls half die Rosskur und mein Zustand verbesserte sich wesentlich. Am gleichen Tag wurde ich noch ziemlich spät aus der Zelle geholt und in einen Büroraum geführt, wo ein dicker Feldwebel auf mich wartete. Aus einem Sack zog er der Reihe nach Kleidungsstücke hervor, die ich als meine erkannte. Dabei waren ein Anzug, warme Hemden, Unterhosen, mehrere Paar Strümpfe, Taschen- und Handtücher sowie ein Paar hoher Schuhe. Dazu ein Stück Seife, Zahnbürste und Zahnpaste. Der Feldwebel sagte: „Wie du siehst, war ich bei deinen Eltern und habe dir diese Sachen mitgebracht.“ Ich fragte ihn, wie es meinen Eltern gehe. Er beruhigte mich und sagte, es gehe ihnen gut und mein Vater arbeite in seiner Werkstatt. Weil er sich so gutmütig zeigte, wagte ich noch einige Fragen, etwa ob er auch meine Oma und Tante gesehen habe. Er bejahte und meinte, sie wären hinzugekommen, während er bei meinen Eltern war. Diese Einzelheiten ließen ihn glaubwürdig erscheinen. Er meinte noch: „Sie lassen dich grüßen.“ Dann machte er sich daran, eine Liste aller mitgebrachten Sachen zu erstellen, und ließ mich deren Empfang bestätigen. Anschließend ging er in den Nebenraum und brachte einen Rucksack, den ich sofort als jenen Rucksack erkannte, den ich auf der Flucht in unserem Versteck am Temeschufer zurückgelassen hatte. Ich hatte bis dahin meinen Vernehmern kein Wort über die von uns dort gelassenen Sachen gesagt, weil ich die von Franzi Bayer leihweise bekomme Pistole auch dort gelassen hatte. Im Rucksack fand ich noch ein Hemd, zwei oder drei Paar Socken und sonstige Kleinigkeiten. Dann kam er noch mit einigen persönlichen Gegenständen, die man mir bei der Verhaftung abgenommen hatte, darunter auch die aus dem Liederbuch gerissenen Blätter mit den belastenden Texten und Zeichnungen, die zwar von Moiş begutachtet worden waren, deren Brisanz er aber wohl übersehen hatte. Da ich merkte, dass der Feldwebel noch mit seiner Schreibarbeit beschäftigt war, steckte ich kurz entschlossen die Papiere vorerst unter mein Hemd und wenig später in den im Raum befindlichen Kachelofen, nachdem ich aufgefordert worden war, Holz nachzulegen. Der Feldwebel merkte zwar, dass ich außer dem Holz noch etwas in den Ofen befördert hatte, gab sich aber mit meiner Erklärung, es hätte sich um ein Stück Zeitungspapier gehandelt, zufrieden. Mit den erhaltenen Kleidern konnte ich mich endlich wärmer anziehen, was auch nötig war, denn es war früh Herbst geworden und ziemlich kalt. Was den Rucksack mit Kleidungsstücken betraf, wusste ich jetzt, dass man diese Sachen an der Temesch gefunden und hergebracht hatte. Fredi musste mit Begleitung draußen an der Temesch gewesen sein, denn die Securisten allein hätten das Versteck kaum finden können. Wie das Ganze wirklich gelaufen ist, habe ich erst später, nachdem wir verurteilt waren, von Fredi erfahren.
Читать дальше