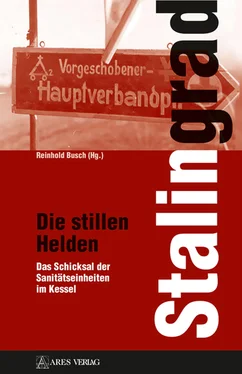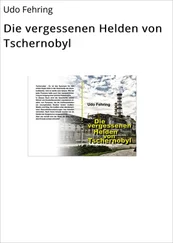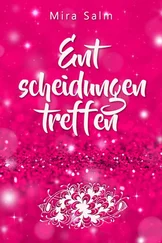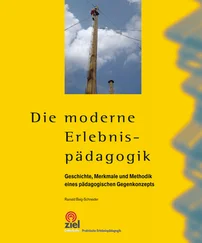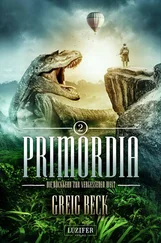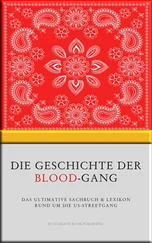1 ...7 8 9 11 12 13 ...20 ‚Wenn das nur gutgeht!‘ pflegten jene überaus mutigen Kameraden zu sagen, die einen LKW mit Minen vollbeladen über die holprigen Straßen steuerten, denn was eine Bombe oder auch nur eine Granate mitten in die gestapelten Minen bedeutete, wußte jeder dieser Kameraden hinter dem Lenkrad. So erging es einem dieser Männer: Eine von einem Flugzeug geworfene Bombe, am blauen Himmel kaum zu sehen, traf mitten in die Fülle der Minen. Helle Blitze und Explosionen waren die Folge. Zwar kam der Fahrer gerade noch aus dem Gehäuse heraus, aber wie! Der Leib war aufgerissen, und die Gedärme schleppte er mit wankenden letzten Schritten durch den Staub der Steppe; nach wenigen Metern brach er zusammen. Helfende Kameraden waren schnell zur Stelle. Aber was sollte man noch machen? Kein Arzt befand sich in der Nähe, und die Versuchung tauchte auf: Gnadenschuß? Aber nur einen Augenblick, nicht länger, denn auch im Kriege galt: ‚Ich bin der Anfang und das Ende‘, also auch das Ende unseres Lebens. Und wenn man mit einem Bewußlosen nicht mehr reden konnte, dann konnte man die Hand aufs Haupt legen und das Zeichen des Kreuzes auf die schweißnasse Stirn machen mit seiner Botschaft: ‚Es ist vollbracht,‘ nämlich Heil und Rettung auch aus der Nacht des Todes. Sterbende können hellwach verstehen, auch wenn die Lippen sich nicht mehr bewegen.
In maßloser Qual lag ein Schwerverwundeter vor mir. Ein Geschoß hatte ihm Ober- und Unterkiefer weggerissen; nur die zerfetzten Wangen und die Nase waren noch zu erkennen. Der Menschheit ganzer Jammer konnte einen packen, wenn man in diese aufgerissenen Augen sah. Stabsarzt Dr. Paal linderte die Schmerzen, soweit möglich. Immer wieder wies der Verwundete mit der rechten Hand auf meine Pistole, die wir Divisionspfarrer zum Schutze der Verwundeten tragen mußten. Ich verstand den so schwer Verletzten sehr schnell: Machen Sie doch meiner Qual bald ein Ende, bitte! Er erhielt durch den Arzt noch eine lindernde Spritze und wurde dann vorsichtig in den Wagen mit der wehenden Rotkreuzflagge hineingetragen; das Ziel: das nächste Feldlazarett. Sein Oberleutnant erzählte mir später, der Verwundete habe die qualvolle Fahrt über die holprige Rollbahn leider nicht überstanden. Hier half nur die Erinnerung an jenes Wort des Neuen Testamentes: ‚Der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein.‘ Auch das Stöhnen des so schwer verletzten Kameraden wird nicht mehr sein, denn ‚das Erste ist vergangen.‘
So wie hier beschrieben – nur wenige Ausschnitte von unzähligem Sterben – ging es weiter, Tag für Tag, auch Nacht für Nacht, wenn man z. B. in tiefster Dunkelheit jemanden rufen hörte ‚Sani, Sani!‘, und man fand ihn doch nicht. Und Tag um Tag, Nacht für Nacht wurde es noch schlimmer als bisher, denn der Krieg wurde im Laufe der Zeit erbarmungsloser. Warum sollte ich die Wirklichkeit verschweigen? Denn nur die Wahrheit kann uns freimachen! Daß es noch schlimmer wurde, merkten wir auch daran, daß das Singen ganz allmählich aufhörte. Selbst Narren sangen nicht mehr ‚kein schönrer Tod, als wer vom Feind erschlagen!‘ Wer wie wir Erschlagene mit eigenen Augen gesehen hatte, konnte vor einem solchen grauenhaften Ende nicht mehr singen, sondern nur noch verstummen …
Mein katholischer Kollege, Pfarrer Peter Mohr, besaß eine besondere seelsorgerische Begabung. Wenn er mit seiner warmherzigen Stimme zu den Verwundeten sprach, spürten sie alsbald seelische Erleichterung, und Sterbenden machte er mit seinem tröstlichen Wort den Heimgang leichter. Wenn er knieend das ewige Leben bezeugte, dann stand dahinter die Gewißheit: Nichts kann unsere lieben Kameraden von der Liebe Gottes scheiden! In gleicher Weise nahm er sich der verwundeten russischen Soldaten an. Wenn deren Blick auf das silberne Kreuz von Mohr fiel, entspannten sich ihre zerfurchten Gesichtszüge. Sie merkten: Mir naht jetzt kein Gegner, mir naht vielmehr ein Pontifex, ein Brückenbauer zwischen Zeit und Ewigkeit, zwischen Gott und Mensch, auch zwischen Mensch und Mensch.
Während schwerste Kämpfe tobten, trafen wir beide unseren Divisionsarzt. Er sagte uns: ‚Dort, wo Sie jetzt hinwollen, ist es überaus windig!‘ Wir verstanden sofort, was er meinte. Mohrs Antwort: ‚Dort aber gehören wir auch hin,‘ und meinte damit auch unsere getreuen Küster Johann Wahl und Martin Krinke. Denn wenn Männer unter Schmerzen unsäglich leiden und auch sterben mußten, konnte oft allein das geistliche Wort noch lindern und helfen. Als Mohr auf dem dortigen Verbandplatz mit den vielen Verwundeten erschien, wurde es auf dem vom Stöhnen der Verwundeten erfüllten Ort ein wenig stiller, denn von ihm gingen Segensströme aus. Wie dankbar waren ihm unsere beiden Stabsärzte Dr. Paal und Dr. Weber! Mohr war in jeder Hinsicht ein tapferer Seelsorger. Wenn er einen Soldaten getroffen stürzen sah, war er alsbald bei ihm. Unser General Hube, hervorragend begabt, war zwar kein besonderer Freund der Kirche, hatte aber vor solcher Tapferkeit höchsten Respekt. Sein warmer Händedruck bezeugte es. Wie konnten wir diesen Krieg noch verantworten? Peter Mohr sprach es einmal so aus: Immer sind es unsere tapferen Landser, die für die Sünden ihrer Politiker büßen müssen! Deshalb war Mohr ein besonderer Freund der Landser, wie sie auch ihn überaus schätzten.
Selten, daß General Hube an einem Verbandplatz vorbeifuhr. ‚Bei der Rotkreuzflagge halten,‘ lautete sein Befehl. Auch Ärzte und vor allem Verwundete brauchten ein ermutigendes Wort des Kommandeurs in kritischer Lage! Unser einarmiger General wußte aus eigenem Leid, was ein Verbandplatz und ein gutes Wort für einen Verwundeten bedeuten konnten. Daher sein kameradschaftlicher Handschlag für Dr. Weber, einen Gefreiten oder einen Verwundeten, sobald es seine Zeit als Kommandeur erlaubte. Sein Blick streifte auch über die vielen Gräber neben dem Verbandplatz. Ob er an seinen gefallenen Sohn dachte und daran, daß der Krieg bald ein Ende nehmen würde? Überaus dankbar war Dr. Weber auch für die Besuche von Divisionsarzt Dr. Gerlach.
Nicht immer konnten Pfarrer Mohr und ich bei unseren beiden Sanitätskompanien bleiben, denn wir durften ja auch die Truppe nicht vergessen. Welche Freude, wenn wir auch in den vorderen Gräben auftauchten oder in einem Erdbunker! Jedes Mal aber gab uns Dr. Paal ein Handzeichen, und das besagte: Der Verwundete dort braucht ein seelsorgerisches Wort! So arbeiteten Seelsorge und Medizin im Krieg eng zusammen, ein gutes Beispiel auch für die heutige Zeit. Pfarrer Mohr stand Dr. Weber und seinen Mannen in Stalingrad und während der ganzen Gefangenschaft von 5 ½ Jahren mit glaubender Zuversicht zur Seite.“
Ein einziger Divisionspfarrer war für zehn- bis fünfzehntausend Soldaten zu wenig; jedoch befanden sich in den Sanitätseinheiten der einzelnen Divisionen mehr als 20 katholische Priester, die ihren Dienst als Sanitäter verrichteten. Ihre Mithilfe war zwar von der NS-Führung nicht vorgesehen, doch Dank des Entgegenkommens der in dieser Hinsicht viel toleranteren Kommandeure und Ärzte standen an den großen Festtagen des Kirchenjahres die von verschiedenen Priestern gehaltenen Feldgottesdienste im offiziellen Divisionsbefehl, z. B. in der 297. Infanterie-Division. Alois Beck: „An Großkampftagen war es aufgrund einer Vereinbarung mit dem dafür aufgeschlossenen Divisionsarzt und natürlich auch seitens der am Verbandplatz tätigen Ärzte selbstverständlich, daß bei Abwesenheit des Divisionsarztes, der nicht überall gleichzeitig sein konnte, ein Sanitätspriester den Sterbenden seelsorgerischen Beistand leistete.“ 37
Schwere Mängel bei der Versorgung der 6. Armee
Es gab allerdings bereits von Anfang an mahnende Stimmen und deutliche Kritik. Oberarzt Dr. Günther Diez 38, nacheinander bei der 1. und der 2. San.Kp. 305, schrieb zur gesundheitlichen Situation der Soldaten: „Auf dem Vormarsch durch die Steppe litt die Truppe sehr unter Wassermangel. An manchen Tagen war kein Tropfen aufzutreiben. Kärgliche und verschmutzte Wasserstellen mußten für Mensch und Tier ausreichen. Banale Enteritis-Erkrankungen – vor allem Ruhr, Typhus abdominalis und Paratyphus – häuften sich. Geeignete Krankenkost fehlte außerdem. Auch die Truppenverpflegung war so ungeeignet wie nur möglich. Bei großer Hitze gab es entweder nur Pferdefleisch oder nur Erbsen, nur Fischkonserven oder nur Rübenmarmelade. Das Brot war derart glitschig und naß, daß es nur geröstet genießbar war. Gemüse oder Obst wurden nie herangeschafft. Etwa ab Ende Juli 1942 wurde nur noch die Hälfte der Verpflegungsration herantransportiert; im Hinterland sollten Reserven für eine Schlammperiode geschaffen, die fehlende Hälfte sollte aus dem Lande entnommen werden. Aber dieses Land war Steppe, aus der sich für die Armee wenig entnehmen ließ. Auch das Fischen am Don schloß die Lücke nicht.“ 39
Читать дальше