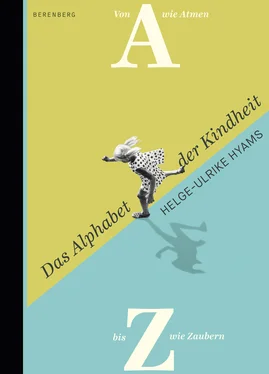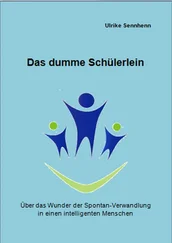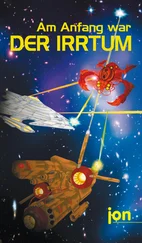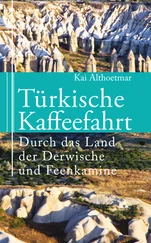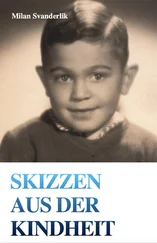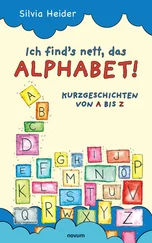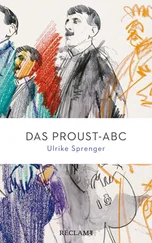Der Kinderwunsch entspringt eben nicht, wie manche behaupten, einem narzisstischen Impuls, im Kind ein Stück eigenes Ich zu schaffen. Das wäre psychologisch zu kurz gegriffen. Vielmehr ist es das Begehren, dass der Fluss des Lebens mit mir nicht abbricht, dass er weiterfließe, fleischlich-lebendig. Der Wunsch nach Kindern entspringt der Bejahung des Lebens, der Akzeptanz des Zyklus von Sterben und Werden, so wie Goethe es formulierte: »Und so lang du das nicht hast, dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.« 20Die meisten Menschen fühlen das – bewusst oder unbewusst. Sie spüren den Impuls, dass das Leben weitergehen soll durch sie. Sie wollen Kinder, und zwar Männer und Frauen gleichermaßen. 21Viele Adoptiveltern, die keine Kinder bekommen können, wählen zur Befriedigung dieses Begehrens ein fremdes Kind. Mit der Kraft ihres Willens und ihrer Liebe nehmen sie ein ihnen unbekanntes Wesen an Kindes statt an, geben ihm Namen, Nahrung, Haus und Zukunft. Das erfordert Mut und eine tragfähige Motivation und Durchhaltekraft. Ganz so wie jedes Elterndasein.
Und schließlich – drittens – ist da das Adoptivkind selbst. Die allermeisten Kinder haben das Glück, in eine liebende Familie aufgenommen zu werden, die schon lange sehnsüchtig auf sie gewartet hat. Auf jeden Fall gelangen sie in Familien, die amtlich geprüft und für gut befunden wurden, die Kinder aufzunehmen. Sie haben das Glück, eine Familie zu bekommen, Wohnung, Nahrung und Wachstumschancen. Ganz besonders trifft dies für Kinder aus dem Ausland zu – inzwischen die große Mehrheit der Adoptivkinder –, wo sie oftmals wenig gute bis gar keine Entwicklungschancen haben.
So war es bei Anna, dem jungen Mädchen aus Rumänien. Die Adoptiveltern, ein kinderloses Arztehepaar aus England, holten sie und ihre zwei Brüder aus einem jener unvorstellbar lieblosen Kinderheime des Rumäniens der Neunzigerjahre. Anna war damals fast zwei Jahre alt, sie konnte noch nicht laufen, weil sie bis dahin meist an Gurten angekettet im Kinderbett gehalten wurde. Heute ist Anna eine junge Frau, auffallend zugewandt, fröhlich und selbstbewusst. Und dennoch erzählt die Adoptivmutter, dass die Tochter bisweilen in kaum zügelbare Zornattacken verfällt, so als wolle sie alles, ihre Vergangenheit und ihre jetzige Wirklichkeit, zerstören. So als wäre das Leben in England und in dieser liebevollen Familie das falsche Leben. So als sei sie selbst falsch.
Jedes Adoptivkind drängt irgendwann einmal danach, Auskunft über seine biologischen Eltern zu bekommen. Das Kind möchte wissen, wer es zur Welt gebracht hat, wer es gezeugt hat, und vor allem will es erfahren, warum die eigene Mutter es weggegeben hat. Wenn diese Frage nicht beantwortet wird, gibt es sich die Erklärung selbst: »Sie hat mich abgelehnt. Sie wollte mich nicht. Sie hat mich nicht geliebt.«
Das sind die im Adoptivkind kreisenden Gedanken. Es spricht sie selten aus. Wie Anna sind die meisten Adoptivkinder voller Dankbarkeit. Sie wissen sehr wohl, was sie den Adoptiveltern verdanken. Dennoch nagen diese Fragen in ihnen. Sie tragen das Trauma in sich, von ihrer eigenen Mutter für immer weggeschickt, ausgesetzt worden zu sein. Wie bei so vielen anderen Lebenskränkungen, die jeder von uns in sich trägt, gibt es Wege, damit zu leben und eine Balance herzustellen. Gegenüber dem Schmerz als Schattenseite der Adoption wiegt die andere Waagschale, in welcher das Glück, der Lebenswille und die Hingabe vereint sind. Und Letzteres wiegt, wenn man das Bild der Waage ernst nimmt, spürbar schwerer. Wie sagt der Koreaner Jung, der als Fünfjähriger zwischen Mülleimern aufgegriffen und zur Adoption nach Europa verschickt wurde? »Schließlich haben sie mir doch die Hauptsache gegeben: eine Familie.« 22
»Kinder ertragen absolut keine Unterschiede. Sie lehnen sie ab, weil sie darunter leiden.«
Aldo Naouri
Seltsame, vertrackte Welt. Manche Kinder sind anders. Manche Kinder fühlen sich anders, und manche wollen anders sein als sie sind. Wie soll man sich da zurechtfinden?
Mir geht das Mädchen Muriel nicht aus dem Kopf. Ich traf sie im Sommer 1990. Muriels Vater stammt aus Ghana, ihre Mutter aus Berlin. Muriel war acht Jahre, ihre dunkle Haut samtweich. Ihr Körper vibrierte vor Bewegung, und ihr Lachen steckte alle an. Zum Sommerfest trug sie Blumen im Haar, hatte Glanz in den Augen. Doch ihre Mutter erzählte mir, dass sie abends, wenn keiner sie sah, Penaten-Creme unter ihrem Kopfkissen hervorholte und sich die weiße Paste ins Gesicht schmierte, um weiß zu sein wie die anderen.
Kinder, die sich wie Muriel durch Haut- oder Haarfarbe, durch Sprache und Verhaltensweisen spürbar vom Rest der anderen unterscheiden, sind exponiert. Ihre Umgebung begegnet ihnen mit Neugier und Faszination, die allerdings unvermittelt in ihr Gegenteil umschlagen können. Dann nämlich, wenn sie die Rolle des niedlichen und gefälligen Fremdlings verlassen, wenn sie eigenwillig oder gar zornig werden. Kinder spüren dies. Sie genießen die Zuwendung, aber insgeheim ersehnen sie ein Leben in Normalität, nicht aufzufallen und unter den anderen »zu sein wie sie«.
Zwanzig Jahre später hat sich viel geändert. Wer heute am Zaun eines Schulhofs steht, entdeckt gerade in Großstädten eine viel größere kulturelle Buntheit. Sprachen purzeln durcheinander, und niemand wundert sich über Kinder, die anders aussehen, andere Feste feiern und anderes Schulbrot essen.
Aber das Problem des Andersseins ist nicht vom Tisch. Es bedarf durchaus nicht dunkler Hautfarbe oder fremdartigen Aussehens, dass sich Kinder auch heute anders und damit infrage gestellt fühlen. Eine große Anzahl von Jungen und Mädchen nehmen sich deutlich anders als die sie umgebende Gruppe wahr, und sie durchleben damit einen tief menschlichen Konflikt: Schon das Kind sehnt sich danach, seine Individualität auszuleben, mit all seinem Begehren, seinen Macken und Fantasien. Und zugleich fürchtet es, damit anzuecken oder gar ausgestoßen zu werden. Aus dieser Angst heraus nimmt es sich oft in seiner Individualität zurück und sucht Schutz in der Konformität der Gruppe, es taucht ganz einfach unter zwischen den anderen. Die Schriftstellerin Cordelia Edvardson, Tochter einer christlichen Mutter (Elisabeth Langgässer) und eines jüdischen Vaters, beschreibt die Spannung, die sie als Kind während der Nazizeit aufgerieben hat: »Das Mädchen selber war hin und her gerissen zwischen dem Stolz darüber, ›anders‹ zu sein, einem Stolz, der immer zweifelhafter wurde, und dem hoffnungslosen Wunsch, dazuzugehören, so zu sein ›wie alle anderen‹«. 23
Nicht nur Muriel wünschte sich in eine andere Haut. Erstaunlich viele Kinder wollen ohne offensichtlichen Grund anders sein: klüger, hübscher, musikalischer, sportlicher. Sie ersehnen sich einen anderen Körper, andere Augen oder andere Haare und mitunter auch ein anderes Wesen, vielleicht auch ein anderes Geschlecht. Und beängstigend viele Kinder neigen dazu, sich über den Mangel zu definieren, über das ihnen vermeintlich Fehlende, über das, was sie eigentlich sein wollen oder glauben, sein zu sollen.
Warum definieren sich Kinder über den Mangel? Warum glauben sie, anders und besser sein zu müssen? Die Antwort darauf ist nicht leicht, sie führt uns zurück in die früheste Lebenszeit des Kindes. Die ersten Wochen und Monate des Lebens sind die prägende Phase, in der das Kind schrittweise Vertrauen in seine Welt entwickelt. Wenn das Kind von Vater und Mutter vorbehaltlos angenommen wird, wenn ihm durch Sprache und Verhalten vermittelt wird: »Ja, du bist das Kind, das wir uns gewünscht haben«, dann ist dies die nährende Basis für das spätere Selbstgefühl und Vertrauen in die Welt. Dann ist das Kind richtig und muss nicht danach trachten, anders zu sein. Das kleine Mädchen muss nicht der ersehnte männliche Stammhalter sein, um sich akzeptiert zu fühlen. Der kleine Junge muss kein Genie sein, um den Vater stolz zu machen. Das Kind muss nicht anders sein, als es ist. Der Tiefenpsychologe Erik H. Erikson bezeichnet dieses besondere Gefühl des Kindes mit der schönen Formel Urvertrauen . 24Ein starkes Wort und eine gute Vorstellung. Ein Kind, das sich seiner selbst sicher ist, wird es später nicht nötig haben, in die Haut eines anderen schlüpfen zu wollen – es sei denn als Schauspieler.
Читать дальше