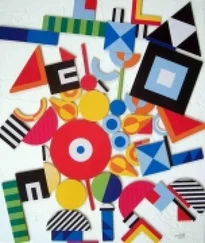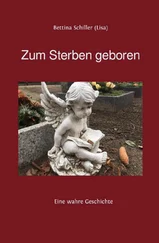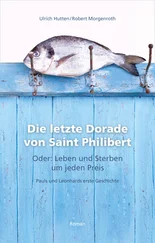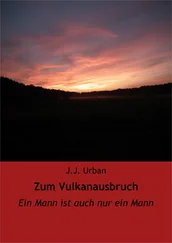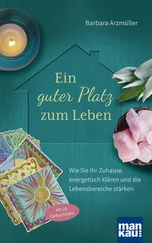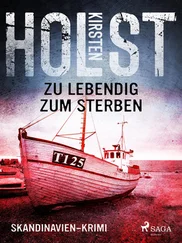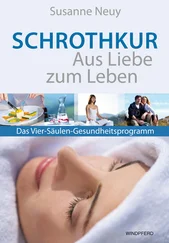Gleichzeitig mit der für viele Beobachter überraschend starken Betonung des Autonomie-Prinzips hat das Gericht auch die Gefahren einer unregulierten Suizidhilfe angesprochen und dem Gesetzgeber Hinweise zu einer verfassungsgemäßen Regelung gegeben. Es obliegt nun dem Deutschen Bundestag, ein Gesetz zu erlassen, das den verfassungsrechtlich wie ethisch hochrangigen Grundsätzen der Selbstbestimmung und der Fürsorge für das Leben auf gesellschaftlich akzeptable und nachhaltige Weise Geltung verschafft. Mit Blick auf diese Aufgabe des Parlaments haben wir unseren Gesetzesvorschlag von 2014 unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse überarbeitet und den Vorgaben des Verfassungsgerichts angepasst.
Wie schon 2014 hoffen wir, mit diesem konkreten Vorschlag einen Beitrag zu einer nüchternen und sachgerechten Diskussion dieses kontroversen Themas leisten zu können. Für Kommentare, konstruktive Kritik und Anregungen zur Verbesserung sind wir auch diesmal jederzeit dankbar.
Lausanne/Mannheim/Tübingen, im Juni 2020
Die Verfasser
1
Einleitung
1.1
Problem
1.1.1 Rahmenbedingungen für medizinische Entscheidungen am Lebensende
In Deutschland stirbt die Mehrzahl der Bürger 1im Rahmen von fortschreitenden, unheilbaren Erkrankungen, bei denen das Lebensende Wochen oder gar Monate im Vorhinein absehbar und gestaltbar ist. Das gilt selbst für die gegenwärtige Situation, in welcher die Pandemie Covid-19 auf dramatische Art und Weise in Erinnerung ruft, dass der Tod auch schnell und unvorhergesehen eintreten kann. Gleichwohl geht die langfristige Tendenz in unserer Gesellschaft dahin, dass die weit überwiegende Mehrheit der Menschen an chronischen Erkrankungen verstirbt, die allermeisten davon hochbetagt.
Jeder Bürger, der die Fähigkeit zur rechtsgültigen Einwilligung in medizinische Maßnahmen besitzt, kann lebenserhaltende Behandlungen (z. B. Reanimation, Beatmung, Chemotherapie, Dialyse) ablehnen, um das Sterben zuzulassen. Die Umsetzung des Willens kann, ethisch und rechtlich gleichwertig, durch Unterlassen einer potenziell lebenserhaltenden Behandlung oder durch Beendigung einer bereits begonnenen lebenserhaltenden Behandlung erfolgen. 2Gleichermaßen muss eine Behandlung unterbleiben oder beendet werden, wenn dies aus einer Patientenverfügung, einer im Voraus mündlich geäußerten Behandlungsablehnung oder dem mutmaßlichen Willen des Patienten eindeutig ersichtlich wird. 3Der Gesetzgeber hat mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts von 2009 hierfür klare Regelungen erlassen. Zudem hat der Bundesgerichtshof (BGH) die strafrechtlichen Bedingungen für einen erlaubten Behandlungsabbruch festgestellt. 4
Die palliativmedizinische und hospizliche Betreuung und Begleitung am Lebensende haben sich in Deutschland in den letzten zwanzig Jahren deutlich verbessert. Auch wenn Deutschland dadurch im internationalen Vergleich gut dasteht, 5ist die Versorgung in manchen Bereichen des Gesundheitswesens und bei manchen Krankheitsbildern noch unzureichend, insbesondere bei nicht-onkologischen Erkrankungen und speziell bei Demenzerkrankungen. Die schmerz- und symptomlindernde Therapie ist noch nicht überall auf höchstem Standard. Dies liegt unter anderem daran, dass bei manchen Ärzten immer noch die Befürchtung besteht, durch Verabreichung von hochwirksamen Schmerzmitteln gegen betäubungsmittelrechtliche Vorschriften oder gar gegen das Tötungsverbot zu verstoßen. Dabei hat der Bundesgerichtshof schon im letzten Jahrhundert klargestellt, dass eine ärztlich gebotene schmerzlindernde Maßnahme auch dann durchgeführt werden darf, wenn als mögliche (nicht beabsichtigte) Nebenfolge der Tod früher eintreten könnte (sogenannte »indirekte Sterbehilfe«). 6
Im Gegensatz hierzu ist die Tötung auf Verlangen in Deutschland nach § 216 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar. Aktuell lassen weltweit lediglich die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Kanada und Kolumbien sowie der australische Bundesstaat Victoria die Tötung auf Verlangen unter gesetzlich definierten Bedingungen straffrei ( 
Kap. 3.1.3
). Deutlich von der Tötung auf Verlangen zu unterscheiden ist die freiverantwortliche Selbsttötung und die Hilfe dazu (auch assistierter Suizid genannt). Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die freiverantwortlich handelnde Person selbst die Tatherrschaft innehat, also die letzte zur Tötung führende Handlung (etwa die Einnahme eines Medikaments) selbst durchführt, während ihr eine andere Person nur bei der Vorbereitung hilft, zum Beispiel indem sie das tödliche Mittel verschafft.
Der hier unterbreitete Vorschlag orientiert sich an der Terminologie, die unter anderem der Nationale Ethikrat, Vorgänger des Deutschen Ethikrats, im Jahre 2006 vorgeschlagen hat: 7
 Beim Sterbenlassen des Patienten (früher als »passive Sterbehilfe« bezeichnet) wird eine lebensverlängernde medizinische Behandlung unterlassen. Dadurch kann der krankheitsbedingte Tod früher eintreten, als dies mit der Behandlung aller Voraussicht nach der Fall wäre. Das Sterbenlassen kann darin bestehen, dass eine lebensverlängernde Maßnahme erst gar nicht eingeleitet wird oder dass eine bereits begonnene Maßnahme nicht fortgeführt oder durch aktives Eingreifen beendet wird (juristischer Begriff: »Behandlungsabbruch«). 8
Beim Sterbenlassen des Patienten (früher als »passive Sterbehilfe« bezeichnet) wird eine lebensverlängernde medizinische Behandlung unterlassen. Dadurch kann der krankheitsbedingte Tod früher eintreten, als dies mit der Behandlung aller Voraussicht nach der Fall wäre. Das Sterbenlassen kann darin bestehen, dass eine lebensverlängernde Maßnahme erst gar nicht eingeleitet wird oder dass eine bereits begonnene Maßnahme nicht fortgeführt oder durch aktives Eingreifen beendet wird (juristischer Begriff: »Behandlungsabbruch«). 8
 Bei Therapien am Lebensende können Maßnahmen durchgeführt werden, die das Ziel haben, Leiden zu lindern, bei denen jedoch in Kauf genommen wird, dass sie möglicherweise die letzte Lebensphase verkürzen und dadurch einen vorzeitigen Tod herbeiführen (früher als »indirekte Sterbehilfe« bezeichnet). Daten aus der palliativmedizinischen Forschung weisen allerdings darauf hin, dass eine korrekt durchgeführte Schmerz- und Symptombehandlung nur äußerst selten ein lebensverkürzendes Risiko birgt, vielmehr in aller Regel eher lebensverlängernd wirkt. 9
Bei Therapien am Lebensende können Maßnahmen durchgeführt werden, die das Ziel haben, Leiden zu lindern, bei denen jedoch in Kauf genommen wird, dass sie möglicherweise die letzte Lebensphase verkürzen und dadurch einen vorzeitigen Tod herbeiführen (früher als »indirekte Sterbehilfe« bezeichnet). Daten aus der palliativmedizinischen Forschung weisen allerdings darauf hin, dass eine korrekt durchgeführte Schmerz- und Symptombehandlung nur äußerst selten ein lebensverkürzendes Risiko birgt, vielmehr in aller Regel eher lebensverlängernd wirkt. 9
 Tötung auf Verlangen (früher als »aktive Sterbehilfe« bezeichnet): Hierbei tötet jemand einen anderen auf dessen ernsthaften Wunsch hin, etwa indem er ein todbringendes Mittel per Injektion verabreicht, um dadurch den Tod herbeizuführen, der krankheitsbedingt zu diesem Zeitpunkt noch nicht eintreten würde. Die Tatherrschaft liegt nicht beim Betroffenen, sondern bei der anderen Person, etwa beim Arzt.
Tötung auf Verlangen (früher als »aktive Sterbehilfe« bezeichnet): Hierbei tötet jemand einen anderen auf dessen ernsthaften Wunsch hin, etwa indem er ein todbringendes Mittel per Injektion verabreicht, um dadurch den Tod herbeizuführen, der krankheitsbedingt zu diesem Zeitpunkt noch nicht eintreten würde. Die Tatherrschaft liegt nicht beim Betroffenen, sondern bei der anderen Person, etwa beim Arzt.
 Hilfe zur Selbsttötung liegt vor, sofern ein Arzt oder eine andere Person jemanden bei der Vorbereitung oder Durchführung einer freiverantwortlichen Selbsttötung unterstützt, etwa indem der Helfende ein todbringendes Mittel verordnet oder verschafft. Dabei führt der Betroffene die Tat selbst aus und behält die Tatherrschaft. Dadurch ist die Hilfe zur Selbsttötung klar von der Tötung auf Verlangen abgegrenzt.
Hilfe zur Selbsttötung liegt vor, sofern ein Arzt oder eine andere Person jemanden bei der Vorbereitung oder Durchführung einer freiverantwortlichen Selbsttötung unterstützt, etwa indem der Helfende ein todbringendes Mittel verordnet oder verschafft. Dabei führt der Betroffene die Tat selbst aus und behält die Tatherrschaft. Dadurch ist die Hilfe zur Selbsttötung klar von der Tötung auf Verlangen abgegrenzt.
1.1.2 Praxis und Regelung der Suizidhilfe in Deutschland
Die Selbsttötung und ihr Versuch sind in der Bundesrepublik Deutschland nicht strafbar. Konsequenterweise traf dies bis zum Jahre 2015 ebenfalls auf die Hilfe zur Selbsttötung zu, sofern die Selbsttötung oder deren Versuch freiverantwortlich erfolgte. Nachdem in den Jahren vor 2015 vermehrt Suizidhilfe durch private Vereine und Einzelpersonen in Deutschland durchgeführt und auch medial darüber berichtet wurde, entstand eine gesellschaftliche Diskussion um eine mögliche gesetzliche Regelung der Suizidassistenz. Die erste Auflage des vorliegenden Buches, die im Jahr 2014 erschien, wurde durch diese Diskussion veranlasst und brachte einen konkreten Gesetzesvorschlag in die Debatte ein. Im Deutschen Bundestag entstanden schließlich vier verschiedene Gesetzesentwürfe interfraktioneller Gruppen. Am 5. November 2015 entschieden sich die Parlamentarier mehrheitlich für einen Entwurf, der als »Gesetz über die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung« am 10. Dezember 2015 schließlich Gesetzeskraft erlangte.
Читать дальше
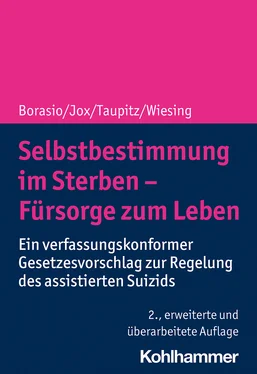

 Beim Sterbenlassen des Patienten (früher als »passive Sterbehilfe« bezeichnet) wird eine lebensverlängernde medizinische Behandlung unterlassen. Dadurch kann der krankheitsbedingte Tod früher eintreten, als dies mit der Behandlung aller Voraussicht nach der Fall wäre. Das Sterbenlassen kann darin bestehen, dass eine lebensverlängernde Maßnahme erst gar nicht eingeleitet wird oder dass eine bereits begonnene Maßnahme nicht fortgeführt oder durch aktives Eingreifen beendet wird (juristischer Begriff: »Behandlungsabbruch«). 8
Beim Sterbenlassen des Patienten (früher als »passive Sterbehilfe« bezeichnet) wird eine lebensverlängernde medizinische Behandlung unterlassen. Dadurch kann der krankheitsbedingte Tod früher eintreten, als dies mit der Behandlung aller Voraussicht nach der Fall wäre. Das Sterbenlassen kann darin bestehen, dass eine lebensverlängernde Maßnahme erst gar nicht eingeleitet wird oder dass eine bereits begonnene Maßnahme nicht fortgeführt oder durch aktives Eingreifen beendet wird (juristischer Begriff: »Behandlungsabbruch«). 8