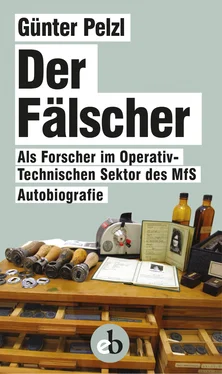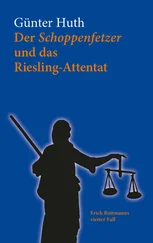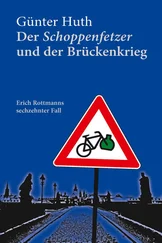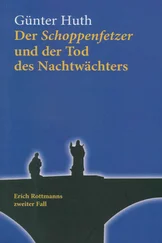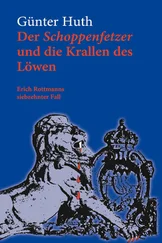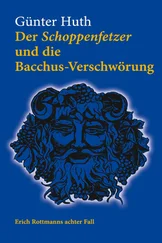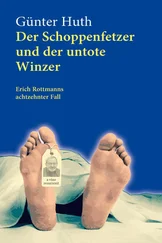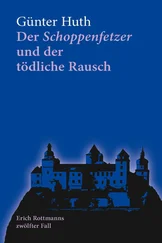Ein einziges Mal nutzte ich seine fachmännischen Fähigkeiten, aber mit fatalen Folgen. Als ausgemachter Beatles-Fan hatte ich ein Paar elegante, braune Schuhe erstanden. Vorn spitz, hatten sie einen flachen Absatz und eine dünne Ledersohle. Leider waren die Sohlen bald durchgetanzt, und ich hoffte, der Schuster könnte das beheben. Er war aber Schuster und kein Schuhmacher. Der Unterschied zwischen beiden war mir damals nicht geläufig. Als er die Schuhe betrachtete und ungläubig den Kopf schüttelte, was man alles so als Schuh bezeichnete, hätte ich die Sache noch abbrechen können. Als ich nach Tagen meine geliebten Schuhe in Empfang nahm, blieb mir der Dank fast im Halse stecken. Mit diesen von ihm frischbesohlten Botten hätte ich den glühenden Vesuv besteigen können, ihre Karriere als Tanzschuhe war beendet. Ein richtiges Dorf brauchte einen Schuster, keinen Schuhmacher.
Irgendwann an einem heißen Sommerabend kam einmal eine langersehnte Lieferung für den Konsum: ein ganzes Holzfass gefüllt mit grünen Heringen. Es war kurz vor Ladenschluss, das Wochenende war gekommen. Meine Eltern wussten genau, dass Montagfrüh kein Hering mehr genießbar sein würde. Guter Rat war teuer. Mutter hatte ihre »Küchenausbildung« natürlich bei Oma Elsa absolviert, und so hatte sie die rettende Idee. Das ganze Wochenende hindurch wurde mit Mehl, Zwiebeln, Zucker und Essig hantiert und gebraten. Wir produzierten Bratheringe!
Die Bratheringe waren am Montag der Verkaufsschlager schlechthin. Mittags waren sie alle. Kein Ammerbacher kam zu Schaden. Im Gegensatz zur Geschichte in der Bibel kamen nur genauso viele Bratheringe heraus, wie Heringe im Fass gewesen waren. Eine wundersame Vermehrung blieb aus. Mich wunderte das nicht. Mein Vertrauen in die Kraft biblischer Gleichnisse ging schon damals gegen null. Leider hatte die staatliche Konsumbürokratie dafür keinerlei Verständnis. Obwohl mein Vater eine perfekte Kalkulation vorlegte und der Konsum keinen einzigen Heringsschwanz abschreiben musste, hatten meine Eltern gegen alle möglichen Bestimmungen verstoßen. Die auferlegte Strafe war wohl aber nicht allzu hoch, der Konsumbetrieb ging jedenfalls weiter seinen gewohnten Gang.
Urgroßmutter Elsas Kochkunst war unbeschreiblich. Sie kannte alle Tricks, aus einfachsten Zutaten die besten Gerichte zu zaubern. Nur so konnte man in dem bitterarmen Thüringer Bergen über die Runden kommen. Sie kannte alle Gewürze, Kräuter und Pilze und sammelte und trocknete selbst.
Man kann nicht über Elsas Küche erzählen, ohne ihr Pflaumenmus zu erwähnen. Die Pflaumen, wir nannten sie »Zwetschgen« oder, was sich für Kinder leichter aussprach, »Quetschen«, durften nur vom Boden aufgesammelt werden. Nur so war gesichert, dass sie süß genug für das Mus waren. Sie hatten dann auch den passenden Namen: »Runzelärsche«. Man brauchte nur eine derartige Quetsche von der Stielseite aus – ohne Stiel – zu betrachten und schon wusste man, warum. Elsa kontrollierte genau – ausschließlich Runzelärsche gelangten in den Topf. Die Steine wurden mit der Hand entfernt, was eine ziemlich matschige Angelegenheit war. Maden spielten keine große Rolle, fast alle Runzelärsche hatten welche. Zucker wurde nie zugesetzt, der war zu teuer. Außerdem brannte das Mus damit schneller an. Grüne Walnüsse mussten sein, die färbten dann das Mus schön schwarz. Eingekocht wurde im Waschkessel. Einer musste ständig rühren, ich habe mich immer gedrückt. Gelagert wurde das Mus in Tontöpfen, die mit Pergamentpapier und einem Bindfaden verschlossen worden waren. Wenn im Winter ein solcher Topf geöffnet wurde, schnitt Elsa den harten schimmligen Deckel, der sich auf dem Mus gebildet hatte, heraus.
So trafen sich dann Elsas thüringische Kochkünste und die kulinarischen Vorlieben meines aus Mähren stammenden Vaters: Meine Mutter füllte mit Pflaumenmus Buchteln. Das waren mährische Hefebrötchen. Man findet sie heute noch in Mähren, Österreich, Bayern und Tirol, also genau da, wo die Pelzls herkommen. Aber davon später.
Elsa Hartmanns Spitzengericht waren Thüringer Klöße und Sauerbraten. Dazu gab es Rotkraut oder, wenn der Braten »Kassler« hieß, Sauerkraut. Die geriebenen Kartoffeln presste sie selbst mit ihrem Knie durch das Rohrgeflecht des Küchenstuhls aus. Ihre zwei Zentner Lebendgewicht waren da sehr hilfreich. Das ausgepresste »Gereibe« kam in eine große weiße, schon etwas ramponierte Abwaschschüssel aus dem Küchentisch. In diese Masse wurde der von einem Drittel der gesamten Kartoffelmenge gewonnene, kochend heiße, dünne Kartoffelbrei gegeben und mit einem großen Quirl schnell verrührt. Wir wurden immer aus der Küche gejagt, denn das Hantieren mit dem blubbernden und spritzenden Kartoffelbrei war gefährlich. Noch heiß, wurden aus dem zähen Teig Klöße geformt, welche die in Margarine gerösteten und gesalzenen Semmelbröckchen umhüllten. Die Klöße kamen in einen großen Topf mit kochendem Wasser. Der Topf wurde vom Feuer gezogen, und nach einigen Minuten stiegen die Thüringer Klöße nach oben, was bedeutete, dass sie serviert werden konnten. Es war jedes Mal ein Gaumenschmaus!
Ebenso unschlagbar waren Elsas Kuchen. Auf ihrer engen Treppe stand in der Ecke immer ein Gestell mit runden Kuchenbrettern aus Holz. Darauf waren je nach Jahreszeit im Angebot Quetschenkuchen, Mohnkuchen, Kirsch- und Streuselkuchen. Mit Muckefuck, das heißt Malzkaffee mit Magermilch, aus einer weißen angeschlagenen emaillierten Blechkanne, die immer auf dem Ofen stand, konnte man den Hefekuchen auch am Ende der Woche noch mit Genuss essen, ohne Malzkaffee benötigte man allerdings eine Säge. Dieser Muckefuck und auch der Mohnkuchen sind leider ausgestorben.
Das Mohnkuchenrezept kenne ich nicht in allen Einzelheiten, aber ich erinnere mich, dass der Mohn, eine für Thüringen typische Kulturpflanze, in einer alten Kaffeemühle, die man zwischen den Knien halten musste, gequetscht und dann mit heißer Milch und Grieß aufgebrüht wurde. Wenn vorhanden, kamen noch Rosinen hinzu. Der Boden war selbstverständlich aus Hefeteig, und obendrauf kamen Eierschecke oder kreuzweise aufgelegte Teigstreifen. Diesen Kuchen mit einer zwei Finger dicken schwabbeligen Mohnschicht konnte man einfach nicht vornehm essen. Am besten schmeckte er, wenn er noch warm war, aber meistens konnte Elsa das verhindern. Sie sagte immer streng: »Mohn macht dumm!« Da wollte sie die Mengen wohl lieber genau kontrollieren.
Wenn ich schon von Kuchen schreibe, darf ich natürlich den Stollen nicht vergessen. Alles, was meine Mutter kochen und backen konnte, hatte sie von Elsa gelernt, und die war eine strenge Lehrerin. Der Gütekontrolleur war Richard, Elsas Mann. Was der nicht aß, war in seinen Augen auch für andere völlig ungenießbar. Als Elsa gestorben war, ließ sich Richard nur von meiner Mutter bekochen, obwohl er mit seiner Tochter Trude und dem Schuster, ihrem Mann, in einem Hause wohnte. So wanderte vor allem am Sonntag dann einer mit einer gläsernen Schottschüssel, Thüringer Klößen und Karnickelbraten über die Dorfstraße zu Richard. Karnickel hatte er genug, nachdem das mit den Gänsen nichts geworden war. Meine Mutter bekam sie küchenfertig von ihm. Noch heute bin ich im Besitz einer kleinen runden Bratpfanne, die aus Elsas Hausstand stammt. Die hat mir meine Mutter vererbt, und darin brennt nichts an. »Geboren« wurde diese Pfanne im Ersten Weltkrieg – als Stahlhelm oder als Granatenhülse. Konversion hält lange an, wenn man nur will.
Aber zurück zum Stollen. Zitronat, Rosinen, Mandeln, Nüsse, Butter gab es, wenn überhaupt, nur kurz vor Weihnachten. Meine Mutter saß an der Quelle, sie leitete ja den Konsum im Ort. Sechs Vierpfundstollen waren keine Seltenheit. Sie reichten dann aber auch bis April. Der Bäcker wohnte etwas außerhalb des Dorfes, unterhalb des Friedhofs, und vergab für die Dorfbewohner feste Backzeiten für den Stollen und lieferte auch die Hefe, wenn es im Konsum keine gab. Hefe brauchte man, denn der Stollen musste »gehen«. Das verstand ich nicht, aber Mutter zeigte mir, wie der kleine Kuchenklops mit einem Wischtuch abgedeckt sich in der Wärme zunehmend vergrößerte. Das nannten alle »gehen«, obwohl der Teig in der Schüssel blieb, er ging eben nach oben. Das größte Problem war der Transport. Kein vernünftiger Mensch würde bei frostigen zehn Grad minus den aufgegangenen Hefestollen auch nur einen Meter weit über den Hof tragen. Der sofortige Tod des Stollens wäre die Folge. Zum Bäcker waren es aber etwa zwei Kilometer Fußmarsch. Da halfen nur angewärmte Federbetten, eine Wärmflasche, ein Kinderwagen und Tempo. Es ist immer gutgegangen, auch bei Glatteis. Noch heute bedauere ich, dass ich von meiner Mutter zwar das Kochen gelernt habe, nicht aber das Backen. Das war nicht ihre Schuld. Damals hat mich das leider nicht sonderlich interessiert; ich durfte ja immer »nur« zusehen.
Читать дальше