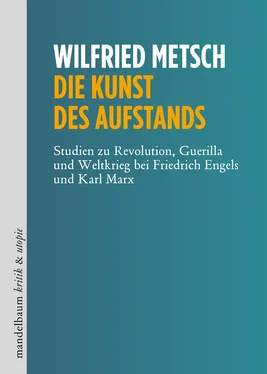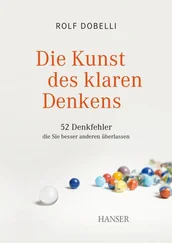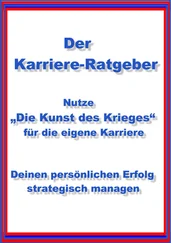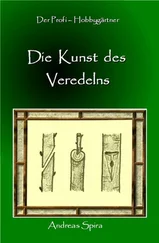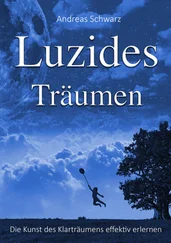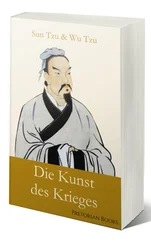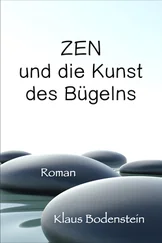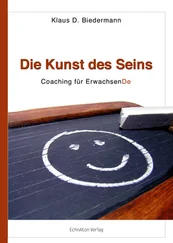Während des Aufstands den »Kern einer revolutionären Armee zu organisieren«, 87ist jedoch aufgrund der asymmetrischen Ausgangslage eine schwer zu lösende Aufgabe, denn zumeist verfügt die herrschende Regierungsmacht über intakte und überlegene Streitkräfte zur Niederschlagung der Insurrektion. Prinzipielle Unterlegenheit der Aufständischen (s. u.) charakterisiert den bewaffneten Konflikt.
Zum Verständnis dieser Problematik sei kurz angemerkt, dass im 19. Jahrhundert keine (kasernierten/paramilitärischen) Polizeikräfte zur Bekämpfung von Aufständen und Unruhen existierten. Diese Aufgabe oblag dem Militär und wurde durch Ausrufung des Belagerungszustandes und der Unterstellung der Zivilbehörden unter das militärische Kommando realisiert. Erst in und nach der Weimarer Republik kam es schrittweise zur Militarisierung der Polizei, um Unruhen niederzuwerfen. Die Militarisierung der Polizei hat inzwischen enorme Ausmaße angenommen und ist zur Revolutionsunterdrückung bestens geeignet. Das Militär übernimmt nur noch bei extremen Gewaltauseinandersetzungen – im Rahmen von Notstandsgesetzen – Polizeifunktionen zur Herstellung von Ruhe und Ordnung. 88
Die brutale Unterdrückungsfunktion des Militärs hat Friedrich Engels während der Revolution von 1848/49 am eigenen Leib erfahren; sie hat ihn zu umfangreichen militärischen Studien veranlasst. 89
Die Problematik des frühproletarischen Aufstands
Nüchtern analysieren Marx und Engels die asymmetrischen Kräfte und Mittel im frühproletarischen gewaltförmigen Revolutionsprozess.
a)Waffen und Munition
»Wo sollten sie auch Waffen und Munition hernehmen?« 90Der Sturm auf die »Jagd- und Luxusflinten der Waffenläden« 91oder gar auf die Zeughäuser und Arsenale des Militärs ist äußerst risikobehaftet. 1895 schreibt Engels: »Bis 1848 konnte man aus Pulver und Blei sich die nötige Munition selbst machen, heute ist die Patrone für jedes Gewehr verschieden« und industriell gefertigt, sodass »die meisten Gewehre nutzlos sind, solange man nicht die speziell für sie passende Munition hat.« 92So wurde noch 1848 in Paris während des Juniaufstands aus Schießbaumwolle Munition »in großen Massen im Faubourg Saint Jacques und im Marais fabriziert. Auf dem Platz Maubert war eine Kugelgießerei angelegt.« 93
Zudem verfügt die Linieninfanterie des Staates mit der Artillerie (Kanonen/Kartätschen/Granaten) über wirkungsvolle Gewaltmittel, während die Insurgenten üblicherweise »keine brauchbaren Kanonen« 94besitzen.
b)»Schulung« 95und »Disziplin« 96
Die militärischen Repressionsstreitkräfte »haben die Handhabung der Waffen, die Kunst sich zu organisieren und sich mit dem Gewehr in der Hand zu verteidigen« 97gelernt. Zudem verfügen sie über »die Kriegserfahrung von Generälen« 98und »gute Cadres« 99– also über akkumuliertes Kriegswissen, um Aufstände zu bekämpfen.
c)»Organisation« 100
Da das Militär einer »einheitlichen Leitung« unterliegt, ist eine »planmäßige Verwendung« 101und die jederzeitige »Konzentration der Streitkräfte auf einen entscheidenden Punkt« 102möglich.
d)»Dislokation« 103und Kommunikation
Die Verteilung der Streitkräfte im ganzen Land in gesicherten Ausgangsbasen wie Garnisonen und »ohne Militärinsurrektion uneinnehmbare Zitadelle(n)« 104sichert rasche Verfügbarkeit und Verstärkung. So war 1848/49 das Rheinland schon »durchschnitten in allen Richtungen von Eisenbahnen, mit einer ganzen Dampftransportflotte zur Verfügung der Militärmacht«. 105
Die Asymmetrie der Macht- und Kräfteverhältnisse, insbesondere der militärischen Mittel, prägt also entscheidend den bewaffneten Konflikt der frühproletarischen Insurgenten. So analysieren Marx und Engels 1848/49 in der »Neuen Rheinischen Zeitung« nahezu alle Aufstände – sei es in Paris, Prag, Berlin, Frankfurt, Wien, etc. –, um die revolutionären Arbeiter auf mögliche zukünftige bewaffnete Konflikte vorzubereiten.
Für proletarische Insurgenten stellt sich immer wieder die Frage: »Womit Revolution machen ohne Waffen und Organisation?« 106
Auf Seiten der Aufständischen ist »alles improvisiert«; 107sie kämpfen »ohne einheitliche Leitung« 108und besitzen »keine militärische Direktion«. 109Vor allem mangelt es den Insurgenten an militärischen Kadern: »Wo sollen in so kurzer Zeit die Offiziere herkommen?« 110
Bedenkt man den noch unentwickelten politischen Bewusstseinsgrad des frühen Proletariats und dessen mangelnde Organisationserfahrung, kann man sich lebhaft vorstellen, welche Schwierigkeiten entstehen, wenn man aus »der wirren Masse bewaffneter Proletarier« 111eine schlagkräftige Garde formieren möchte. Die Wiener Revolutionäre machten 1848 bei der Verteidigung ihrer Stadt diese Erfahrung: »Allerdings hatte man zuletzt in aller Eile eine proletarische Garde gebildet; aber da der Versuch, auf diese Weise den zahlreichsten, mutigsten, tatkräftigsten Teil der Bevölkerung heranzuziehen, viel zu spät kam, war sie mit dem Gebrauch der Waffen und mit den allerersten Anfängen der Disziplin zu wenig vertraut, um erfolgreich Widerstand zu leisten.« 112
Das wilde Anstürmen der Volksmassen, diese »revolutions improvisees, wie die Franzosen sie nennen«, 113oder »das unvorbereitete Losschlagen« 114ist zwar heldenhaft, aber zumeist mit schrecklichen Folgen für die Aufständischen verbunden. Als Beispiel zitiert Marx die Mailänder Erhebung von 1853: »[…] bewundernswert ist sie als Akt des Heroismus einiger weniger Proletarier, die nur mit Messern bewaffnet, einen Angriff gegen die Zitadelle einer Garnison und gegen eine Armee von 40 000 Mann der besten Truppen ganz Europas wagten.« 115
Die Kampfform des Aufstands im frühen 19. Jahrhundert
»Straßenkampf mit Barrikaden« 116– dies ist das klassische Bild des Aufstands im 19. Jahrhundert. Unter dem Ruf »Auf die Barrikaden!« bricht zumeist der Revolutionssturm los. Dieser »Zauber« 117hält lange vor; er wird auch nicht durch die schweren Niederlagen im Pariser Juni 1848, im Wiener Oktober 1849 oder im Dresdner Mai 1849 destruiert. Die kurzfristigen Barrikadensiege 1848/49 stilisieren diese zum entscheidenden Instrument der Volkserhebung. So überrascht es nicht, dass der sozialistische Revolutionär Louis-Auguste Blanqui noch 1868/69 in seinen »Instruktionen für den Aufstand« präzise Anleitungen und Skizzen für die systematische Anlage von Barrikaden verfasst.
Kampfterrain ist die Stadt, die Häuser und Barrikaden sind die Befestigungs- und Verschanzungspunkte der Insurgenten. Das Militär soll im Angriff auf diese seine Kraft verschleißen und zusammenbrechen. Die Kampfszenen gleichen einander immer wieder: »Überall erheben sich Barrikaden und halten das Militär auf.« 118Engels beschreibt anschaulich die Kampfszenen eines typischen Aufstands in seiner Heimatregion Düsseldorf:
»Gegen Abend entspann sich der Kampf. Die Barrikadenkämpfer waren, hier wie überall, wenig zahlreich. Wo sollten sie auch Waffen und Munition hernehmen? Genug, sie leisteten der Übermacht langen und tapfern Widerstand, und erst nach ausgedehnter Anwendung der Artillerie, gegen Morgen, war das halbe Dutzend Barrikaden, das sich verteidigen ließ, in den Händen der Preußen.« 119
Über den frühproletarischen Juniaufstand 1848 in Paris verfasst Engels in der »Neuen Rheinischen Zeitung« eine »rein militärische Darstellung des Kampfes«, 120nicht nur um die Tapferkeit des Pariser Proletariats zu würdigen, sondern auch um sich und die Arbeiterbewegung über Bedingungen und Chancen eines Sieges im Straßenkampf zu verständigen. Akribisch notiert er die Art und Weise der Hauptbefestigungen:
»Barrikaden von merkwürdiger Stärke waren hier errichtet, teils von den großen Pflasterquadern gemauert, teils von Balken zusammengezimmert. Sie bildeten einen Winkel nach innen zu, teils um die Wirkung der Kanonenkugeln zu schwächen, teils um eine größere, ein Kreuzfeuer eröffnende Verteidigungsfront darzubieten. In den Häusern waren die Brandmauern durchbrochen und so jedesmal eine ganze Reihe in Verbindung miteinander gesetzt, so daß die Insurgenten nach dem Bedürfnis des Augenblicks ein Trailleurfeuer auf die Truppen eröffnen oder sich hinter ihren Barrikaden zurückziehen konnten.« 121
Читать дальше