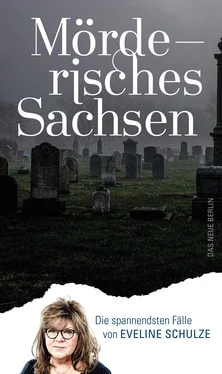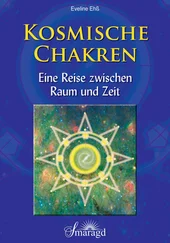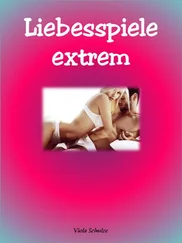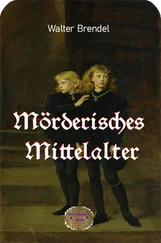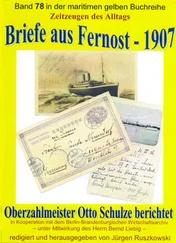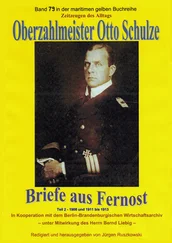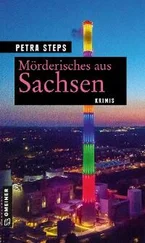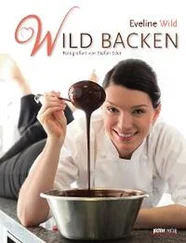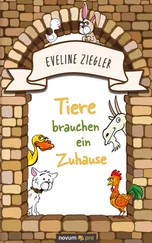Donnerstag, 6. Juli
Das Kommissariat II der Kriminalpolizei in Görlitz quittiert den Eingang aller Unterlagen aus Zittau, die Bearbeitungsfrist für das Ermittlungsverfahren wird auf den 15. Juli 1967 festgelegt. Viel Zeit lässt man sich also nicht. Es wird, so heißt es auf der Quittung, wegen »dringendem Tatverdacht des Mordes« seit dem 1. Juli gegen den Transportarbeiter Morche ermittelt.
Dazu ordnet Oberleutnant der K Horstmann als amtierender Leiter der Abteilung K in Görlitz an:
»1. Ermittlung und Vernehmung von Zeugen
2. Vernehmung des Beschuldigten auf Tonband
3. Überprüfung des Gesundheitszustandes des Beschuldigten und Einholung gesundheitsmäßiger Gutachten
4. Beantragung eines Unterbringungsbefehls
5. Zusammenwirken und Übergabe des Ermittlungsverfahrens mit Kommissariat II organisieren.«
Montag, 10. Juli
Oberleutnant Strengeld sucht in Zittau das Haus Äußere Weberstraße 70 auf, in welchem Anni Hölzel bis zu ihrer Ermordung 1949 gewohnt hat. Unmittelbarer Anlass für diesen Ortstermin, den er gemeinsam mit Unterleutnant Kahlert von der Abteilung Schutzpolizei des VPKA wahrnimmt, ist die Selbstbezichtigung Morches, eine Marianne Böhmer erschlagen zu haben. Sie habe in dem Haus gegenüber der HO-Gaststätte Freudenhöhe über der Fleischerei gewohnt. Im Protokoll steht: »Weiterhin erklärte der Beschuldigte, dass die Marianne Böhmer einen Sohn hat, der jetzt noch in dem bezeichneten Hause wohnhaft sei.«
Strengeld und Kahlert notieren nach dem Ortstermin: »Wie einige seit 1945 in diesem Hausgrundstück wohnhafte Hausbewohner erklärten, hat in diesem Haus nach 1945 nie eine Marianne Böhmer gewohnt.«
Bei der Gelegenheit erkundigen sich die beiden Polizisten auch, was aus dem Sohn der tatsächlich ermordeten Verkäuferin, Wolfgang Hölzel, geworden sei. »Nach dem Ableben seiner Mutter«, so heißt es in der Aktennotiz, sei er verzogen, sein derzeitiger Aufenthaltsort sei den Hausbewohnern nicht bekannt.
Wie sich also zeigt, liegt bei dem offenkundig geistig verwirrten Morche eine namentliche Verwechslung vor. Es geschah damals tatsächlich ein Mord in Zittau, aber nicht, wie er meint, 1950, sondern bereits im Jahr zuvor. Und das Opfer hieß nicht Marianne Böhmer, sondern Anni Hölzel. Das Einzige, was stimmt, ist der Fundort der Leiche.
Was aber hat Karl Morche mit diesem Mordfall zu tun? Gibt es überhaupt eine Verbindung? Und war er damals noch klar im Kopf, also schuldfähig, als er vielleicht zum Mörder wurde?
Dienstag, 11. Juli
Oberleutnant der K Strengeld beantragt beim Staatsanwalt des Kreises Zittau die Anordnung der Durchsuchung der Wohn- und Nebenräume des Transportarbeiters Karl Morche in der Inneren Oybiner Straße 6.
»Es ist bekannt, dass der Beschuldigte schon mehrfach wegen manischer Depressionen in der Pflegeanstalt Großschweidnitz durch Ärzte eingewiesen worden war. Unbeschadet dessen ist zu befürchten, dass der Beschuldigte tatsächlich den Mord, dessen er sich selbst bezichtigt, begangen haben kann. Deshalb ist die Durchsuchung der Wohn- und Nebenräume des Beschuldigten zwingend notwendig und auch rechtlich begründet, um nach Beweismitteln (Handtasche der Ermordeten mit Inhalt u.a.m.) zu suchen.«
Am gleichen Tag geht ein von Hauptmann der K Niebel unterzeichnetes Schreiben von Görlitz an das Amt für Meteorologie in Dresden. Die Ermittler wollen wissen, »welche Witterungsverhältnisse im Stadtgebiet von Zittau herrschten,
a) am Freitag, dem 28. Juli 1950, in der Zeit von 00.40 bis 01.30 Uhr
b) am Sonntag, dem 05. Juni 1949, in der Zeit von 00.40 bis 01.30 Uhr.
Bei den erbetenen meteorologischen Angaben interessieren u.a. insbesondere Temperatur, Windrichtung und -stärke, Bewölkungsart und -dichte, Sichtverhältnisse, Niederschlag (Dauer, Art und Menge), Mondaufgangs- und -untergangszeit, Mondphase.«
Drei Tage später kommt die Antwort: Am 5. Juni 1949 war es in der fraglichen Zeit mit elf Grad vergleichsweise frisch und der Himmel leicht bewölkt. Der Mond befand sich im ersten Viertel. Es war trocken, der letzte Regen am Tag zuvor am Morgen gefallen.
Am 28. Juli 1950 maß man in Zittau ebenfalls nur elf Grad, es war windstill und wolkenlos, ein Tag vor Vollmond und also hell. Geregnet hatte es letztmalig am Nachmittag des Vortages.
Dienstag, 18. Juli
Die Kriminalpolizei durchsucht Morches Wohnung. Dabei werden unter anderem eine schwarze Damenlederhandtasche, ein Taschenspiegel und ein leeres Parfümfläschchen beschlagnahmt.
Das »Durchsuchungs- und Beschlagnahmeprotokoll«, unterzeichnet von Staatsanwalt Pollack, Oberleutnant der K Strengeld und Leutnant der K Täsche umfasst elf Positionen, darunter sechzehn »Zettel mit unverständlichen Aufzeichnungen«.
Die Kriminalisten vermuten, dass es sich bei der Tasche, dem Spiegel und dem Flakon um persönliche Gegenstände der Ermordeten handeln könnte. Sie legen später diese Handtasche und drei weitere Taschen verschiedenen Zeugen vor.
Donnerstag, 20. Juli
Hauptmann der K Niebel bittet schriftlich bei der Deutschen Post in Dresden (Fernmeldeamt/Fernsprechbuchstelle) um die leihweise Überlassung Zittauer Telefonbücher. Sie ermittelten in einer Raubmordsache, schreibt er. »Die Ermordete hatte damals vor dem Verbrechen von ihrer Arbeitsstelle ein Ferngespräch (Stadtgespräch) geführt. Bei den jetzt notwendig werdenden Überprüfungen wird ein Fernsprechverzeichnis der Stadt Zittau aus dem Jahre 1950 und ein solches aus dem Jahre 1952 benötigt.«
Was man sich davon verspricht, wissen allein die Kriminalisten.
Am 17. August gehen die Bücher in Görlitz ein.
Mittwoch, 26. Juli
Gegen die Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme führt Karl Morche Beschwerde, insbesondere protestiert er gegen die Konfiszierung der Handtasche, die für ihn ein Andenken an seine verstorbene Mutter sei.
Oberleutnant Strengeld reagiert nach einer telefonischen Information durch die Kreisstaatsanwaltschaft Zittau mit einem Schreiben an Staatsanwalt Pollack. Er beantragt, den Einspruch abzuweisen. Als Untersuchungsorgan habe die Kriminalpolizei »zu prüfen, ob der Beschuldigte oder eine andere Person Täter ist. Der ermordeten HO-Verkäuferin Hölzel hat damals, am 28. Juli 1950, der Täter eine schwarze lederne Handtasche offenbar geraubt. Leider ist im Rahmen der damaligen Aufklärungsarbeit die Handtasche der Ermordeten so mangelhaft beschrieben worden, dass jetzt von vornherein nicht festgestellt werden kann, ob die in der Wohnung des Beschuldigten gefundene und beschlagnahmte Damenhandtasche die der Ermordeten ist oder nicht. Das ist jetzt zu überprüfen. Hierzu sollen mehrere schwarze lederne Damenhandtaschen sowohl Personen aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis sowie ehemaligen Kolleginnen der Ermordeten als auch Verwandten des Beschuldigten vorgelegt werden.«
Um 15.30 Uhr sendet die Görlitzer Kriminalpolizei ein Fernschreiben an die Kollegen im VPKA Glauchau. Man erbittet dort die Anschrift und Personalien des Ofensetzmeisters Erich Thieme, der 1950 in Glauchau wohnhaft gewesen sein soll. »Hatte intime Beziehungen zu der HO-Verkäuferin Anni Hölzel«, heißt es da. »Diese wurde in Zittau am 28.07.1950 Opfer eines ungeklärten Tötungsverbrechens. Aktenmaterial weist nicht aus, dass Th. damals überprüft wurde (Alibi).«
Das Fernschreiben endet mit der Weisung, Thieme »nicht befragen«. Die Antwort erbitten die Görlitzer bis zum 28. Juli.
Wodurch man auf Thieme aufmerksam wurde und ihn offenkundig für eine heiße Spur hält, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Auch nicht, ob er überhaupt jemals vernommen wird.
Einen Tag vor Ablauf der Frist rattert 7.15 Uhr der Fernschreiber. Thieme wohnt in Glauchau, Platz der Freundschaft 4, meldet der Oberleutnant der K Schumann.
Montag, 31. Juli
Morgens um 8.30 Uhr wird der Flussmeister Martin Lange von Oberleutnant der K Strengeld befragt. Die Ermittler wollen wissen, ob die – vermeintliche oder tatsächliche – Tatwaffe, jene von Morche genannte Eisenstange, eventuell in dem etwa vierzig Kilometer langen Flüsschen namens Mandau gefunden worden ist. Martin Lange war im Sommer 1958 als Tiefbauarbeiter des VEB Gewässerunterhaltung und Meliorationsbau Dresden an Arbeiten am Flussbett der Mandau in Zittau beteiligt.
Читать дальше