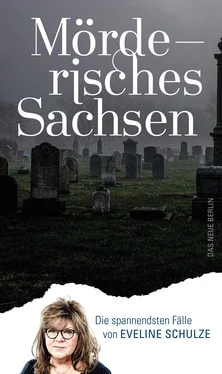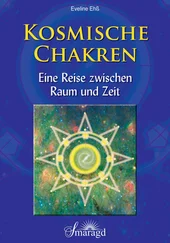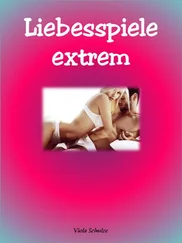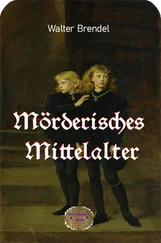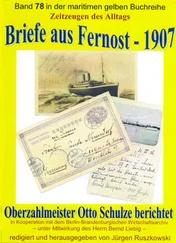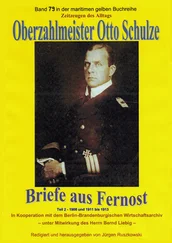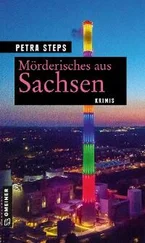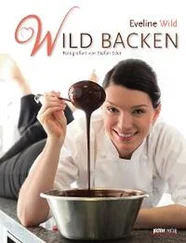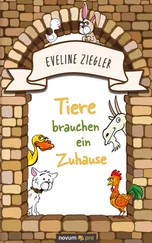Frage: Hatte Ihr Vater, der selbständige Fleischermeister Walter Tzscherlich, Telefon im Hause?
Antwort: Ja. Wir hatten einen Telefonanschluss zu Hause. Mein Vater verstarb am 14. Dezember 1957 an Lungenkrebs. Wann meine Eltern den Fleischerladen schlossen, weiß ich nicht mehr. Sie betrieben die Fleischerei schon nicht mehr im Jahr meiner Eheschließung. Das Telefon existierte bereits 1950 nicht mehr. Auf der fotokopierten Ausgabe des Fernsprechanschlussverzeichnisses der Stadt Zittau von 1950, die mir vorgelegt wurde, finde ich den Telefonanschluss meines Vaters auch nicht mehr.
Frage: Hatten Ihre Schwiegereltern, hatte der Schneidermeister Josef Morche einen Telefonanschluss?
Antwort: Als ich 1948 meinen späteren Ehemann kennenlernte, hatten Morches noch keinen Anschluss. Später hatten sie Telefon im Hause, aber genau kann ich das nicht sagen. Anhand der vorgelegten Fotokopien des Telefonanschlussverzeichnisses von Zittau kann ich sagen, dass erst in der Ausgabe von 1952 mein damaliger Schwiegervater Josef Morche unter der Telefonanschlussnummer 3566 verzeichnet ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein geschiedener Ehemann und ich oft miteinander telefoniert hätten. Er hat mich nur selten im Geschäft, also auf der Arbeitsstelle, angerufen, sonst nicht.
Frage: Waren Sie mit Ihrem geschiedenen Ehemann in den HO-Gaststätten Volkshaus und Dreiländereck in Zittau zu Gast?
Antwort: Ja. Vor unserer Ehe und auch zu Anfang bin ich manchmal mit ihm an Wochenenden oder an Feiertagen dorthin gegangen. Andere Gaststätten haben wir nur selten aufgesucht.
Frage: Kannten Sie oder Karl Morche Angestellte aus dem Volkshaus oder dem »Dreiländereck«?
Antwort: Persönlich kenne ich nur den Kollegen Raschke, den Objektleiter des »Dreiländerecks«, und den Kollegen Schulz, den Objektleiter des Volkshauses. Sonst kenne ich keinen Angestellten dort. Ob mein geschiedener Mann irgendeinen weiblichen oder männlichen Angestellten in den beiden HO-Gaststätten kennt, weiß ich nicht.
Frage: Können Sie sich erinnern, wie oft Sie von Karl Morche 1950 besucht wurden?
Antwort: Ich kann mich nicht erinnern, dass er einmal bis Mitternacht geblieben wäre. Das hätten meine Eltern auch nicht geduldet. Ich war 1950 erst 18 Jahre alt. Es kann nur sein, dass wir einmal ausgegangen sind und er mich nach Hause gebracht hat. Wir waren meist im Kino. Was er nach der Verabschiedung gemacht hat, ob er eventuell noch wo hingegangen ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass er im Anschluss noch irgendetwas unternommen hat. Ich halte es auch für völlig ausgeschlossen, dass er außer zu mir Beziehungen zu anderen Frauen gehabt oder solche gesucht hat. Es war nicht seine Art, nach anderen Frauen zu schauen. 1950 hat er niemals übermäßig Alkohol getrunken. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals angeheitert oder gar betrunken gewesen ist.
Frage: Haben Sie im Sommer 1950 an einer großen Kulturveranstaltung im Volkshaus teilgenommen, zu der die IG Metall eingeladen hatte und an der Volkskunstgruppen der Volkspolizei und des VEB Phänomen, heute Robur, mitwirkten?
Antwort: Nein. Später besuchte ich einmal im Volkshaus eine solche Kulturveranstaltung, 1950 bestimmt nicht. In welchem Jahr das war, weiß ich nicht. Ich glaube, da waren wir schon verheiratet. Karl Morche hielt sich oft an der Theke auf und war ziemlich angeheitert. Obwohl wir bereits verheiratet waren, wohnten wir noch getrennt bei unseren Eltern. Er brachte mich nach Hause, glaube ich jedenfalls.
Frage: Welchen Weg nahm Karl Morche, wenn er von Ihnen zurück zu seinen Eltern ging?
Antwort: Ich nehme an, dass er über die Äußere Weberstraße nach der Inneren Oybiner Straße 28 gegangen ist. Also am Ende der Äußeren Weberstraße müsste er gegenüber der Weberkirche in die Grünanlagen neben dem Feierabendheim »Rosa Luxemburg« oder in die Dr.-Brinitzer-Straße zur Inneren Oybiner Straße gelaufen sein.
Frage: Nachdem Sie am 1. Juli 1967 in der zu klärenden Sache erstmals als Zeugin vernommen wurden und Sie wissen, dass Ihr geschiedener Ehemann sich selbst bezichtigt hat, an der Weberkirche eine Frau getötet zu haben, hatten Sie Zeit, alles in Ruhe zu überdenken. Haben Sie von Ihrem geschiedenen Mann, auch andeutungsweise, jemals gehört, dass er mit diesem Tötungsverbrechen in Verbindung stünde?
Antwort: Nein, niemals. Ich habe niemals, auch nicht andeutungsweise, aus dem Mund meines geschiedenen Ehemannes etwas dazu gehört. Selbst wenn er betrunken war, und das war später in unserer Ehe oft der Fall, hat er nichts von einem derartigen Tötungsverbrechen erzählt. Auch unter seinen persönlichen Sachen befand sich nichts, was von einer Frau hätte sein können. Ich traue meinem geschiedenen Mann ein solches Tötungsverbrechen nicht zu. Dazu halte ich ihn für nicht fähig. Mein geschiedener Ehemann ist geisteskrank. Er war meines Wissens schon mindestens acht Mal im Fachkrankenhaus für Psychiatrie Großschweidnitz untergebracht. Wenn er seine Anfälle bekam, erzählte er immer den unmöglichsten Blödsinn. Er wollte dann die Einheit Deutschlands zustande bringen und andere verrückte Sachen machen. Aber von einer Mordsache hat er selbst bei solchen geisteskranken Anwandlungen niemals erzählt.
Frage: Sind Sie oder Ihr Sohn Dietmar von Ihrem Ehemann jemals misshandelt worden?
Antwort: Nein. Einmal hat er im betrunkenen Zustand einen Polstersessel auf mich geworfen, als ich im Bett lag und ihm den ehelichen Verkehr verweigerte. Sonst kam es zu keinen Misshandlungen an mir oder meinem Sohn. Mein geschiedener Ehemann hängt sehr an unserem Sohn. Er hat, nachdem wir bereits geschieden waren, Dietmar am Morgen vor dem Haus abgepasst und ist mit ihm spazieren gegangen. Ich habe daraufhin die Schulleitung schriftlich gebeten, auf meinen Sohn aufzupassen und ihn nicht auf Ersuchen meines geschiedenen geisteskranken Mannes vom Unterricht freizustellen.
Sonst kann ich eigentlich nichts sagen. Mein geschiedener Ehemann hat außer seiner Cousine Rosl Hübner keine Angehörigen in Zittau. Alle seine Verwandten, darunter sein Bruder Josef Morche, leben in Westdeutschland.«
Montag, 25. September
Oberleutnant der K Strengeld und Kriminalmeister Steppan suchen am Vormittag Irma Gröne in ihrer Wohnung in Olbersdorf auf. Die Leiterin der dortigen HO-Gaststätte Volksbad arbeitete 1950 als Kuchenverkäuferin im »Dreiländereck«. Sie ist, wie die beiden Zittauer Kriminalisten erstaunt hören, damals von der Kriminalpolizei nicht vernommen oder befragt worden. Sie kennt auch keine der vier Damenhandtaschen. Selbst beim Foto von Anni Hölzel zögert sie. Sie habe ihre Kollegin »anders in Erinnerung«.
Zum Mordfall selbst steuert sie ein interessantes Detail bei: Wegen der warmen Witterung wären die Gaststätten-Angestellten in ihrer leichten Dienstbekleidung nach Hause gegangen. »Es ist damals erzählt worden, dass der vermutliche Täter aufgrund des HO-Kittels, den Kollegin Hölzel trug, angenommen haben könnte, dass sie die Einnahmen noch bei sich hat und er sie deshalb ermordete.« Ob sie aber auch das Haarhäubchen noch getragen habe, vermag sie nicht zu erinnern. Allerdings glaube sie das nicht, denn das habe man immer als Erstes abgelegt.
Und niemand von ihnen wäre als Straßenverkäuferin mit einem Bauchladen unterwegs gewesen, zu keiner Zeit, beteuert Irma Gröne.
Alle weiteren Angaben – zu den Dienstzeiten, zum Schichtbetrieb, zu Hölzels kurzzeitigem Schichttausch etc. – decken sich mit den bisherigen Feststellungen. Die beiden Kriminalisten erfahren nichts Neues. Auch hinsichtlich der Charakterisierung des Mordopfers bleibt es beim Bekannten.
»Mit Frau Hölzel war immer ein gutes Auskommen. Sie war eine nette, eine sympathische Kollegin. Sie war sehr redegewandt, und ich wüsste nicht, dass sie unter den damaligen Kolleginnen und Kollegen Feinde gehabt hätte. Ich kann mich nicht erinnern, dass damals unter verschiedenen Kollegen und Kolleginnen der HOG Dreiländereck unmoralische Beziehungen bestanden haben.«
Читать дальше