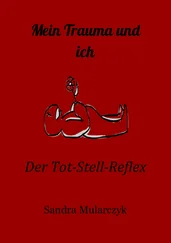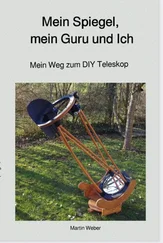Am nächsten Tag bekam meine Mutter einen Anruf von Professor D. Er bat uns, meine Mutter und mich, zu einem Gespräch in seine Praxis. Noch am selben Tag sollte das Gespräch stattfinden. Meine Mutter rief mich an.
»Professor D. hat mich angerufen. Er möchte sich mit mir und dir unterhalten. Heute Nachmittag sollen wir zu ihm kommen. Ich bin fix und fertig. Was will er von uns? Garantiert ist etwas Schlimmes passiert.«
»Moment mal. Das weißt du doch gar nicht. Was hat der Professor dir denn gesagt? Ist ein Problem während der Operation aufgetreten? Ist jetzt in der Nachbehandlung etwas eingetreten, was nicht vorhersehbar war? Überlege mal, was genau hat er dir gesagt?«
»Er rief an. Er sagte, dass die Operation gut verlaufen war. Jetzt würde er sich gerne mit uns darüber unterhalten.«
»Also, wie kommst du dann gleich auf das Schlimmste? Nach der Operation war er ein paar Tage auf einem Meeting. Zeit mit uns zu sprechen gab es noch nicht. Vielleicht ist das ganz normal. Wann sollen wir denn bei ihm sein?«
Ich wusste nicht genau, ob ich meine Mutter mit meinen Worten erreichen konnte. Viel mehr verspürte ich eine Ungewissheit in mir. Hatte sie mich mit ihren Worten der Angst mehr erreicht als ich sie mit meinen? Um was würde es in dem Gespräch mit Professor D. gehen? War es der normale Prozess nach einer OP? Wie sollte ich mich darauf vorbereiten? Die Ungewissheit ließ mich nicht mehr los. Ich holte meine Mutter pünktlich ab. Sie war aufgeregt und hätte am liebsten laut geweint. Ich wiederholte meine Worte aus unserem Telefongespräch. Andere wären mir auch nicht eingefallen. Wir betraten die Praxis, meldeten uns am Empfang und warteten bis uns der Professor abholte. Er begrüßte uns freundlich und bat uns ihm zu folgen. Voller Erwartung taten wir das. In seinem Zimmer nahmen wir Platz. Er schloss die Tür und setzte ich zu uns.
»Schön, dass unser Termin so kurzfristig möglich war. Möchten Sie etwas trinken?«
Meine Mutter und ich verneinten. Die Augen meiner Mutter klebten an ihm, folgten jeder Bewegung. Ungeduld zeichnete ihr Gesicht.
»Bitte sagen Sie uns, was los ist. Welches Problem ist aufgetreten?«
Ihre Aufregung war bei diesen Worten zu spüren.
»Wie ich Ihnen schon sagte, verlief die Operation bestens. Die Prostata Ihres Mannes war sehr verengt. Grosse Ablagerungen hatten sich gebildet. Wir mussten ein bisschen mehr abschälen als zuvor befunden. Durch die Prostata verläuft die Harnröhre. In diesem Teil der Harnröhre haben wir einen Knoten festgestellt. Nach den Untersuchungen ergab sich für uns ein abgeschlossenes Karzinom. Die Besonderheit daran ist, es ist sehr aggressiv, schnellwuchernd und bösartig.«
Karzinom und bösartig. Das waren die Worte, welche weder meine Mutter noch ich hören wollten. Mit allem hätten wir gerechnet, damit nicht. Keine, auch noch so kleine Schwingung in unseren Gedanken, wäre in diese Richtung gegangen. Mein Vater hat Krebs. Dieses Wort raste durch meinen Kopf. Und manifestierte sich irrsinnig tief in meinem Inneren. Meine Mutter saß neben mir mit einem Blick voller »Das kann nicht sein« schaute sie Professor D. an. Sie schüttelte ihren Kopf als wollte sie die Worte noch einmal sortieren, die eben zu ihr kamen.
»Sie müssen sich irren. Mein Mann ist wegen seiner Prostata hier und operiert worden.«
Tränen stiegen in ihre Augen. Ihr Gesichtsausdruck wechselte in Fassungslosigkeit. Ihr Blick war voller Hoffnung mit dem Schatten der Hilflosigkeit. Beide schauten wir zu Professor D.
»Nein, es tut mir leid. Ihr Mann hat Krebs. Diese Art des Krebses ist relativ unbekannt. Über wenig Kenntnis verfügt die Medizin darin. Wie gesagt, es handelt sich um eine sehr aggressive, schnellwuchernde und bösartige Art. Es tut mir leid, Ihr Mann hat Krebs.«
Meine Mutter konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie ließ ihrer Betroffenheit freien Lauf. So, wie in diesem Moment habe ich sie bis zu diesem Tag lediglich nur einmal erlebt. Aufgelöst in Tränen der Bestürzung und Verzweiflung saß sie da. Dies war vor knapp 20 Jahren. Damals kamen meine Eltern nachts aus dem Krankenhaus zurück und kämpften mit dem, was ihnen der Arzt nur kurz zuvor mitgeteilt hatte. Mein Bruder war in dieser Nacht verstorben. Sah sie sich nun wieder konfrontiert mit dem Verlust eines Menschen? Überging sie das, was uns Professor D. eben sagte und sah sie schon in diesem Moment die Letztendlichkeit dieser Krankheit? Ihre Augen fokussierten mich. Die Tränen liefen auf Ihren Wangen herunter.
»Warum muss das sein? Dein Vater ist ein so liebevoller Mensch. Er hat noch nie etwas Böses getan. Alle kommen so gut mit ihm aus. Wieso muss er das haben?«
»Mutter, darum geht es nicht. Was du als »das« bezeichnest, heißt Krebs. Es ist eine Krankheit. Mein Vater, Dein Mann hat Krebs. Jetzt müssen wir sehen, was wir tun können. Die Frage nach der Gerechtigkeit wird dir keiner beantworten. Bei einer Krankheit sollte diese Frage sowieso nicht gestellt werden«
Sie schüttelte den Kopf. Ihre Verzweiflung schwächte sie.
»Dein Vater, mein Ehemann wird sterben. Muss ich denn schon wieder einen Menschen verlieren? Womit habe ich das verdient?«
»Du denkst bereits jetzt über seinen Tod nach. Jetzt schon betreibst du Trauerarbeit. Du, wir haben noch nichts verloren. Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Du hast das Recht zu weinen. Du sollst weinen, das ist gut. Trauern brauchst du noch nicht. Erst müssen wir sehen, was wir tun können. Wenn es irgendwann soweit ist, dass der Vater sterben wird, dann kannst du trauern. Nicht nur du, alle werden wir dann trauern. Doch jetzt ist effektiv nicht die richtige Zeit.«
Professor D. schaute mich voller Bewunderung an. Was genau hatte ich gesagt, was ihn dies tun ließ? Hatte ich etwas Falsches aufgenommen oder wiedergegeben? War es mir nicht selbst zum weinen. Am liebsten hätte ich laut geschrieen? Meinen Tränen freien Lauf gelassen.
»Ihr Sohn hat Recht. Momentan überwältigt Sie das alles. Es ist nicht einfach einen Befund wie diesen zu bekommen. Sie müssen es annehmen. Nachdem wir das Karzinom gefunden haben, müssen wir überlegen, welche die richtige Behandlung ist. Die Art dieses Krebses ist recht selten. Viele medizinische Erkenntnisse darüber gibt es leider noch nicht. Was allerdings nicht heißt, dass wir gar nichts tun können. Mit Ihrem Mann habe ich bereits gesprochen. Ich denke, Sie sollten jetzt zu ihm gehen und wir sehen uns die nächsten Tage um alles weitere zu besprechen. Seinen Aufenthalt werde ich um zwei Tage verlängern. Diese Zeit benötigen wir, um noch eine weitere Untersuchung vorzunehmen.«
Meine Mutter schaute zu Boden. Sie schüttelte ihren Kopf. Diesen Gedanken wollte sie einfach wieder loswerden. Was ging in diesem Moment in ihr vor? Professor D. verabschiedete uns. Sein Blick war verständnisvoll und empfindend zugleich. Wir standen am Aufzug und warteten bis er kam. Noch nie war mir das Warten so lange vorgekommen wie in diesem Moment. Meine Mutter war absolut in sich gekehrt. Ich legte meinen Arm um sie.
»Was soll ich nur ohne deinen Vater machen? Wie soll das alles weitergehen?«
»Diese Gedanken brauchst du dir jetzt noch nicht machen. Wir müssen erst einmal sehen, was Professor D. an Behandlungsmethoden aufzeigen kann. Die Medizin ist heute schon recht weit auf dem Gebiet des Krebses. Ich gehe davon aus, dass er einen Weg, eine Behandlung finden wird. Mache dir jetzt nicht zu viele Gedanken.«
»Dieser Krebs ist selten, hat er gesagt. Was soll er da an Möglichkeiten finden?«
»Diese Form des Krebses ist selten, das ist richtig. Darüber hinaus aggressiv und schnellwachsend. Vom Grundsatz ist es aber Krebs. Das heißt, es kann keine Symptombehandlung geben. Es muss an der Basis etwas getan werden. Weder du noch ich verfügen über ein umfassendes Wissen in diesem Thema. Wir müssen uns auf das verlassen, was uns die Ärzte sagen. Wenn wir jetzt zum Vater kommen, schauen wir erst einmal, was er sagt, und wie er reagiert.«
Читать дальше