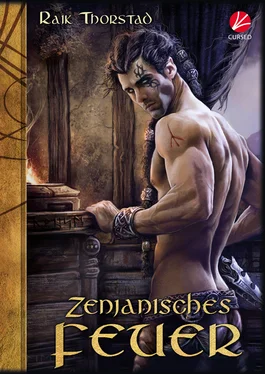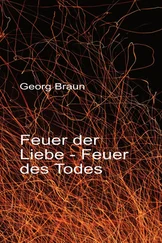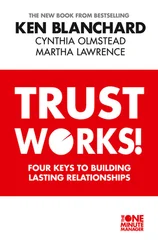»Ich habe nicht vor, es zur Gewohnheit werden zu lassen.«
Theasa stieß einen angewiderten Laut aus und zog ihren Umhang enger um sich. Eine Weile schien es, als hätte sie nichts mehr zu sagen, doch dann richtete sie erneut das Wort an ihn. »Und? Wie geht es ihm nun?«
Es war eine schlichte Frage, aber so bedeutungsvoll, dass Sothorn sich mit der Antwort Zeit ließ. »Er hat noch geschlafen, als ich aufgestanden bin«, begann er vorsichtig. »Und ich kann und will nicht für ihn sprechen…«
»Das würde dir auch nicht bekommen!«, unterbrach ihn Theasa und warf ihm erstmalig einen Seitenblick zu. Kurz lachten sie gemeinsam auf.
»Es hat ihm viel bedeutet«, sagte Sothorn schließlich. »Sowohl das Ritual selbst als auch die Tatsache, dass wir es ihm ermöglicht haben. Doch ich weiß nicht genug über diese Riten, um vorherzusagen, inwieweit sie…« Er geriet ins Stocken. Inwieweit sie ihn verändern werden, hatte er sagen wollen, aber das erschien ihm gefährlich. Nach einer solchen Bemerkung stünde die Frage im Raum, ob und wenn ja, welche Veränderungen er sich erhoffte. Dabei war er sich darüber selbst nicht im Klaren und nicht einmal sicher, ob er überhaupt ein Recht auf solcherlei Hoffnungen hatte.
Sicher, Geryim war launenhaft und sein Verhalten oftmals schwer nachzuvollziehen, aber wenn man ihm das nahm, wäre er dann überhaupt noch er selbst?
Theasa schien sich nicht mit Gewissensfragen herumzuschlagen. »Es wäre gut, wenn er etwas Frieden finden könnte. Und zwar nicht nur für ihn. Das Leben an Bord…« Sie zog die Nase hoch und spuckte ins Wasser. »Es sind nicht nur die Kinder und Pferde, die allmählich rastlos werden. Und ich kann nicht meine ganze Zeit damit verschwenden, Streitereien zu schlichten oder Wunden zu verbinden.«
Von letzteren gab es immer noch zu viele. Das Inferno in ihrer früheren Heimstatt klebte an ihnen wie der Rauch, der sich in ihren Haaren und wenigen verbliebenen Besitztürmern verfangen hatte. Sothorns Hände waren zu seiner Überraschung längst verheilt, auch wenn seine Haut nun ein paar neue fleckige Schattierungen trug. Varns Schulterverletzung hatte sich ebenfalls recht ordentlich verschlossen, auch wenn das Narbengewebe aufgeworfen war und er noch ab und zu Schmerzen litt. Um Shahims verbranntes Bein stand es weit schlimmer: Es hatte wochenlang geeitert und es war nicht abzusehen, ob er jemals wieder würde rennen oder schleichen können. Auf die übrige Bruderschaft verteilte sich eine Unzahl kleinerer Brandverletzungen und der eine oder andere Knöchel, der während der Flucht in ungünstigem Winkel umgeknickt war. Doch die wahren Wunden lagen unter ihrer Haut und würden Jahre oder auch ein ganzes Leben brauchen, um zu heilen.
Bis dahin hatten sie dringlichere Sorgen.
Vor seinem geistigen Auge sah Sothorn das einsame Fass vor sich, das in einer verschlossenen Kabine der Henkersbraut vor sich hinschaukelte. Am liebsten hätte er dreimal am Tag nachgesehen, wie weit der Füllstand des Zenjanischen Lotus' gesunken war. Die Vorstellung, dass sich das Fass leeren könnte, ohne dass sie Nachschub beschafft hatten, war seine größte Sorge. Er hätte sich dafür geschämt, wenn er nicht gewusst hätte, dass jeder in der Bruderschaft von derselben Angst zerfressen wurde. Das galt sogar für Lilianne und Nouna, die nie dem Handwerk der Assassinen nachgegangen waren, sondern von der Liebe in ihre Reihen gebracht worden waren. Sie fürchteten zu Recht den Gedanken, sich eines Tages inmitten einer Riege halb wahnsinniger Meuchelmörder wiederzufinden, von denen einer nach dem anderen der Raserei verfiel.
»Habt ihr schon eine Entscheidung gefällt?«, erkundigte er sich.
Endlich wandte sich Theasa ihm zu. Ihre geröteten Augen wirkten finster, doch der abrupte Themenwechsel schien sie nicht zu überraschen.
»Von welchem Ihr redest du?«, fuhr sie ihn an. »Ich muss eine Entscheidung fällen und egal, mit wie vielen von euch ich mich bespreche und wie viele Ratschläge ich mir anhöre, am Ende muss ich die Verantwortung allein schultern.«
Sothorn strich sich eine aus dem Zopf gekrochene Strähne hinter das Ohr. Zum zweiten Mal an diesem Morgen stieg Mitgefühl in ihm auf.
Theasa breitete in einer Geste der Hilflosigkeit die Arme aus. »Dass es im Grunde nur einen einzigen gangbaren Weg gibt, macht es kaum besser. Schon gar nicht, wenn ich überlege, wer ihn vorgeschlagen hat.«
Sothorn runzelte die Stirn. Bisher hatte ihn keines von Theasas Worten überrascht – er hörte sie nicht zum ersten Mal –, aber die letzte Bemerkung traf ihn unvorbereitet. »Vertraust du Szaprey nicht?«
Der Roaq war selbst zu seinen besten Zeiten das am schwersten einzuschätzende Mitglied der Bruderschaft – und das, obwohl viele von ihnen zur Geheimniskrämerei neigten und Geryim stets für einen unerwarteten Wutausbruch gut war. Dass Szaprey einer anderen Art entsprang und weder innerlich noch äußerlich mit einem Menschen zu vergleichen war, war der Nährboden zahlloser Missverständnisse. Trotzdem war es erst wenige Monate her, dass er ihnen seine Treue nachdrücklich bewiesen hatte. Ohne ihn und die alchemistische Erfindung, die er inzwischen Rauchatem getauft hatte, wäre heute keiner von ihnen mehr am Leben.
Ein Anflug von Verlegenheit breitete sich auf Theasas groben Züge aus, ließ die Macht ihrer Stellung weichen und sie um fünf Jahre jünger wirken. »Doch. Es ist nur eine Frage der…« Sie knirschte mit den Zähnen. »Er ist so schwer zu lesen. Seine Augen, seine… Schnauze. Sie sind wie eine Maske und von Masken habe ich ein für allemal genug.«
Sothorn wusste, worauf sie hinauswollte. Keiner von ihnen sprach jemals über Enes. Das Entsetzen über dessen Verrat reichte zu tief. Ranaia und ihren kleinen Sohn konnten sie betrauern und in ihren Geschichten lebendig halten, ohne dass ihnen widersprüchliche Gefühle in den Weg gerieten. Doch Enes würde für sie immer derjenige sein, der sie betrogen und in die Heimatlosigkeit gestürzt hatte.
Und ja, in dieser Hinsicht verstand Sothorn Theasa: Auch er ertappte sich dabei, dass er öfter als früher über die Schulter schaute und sich fragte, ob er den verbliebenen Brüdern und Schwestern nicht etwas mehr Misstrauen entgegenbringen sollte. Für Theasa, die über das Wohl so vieler Menschen entscheiden sollte, musste es noch schlimmer sein.
»Bitte reiß mir nicht gleich den Kopf ab, aber hat Janis denn gar nichts dazu zu sagen?«, fragte Sothorn entgegen aller Hoffnung.
Theasa legte den Kopf weit in den Nacken, als stünden die Antworten auf ihre Fragen in den Winterhimmel geschrieben. »Kein Wort. Es kümmert ihn nicht. Ob wir nach Norden oder Süden segeln oder gleich absaufen, für ihn hat es keine Bewandtnis mehr.«
Sothorn hätte ihr gern widersprochen. Es nicht zu tun, war, als würde er in eine offene Klinge greifen. Tatsächlich glaubte er nicht, dass es Janis nicht länger scherte, was aus seiner geliebten Bruderschaft wurde. Doch der hünenhafte Mann, der Sothorn vor nicht einmal einem Jahr mit ruhiger Stimme die Regeln ihrer Gemeinschaft erklärt hatte, war nicht mehr bei ihnen. Stattdessen gab es nur noch diesen in sich zusammengefallenen Greis, der stundenlang an die Wand seiner Kabine starrte und nur dann etwas aß, wenn man ihm Becher und Teller in die Hände schob. Wohin sich sein Geist auch geflüchtet hatte, er fand den Rückweg nicht.
Sothorn ging in die Hocke, um einen der runden Kieselsteine zu seinen Füßen aufzulesen. »Weißt du, ich finde…«, setzte er an, doch dann rührte sich etwas in seinem Hinterkopf und lenkte ihn ab.
Bewegung und Aufregung blitzten in seinem Geist auf, dicht gefolgt von Enttäuschung und einem so übermächtigen Reißen, dass es sich nur um Hunger handeln konnte. Instinktiv erwiderte er den Schwall fremder Eindrücke mit dem Bild eines saftigen Stücks Hirsch, das er sowohl vor dem gestrigen Festmahl als auch vor den Hunden gerettet hatte. Die Antwort bestand aus Dankbarkeit, Zuneigung und dem Versprechen, bald aufeinanderzutreffen.
Читать дальше