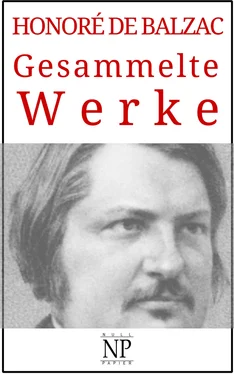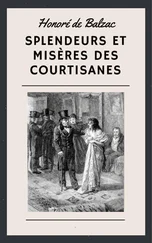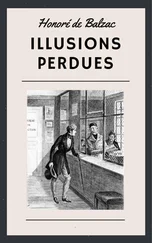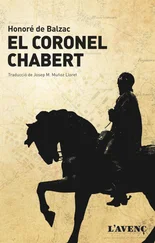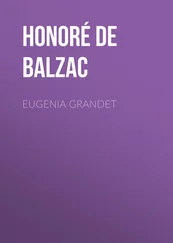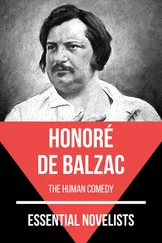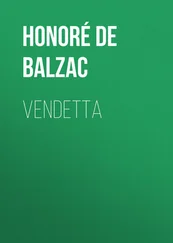Der Richter bemerkte jetzt in der Tat die hübsche Gräfin auf der Erde zwischen den Beinen Genovefas sitzend; die mit einem riesigen knöchernen Kamm bewaffnete Bäuerin wendete viel Sorgsamkeit darauf, das lange schwarze Haar Stephanies durchzukämmen, die sich das gefallen ließ, indem sie erstickte Schreie von sich gab, deren Akzent ein instinktiv empfundenes Behagen verriet. Herr d’Albon erschauerte, als er die Hingebung des Körpers und die tierische Haltlosigkeit bemerkte, die bei der Gräfin die vollkommene Abwesenheit des Geistes verriet.
»Philipp, Philipp!« rief er aus, »das vergangene Unglück bedeutet ja noch nichts. Gibt es denn keine Hoffnung mehr?«, fragte er.
Der alte Arzt hob die Augen zum Himmel empor.
»Adieu, mein Herr«, sagte Herr d’Albon und drückte dem Alten die Hand. »Mein Freund erwartet mich, Sie werden ihn bald sehen.«
»Also sie ist es doch!« rief Sucy aus, nachdem er die ersten Worte des Marquis d’Albon gehört hatte.
»Ach, ich zweifelte noch daran«, fügte er hinzu und ließ einige Tränen aus seinen dunklen Augen herabfallen, deren Ausdruck ungewöhnlich ernst war.
»Ja, es ist die Gräfin von Vandières«, antwortete der Richter.
Der Oberst erhob sich jäh und kleidete sich eilig an.
»Aber Philipp!« sagte der Richter verblüfft, »wirst du verrückt?«
»Aber ich bin ja nicht mehr krank«, antwortete der Oberst einfach. »Diese Nachricht hat alle meine Schmerzen beruhigt. Und was für ein Unglück könnte ich empfinden, wenn ich an Stephanie denke. Ich gehe nach Bons-Hommes, sie sehen, mit ihr sprechen, sie heilen. Sie ist frei. Schön! Das Glück wird uns lächeln, oder es gäbe keine Vorsehung mehr. Glaubst du denn, daß diese arme Frau mich anhören könnte, ohne ihren Verstand wieder zu gewinnen?«
»Sie hat dich schon gesehen, ohne dich wiederzuerkennen«, entgegnete sanft der Richter, der, als er die übertriebene Hoffnung seines Freundes wahrnahm, versuchte, ihm heilsamen Zweifel einzuflößen. Der Oberst erzitterte. Aber er begann zu lächeln und ließ sich eine leichte Bewegung der Ungläubigkeit entschlüpfen. Niemand wagte es, dem Plan des Obersten sich zu widersetzen. Nach wenigen Stunden befand er sich in der alten Priorei bei dem Arzte und der Gräfin von Vandières.
»Wo ist sie?« rief er aus, als er ankam.
»Still!« antwortete ihm Stephanies Onkel. »Sie schläft. Dort ist sie.«
Philipp sah die arme Irre in der Sonne auf einer Bank niedergehockt. Ihr Kopf war gegen die Hitze der Luft durch einen Wald verwirrter Haare auf ihrem Gesicht geschützt; ihre Arme hingen graziös bis auf die Erde hinab; ihr Körper lag in reizvoller Stellung wie der einer Hirschkuh; ihre Füße waren ohne Mühe unter ihr zusammengebogen; ihr Busen hob sich in regelmäßigen Intervallen; ihre Haut, ihr Teint wies die Porzellanblässe, die wir so sehr auf den Gesichtern von Kindern bewundern. Unbeweglich neben ihr stehend, in der Hand einen Zweig, den Stephanie zweifellos von dem höchsten Wipfel eines Pappelbaums abgepflückt hatte, bewegte die Idiotin sanft die Blätter über ihrer eingeschlafenen Gefährtin, um die Fliegen zu verjagen und die Luft zu erfrischen. Die Bäuerin betrachtete Herrn Fanjat und den Obersten; dann, wie ein Tier, das seinen Herrn erkannt hat, wandte sie langsam den Kopf der Gräfin zu und fuhr fort, über ihr zu wachen, ohne das geringste Zeichen von Erstaunen oder Verständnis zu geben. Die Luft war glühend. Die Steinbank schien zu funkeln, und die Wiese strahlte dem Himmel diese ruhelosen Düfte entgegen, die über den Kräutern flimmern und glühen wie ein goldener Staub; aber Genovefa schien die verzehrende Hitze nicht zu spüren. Der Oberst drückte heftig die Hände des Arztes in den seinigen. Aus den Augen des Soldaten rollten Tränen die männlichen Wangen entlang und fielen auf den Rasen zu Stephanies Füßen.
»Mein Herr,« sagte der Onkel, »jetzt sind es zwei Jahre her, daß mir täglich das Herz brechen will. Bald werden Sie so weit sein wie ich. Wenn Sie nicht mehr weinen, so werden Sie Ihren Schmerz nicht um so weniger empfinden.«
»Sie haben für sie gesorgt?« sagte der Oberst, dessen Blicke ebensoviel Dankbarkeit wie Eifersucht ausdrückten.
Die beiden Männer verstanden sich; und indem sie sich von neuem die Hand drückten, blieben sie unbeweglich in der Betrachtung der herrlichen Ruhe, die der Schlaf über dieses entzückende Wesen ausbreitete. Von Zeit zu Zeit stieß Stephanie einen Seufzer aus, und dieser Seufzer, der alle Anzeichen des Gefühls zeigte, ließ den unglücklichen Obersten vor Freude erzittern.
»Ach,« sagte Herr Fanjat leise zu ihm, »täuschen Sie sich nicht, mein Herr, Sie sehen sie jetzt bei voller Vernunft.«
Wer je voller Entzücken damit beschäftigt war, ganze Stunden lang eine zärtlich geliebte Person schlafen zu sehen, deren Augen im Schlafe lächeln müßten, wird zweifellos das süße und furchtbare Gefühl begreifen, das den Obersten bewegte. Für ihn war der Schlaf eine Vorspiegelung; das Erwachen mußte für ihn den Tod bedeuten, und zwar den schrecklichsten aller Tode. Plötzlich lief eine junge Ziege in drei Sprüngen auf die Bank zu und witterte Stephanie, welche das Geräusch erweckte; sie richtete sich leicht auf den Füßen auf, ohne daß diese Bewegung das launische Tier erschreckte; aber als sie Philipp bemerkte, floh sie, von ihrem vierfüßigen Gefährten gefolgt, bis zu einer Hollunderhecke; dann ließ sie einen kleinen wilden Vogelschrei hören, den der Oberst nahe beim Gitter schon gehört hatte, wo die Gräfin Herrn d’Albon zum erstenmal erschienen war. Schließlich kletterte sie auf einen wilden Ebenholzbaum, hockte sich in dem grünen Gipfel dieses Baumes fest und fing an, den »Unbekannten« mit der Neugier der Nachtigallen des Waldes zu betrachten.
»Adieu, adieu, adieu!« sagte sie, ohne daß ihre Seele diesem Worte eine Betonung verlieh.
Es war die Gleichgültigkeit eines in der Luft singenden Vogels.
»Sie erkennt mich nicht mehr! rief der verzweifelte Oberst. »Stephanie! Das ist ja Philipp, dein Philipp, Philipp!«
Und der arme Soldat sprang auf den Baum zu; aber als er drei Schritt von ihm entfernt war, sah ihn die Gräfin an, wie um ihm zu trotzen, obwohl ein furchtsamer Ausdruck in ihrem Auge erschien; dann rettete sie sich von dem Ebenholzbaum auf eine Akazie, und von da auf eine nordische Tanne, wo sie sich von Zweig zu Zweig mit unerhörter Leichtigkeit wiegte.
»Verfolgen Sie sie nicht«, sagte Herr Fanjat zu dem Obersten. »Sie könnten zwischen ihr und sich einen unüberwindlichen Zwiespalt aufrichten; ich werde Ihnen helfen, sie kennenzulernen und sie zu zähmen. Kommen Sie auf diese Bank hier. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nicht auf diese arme Irre richten, dann werden Sie sie bald unmerklich näher kommen sehen, um Sie zu prüfen.«
Читать дальше