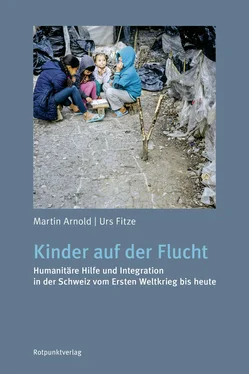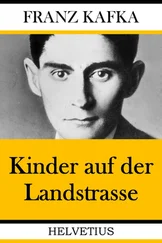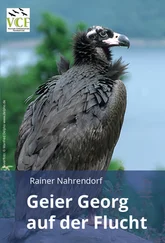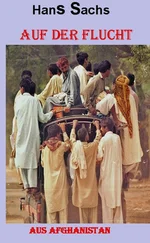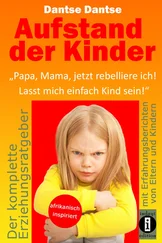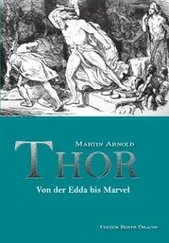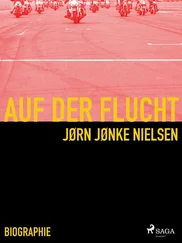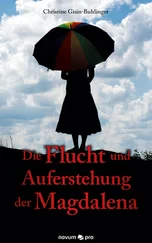Bis Ende Dezember 1942 steigt die Zahl der Geflüchteten in der Schweiz auf 16’200, von denen mehr als die Hälfte zwischen dem 1. August und dem 31. Dezember 1942 eingereist sind. Die Grenzschließung lässt sich nicht vollständig durchsetzen. Die Weisungen werden am 29. Dezember deshalb wieder verschärft. Neu gilt ein Gebietsstreifen von zehn bis zwölf Kilometern als »Grenzgegend«, aus dem Geflüchtete von den Grenzorganen »zurückzuweisen« seien.
Hugo Remund, seit 1941 Chefarzt des SRK, setzt ab 1942 eine neue Doktrin des Bundesrats um, wonach die Arbeit der privaten, von mehreren Hilfswerken getragenen »Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für kriegsgeschädigte Kinder« zur Staatsaufgabe werden soll. Gleichzeitig will die Regierung sich mit den fremden Federn des 1940 gegründeten Hilfswerks schmücken, das seit Kriegsausbruch mit großem Engagement in Vichy-Frankreich mehrere Flüchtlingsheime, unter ihnen auch Schloss de la Hille, betreibt. Rösli Näf leitet das Heim seit Mai 1941. Es kommt, von Remund orchestriert, am 1. Januar 1942 zur Fusion zum »Schweizerischen Roten Kreuz, Kinderhilfe«. Remund wie Haller achten peinlichst genau darauf, dass dieses Liebeswerk im engen Rahmen der bundesrätlichen Vorgaben bleibt, die die Staatsräson vor die Mitmenschlichkeit stellen.
Heimleiterin Rösli Näf, die 1989 für ihren Mut und ihre Menschlichkeit als eine von 46 Schweizerinnen und Schweizern mit einem Eintrag auf der israelischen »Liste der Gerechten unter Völkern« geehrt wird, kostet der Vorfall um die Gruppe mit Inge Joseph ihre Stelle in Frankreich. Ein missliebiger Kollege denunziert sie und tritt damit eine Untersuchungslawine los, die schließlich zu ihrer Versetzung in die Schweiz im Mai 1943 führt. Nach dem Krieg zieht sie, enttäuscht von der Schweizer Flüchtlingspolitik, nach Dänemark und kehrt erst im Pensionsalter in die Schweiz zurück. In einem unterwürfigen Brief, einem erschütternden Dokument mangelnder Zivilcourage, entschuldigt sich Hugo Remund, Chefarzt des Schweizerischen Roten Kreuzes, beim längst gleichgeschalteten Deutschen Roten Kreuz für den Vorfall, obwohl er weiß, dass dieser selbst von den französischen und deutschen Grenzbehörden unter den Teppich gekehrt worden war. »Es liegt mir daran, Sie von der peinlichen Lage in Kenntnis zu setzen, in der sich das Schweiz. Rote Kreuz durch die unangebrachte Initiative der Leiterin dieses Heims versetzt fühlt. Ich glaube, dass ich Ihnen nicht zu versichern brauche, dass die infrage stehenden Personen entgegen den Weisungen, welche sie vom Schweiz. Roten Kreuz erhalten hatten, gehandelt haben und dass das Schweiz. Rote Kreuz sich von der Handlungsweise der oben genannten Person völlig distanziert.«
In Château de la Hille geht das Leben 1943 für die verbliebenen Kinder und Jugendlichen unter immer schwierigeren Bedingungen weiter. Jederzeit ist mit neuen Deportationen zu rechnen. Einige der Jugendlichen sind in der Umgebung untergebracht, auf dem Schloss hat man ein mündliches Alarmsystem abgesprochen, für den Notfall wird ein Versteck im Zwiebelkeller vorbereitet. Walter Strauss, der kurz zuvor seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, wird trotz dieser Vorkehrungen zusammen mit vier weiteren Jugendlichen am 14. Februar nach einem hinterlistigen Täuschungsmanöver französischer Polizisten festgenommen und in ein Deportationslager gebracht. Ein Brief erreicht eine Woche später Inge Joseph, vermutlich aus einem Deportationszug geworfen. Er sei im Frieden mit sich selbst, seit er entschieden habe, »zu bleiben«. Ein zweiter Brief kommt Ende Mai 1943 aus dem Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek bei Lublin in Polen. Es ist Walters letzte Nachricht: Er sei bei »bester Gesundheit«. Inge, die Walter gut kennt, geht davon aus, dass er, um den Brief durch die Zensur zu bringen, das eine geschrieben hat – aber das andere meint. Später erfährt sie von einer Schweizer Rotkreuz-Helferin, er habe ihr Angebot, die Gruppe in Rotkreuz-Kleidung aus dem Lager zu schleusen, abgelehnt. Er werde nicht nochmals das Leben anderer riskieren. Inge Joseph, die durch das Fenster der Freiheit geschritten ist, wird ihren Freund, der dieses Fenster geschlossen hat, nie wiedersehen.
Inge Joseph kann im Frühjahr 1943 mit gefälschten Papieren bei einer Familie in Toulouse untertauchen. Im Herbst 1943 wagt sie mit Unterstützung von Rotkreuz-Helferinnen einen neuen Fluchtversuch in die Schweiz. Diesmal ist sie allein und gut instruiert. Sie schafft es über die Grenze und, geführt von einem Fluchthelfer, über die Grenzzone hinaus. Inge ist gerettet. Beinahe. Denn nach wie vor gilt die Direktive, jüdischen Geflüchteten grundsätzlich die Aufnahme zu verwehren. Und Inge ist inzwischen 18-jährig. Damit gilt eine am 14. Juli 1943 eingeführte Lockerung, dass jüdische Mädchen bis zum 18. Lebensjahr aufgenommen werden, nicht mehr. Sechs Wochen noch, so empfehlen es ihr ihre Helfer, müsse sie sich versteckt halten. Inge verbringt einige friedvolle Wochen auf einem Bergbauernhof in Hohfluh im Berner Oberland. Danach hat sie nichts mehr zu befürchten. Sie wird offiziell registriert. Ein dauerndes Bleiberecht hat sie, wie alle Geflüchtete in der Schweiz, nicht. Sie kommt auf einem Bauernhof in Gampelen unter. Kurz darauf konvertiert sie, auf Bitte ihrer Retterin und voller Dankbarkeit, zum lutheranischen Protestantismus und wird konfirmiert. Auf allen Papieren, die sie später ausfüllt, gibt sie an, sie sei Jüdin. Nur den Christbaum wird sie zeit ihres Lebens an Weihnachten schmücken. Doch der Glaube bedeutet ihr nichts, weil er ihr nichts bietet, vor allem keine Erklärung für all den Schrecken, den sie erfahren hat.
In den Wirren der letzten Kriegstage weichen Zehntausende in die Schweiz aus, um den Kämpfen und dem wachsenden Chaos zu entgehen. Sie bleiben meist nur wenige Tage und kehren zurück, sobald es die Lage erlaubt. Die offizielle Schweiz unterstützt sie in einer Großzügigkeit und mit einem Mitgefühl, die man sich in den Jahren zuvor gewünscht hätte. Das Image des sich seiner humanitären Tradition rühmenden Landes ist vor allem bei den alliierten Siegermächten arg ramponiert. 1944, nach der Befreiung Frankreichs, waren die kritischen Stimmen von zurückkehrenden Geflüchteten über ihre Behandlung in der Schweiz nicht mehr zu überhören gewesen. Schon im Dezember 1943 hatte Ständerat Ernst Speiser in einem Brief an den Bundesrat die Schaffung einer überparteilichen und gesamtschweizerischen Aktion zur Nachkriegshilfe angeregt. Diese sei eine »menschliche und moralische Verpflichtung«. Bundesrat Marcel Pilet-Golaz antwortete umgehend: »Das Problem, das Sie beschäftigt, ist außerordentlich komplex, zugleich politischer, wirtschaftlicher, finanzieller und humanitärer Art.« Er solle doch persönlich bei ihm vorbeikommen. In den folgenden Monaten reift in zahlreichen Sitzungen und Besprechungen nach und nach das Projekt der »Schweizer Spende an die Kriegsgeschädigten«, die »einzig Ausdruck der Menschlichkeit« sein soll »und nicht das Ziel verfolgt, aus der Beteiligung am Wiederaufbau Europas materiellen Nutzen zu ziehen«. 200 Millionen Franken sollen dafür von Bevölkerung und Bund gemeinsam aufgebracht werden. Es ist eine enorme Summe, die rund einen Drittel der geplanten Ausgaben des Bundes für das Jahr 1945 ausmacht. Sie entspricht heute rund einer Milliarde Franken und damit in etwa der Kohäsionsmilliarde, die die Schweiz den zehn neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in den Jahren 2007 bis 2018 als »Erweiterungsbeitrag« leistete. Mit einer professionellen Werbekampagne, in die Medien, Hilfswerke und Künstler eingebunden sind, gelingt es, unter dem Slogan »Unser Volk will danken« in nur zwei Monaten 50 Millionen Franken zu sammeln. Zu Kriegsende ist der finanzielle Topf prall gefüllt. Schon in den letzten Monaten ist in den ersten befreiten Gebieten in Frankreich, Belgien und den Niederlanden erste Nothilfe geleistet worden. Die Schweizer Spende ist eine Wiedergutmachung und eine wohlmeinende Geste gegenüber den Alliierten, ohne dass dies je direkt angesprochen worden wäre. So ließ es sich, wie im Vorwort des 1949 erschienen Tätigkeitsberichts der Schweizer Spende, von »der Natur unseres Volkes« schwärmen, »dass wir als unbeteiligte Dritte versuchten, zu helfen, zu lindern und zu retten«.
Читать дальше