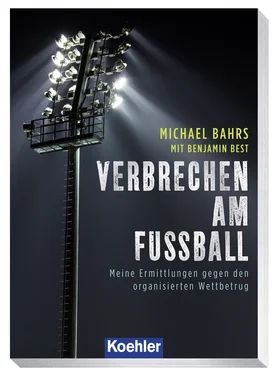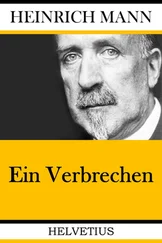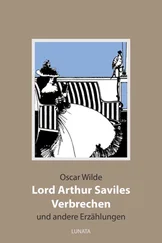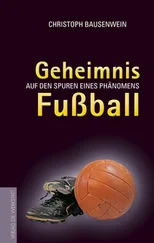Den Befund des Augenarztes schickte ich zum zuständigen Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP). Nach einigen Wochen wurde ich erneut eingeladen. Wieder der gleiche Sehtest, wieder mit Polizeisanitätern, wieder das gleiche Ergebnis: nicht bestanden. Ich wies auf die Diagnose und das Schreiben meines Augenarztes hin und bekam die Antwort: »Wir wissen ja nicht, wie gut du deinen Augenarzt kennst.« Die schickten mich also wieder eiskalt nach Hause. Ich fühlte mich ungerecht behandelt, weil alles mit einer Lüge angefangen hatte.
Nachdem mein Traum von einer Laufbahn im Polizeidienst offenkundig gescheitert war, stellte sich die Frage: Was sollte ich nun machen? Ich bewarb mich wahllos für irgendwelche kaufmännischen Berufsausbildungen. Außerdem fuhr ich mit meinem Vater zur Uniklinik. Dort ließen wir uns ein kostenpflichtiges Gutachten eines Professors erstellen, Kostenpunkt: 250 Mark. Der kam zu dem Ergebnis, dass ich die Voraussetzungen für den Polizeidienst erfüllte – und zwar um Längen über den üblichen Rahmen hinaus.
Dieses Gutachten schickte ich wieder nach Münster, wurde erneut eingeladen – und mit der gleichen »Diagnose« erneut abgewiesen. Selbst das Gutachten eines Professors reichte den Sanitätern nicht aus.
Ich war am Boden zerstört. Wieder wurde ich angelogen, wieder betrogen. Ein junger Mann, der voller Idealismus steckte und Polizist werden wollte. Und den betrügen ausgerechnet seine Vorbilder, die Hüter von Recht und Gesetz.
Inzwischen hatte ich eine Lehre als Speditionskaufmann begonnen. Gleichzeitig schrieb ich mit meinem Vater einen Brief an den Innenminister von Nordrhein-Westfalen und schilderte den Sachverhalt. Meine Quintessenz lautete: Es sei sehr traurig und schade, dass in NRW offensichtlich nur Supermänner bei der Polizei angenommen werden.
Nach einiger Zeit bekam ich vom Innenministerium ein Schreiben, ich solle mich bei der Universitätsklinik Münster vorstellen. Deren Ergebnis sei für den Polizeidienst bindend.
Wieder fuhr ich nach Münster, in der Hoffnung, dass es diesmal klappte.
Der Test war sehr langwierig. Die Ärzte durchleuchteten meine Augen regelrecht – und kamen ziemlich schnell zu dem Ergebnis, dass die Typen von den Polizei-Sehtests offenbar selbst einen Sehtest bräuchten. Laut Uni-Klinik waren meine Augen voll polizeitauglich.
Dieses Ergebnis habe ich samt einer Kopie des Schreibens vom Innenministerium an die LAFP Münster geschickt. Und die fragten dann tatsächlich bei mir an: »Waren Sie nicht schon mal hier?«
Ich sprach mit meinem Chef bei der Spedition. Der hatte Verständnis, weil er auch mal Polizist hatte werden wollen und offenbar ähnliche Erfahrungen machen musste. Jedenfalls ließ er mich aus meinem Lehrlingsvertrag raus.
Das ganze Theater hatte etwa zwei Jahre gedauert …
Mein Dienstantritt war im Oktober 1991 in Bochum. Wieder musste ich zum Medizintest. Mir war schon richtig schlecht: Was passiert eigentlich, wenn die dich wieder ablehnen? Den Lehrlingsvertrag bei der Spedition hatte ich ja gekündigt. Ich stünde dann richtig im Regen. Doch diesmal klappte alles. Zwei Wochen später war ich in der Ausbildung zum Polizeibeamten. Dabei lernte ich 1993 meine heutige Frau kennen.
Die Ausbildung dauerte zweieinhalb Jahre. Damals war es in NRW so: Entweder musste man nach Beendigung der Ausbildung zur Rheinschiene, das heißt Sicherung von gefährdeten Objekten im Regierungssitz Bonn/Köln. Oder zum Einsatz in einer Hundertschaft. Ich habe mich für die Rheinschiene entschieden und kam zum Kölner Flughafen. Ich gab mir große Mühe und war sehr eifrig mit Überprüfungen, weil ich mehr machen wollte als nur da herumzustehen.
Also stellte ich gestohlene Fahrzeuge sicher und vollstreckte aufgrund meiner Überprüfungen Haftbefehle. Das führte dazu, dass ich auch in Zivil meinen Dienst machen konnte, außerdem stellte man mir einen konspirativen Bauwagen zur Verfügung. Der stand da, und ich hockte drinnen mit einem Fernglas und konnte Personen überwachen beziehungsweise aufspüren.
Es gab auch grenzüberschreitende Erfolge, zum Beispiel mit Holland. Dabei musste ich das erste Mal erfahren, wie es ist, bei der Polizei gegen den Strom zu schwimmen. Gewöhnlich hat man beim Objektschutz zu funktionieren. Objekt bewachen, fertig! Und wenn man Berufsanfänger war, sowieso. Mir reichte es aber nicht aus, nur zu funktionieren. Und so ein Objekt kann man so oder so überwachen: Entweder ich »überwache« es, indem ich es anstarre, oder ich überwache es und kontrolliere Personen, Fahrzeuge, Taschen usw. Ich wollte mehr. So kam es, dass ich bei den älteren Kollegen einen schweren Stand hatte. Viele der jüngeren Kollegen fanden meine Art gut, trauten sich aber nicht, das auch so anzugehen. Mir waren die anderen egal.
Das ging ein Jahr lang so, ich fuhr jeden Tag mit einer Fahrgemeinschaft von Dortmund nach Köln. Dann wurde ich nach Bochum versetzt, in den sogenannten Wach- und Wechseldienst. Mein Fernziel war es, zum zivilen Einsatztrupp zu kommen, zuständig für den Bereich der Straßenkriminalität – Drogen, Einbrecher, Räuber etc. Ich wollte lieber Verbrecher fangen, als den Verkehr zu kontrollieren. Mein Vater machte das auch. Und siehe da: Nach zweieinhalb Jahren fragte man doch tatsächlich bei mir an, ob ich nicht zum zivilen Einsatztrupp wechseln wollte.
Ich hatte also meinen Ruf als Heißkiste erfolgreich aufgebaut. Vielen Kollegen ging ich durch meine Art, immer etwas bewegen zu wollen, auf die Nerven. Manche wollten sogar nicht mehr mit mir im Streifenwagen fahren. Das war manchmal schon frustrierend, weil ich anders war als die. Und das bekam ich oft genug auch aufs Brot geschmiert.
Ich orientierte mich also an denen, die mit mir auf einer Wellenlänge waren. Zudem hatte ich das Glück, dass mein direkter Vorgesetzter mit mir auf einer Linie war. Dieser Dienstgruppenleiter hatte mein Potenzial erkannt und bestärkte und förderte mich. Ohne solche Leute hat man im Polizeidienst keine Chance. Dann ist es fast unmöglich, Arbeitszufriedenheit zu erzielen. Ich würde sogar behaupten, es macht einen ansonsten krank.
Ich war immer der Jüngste, wo ich auch hinkam. Auch in dieser zivilen Einsatztruppe musste ich mich zurechtfinden. Es war eine homogene Truppe, acht bis zehn Leute. Es ging überwiegend um Drogenkriminalität, um Raubdelikte, Straßenkriminalität, Observationen. Da war es schon wichtig, dass man einen Draht zu Ganoven aufbaut, damit man Tipps bekommt.
Das ging etwa fünf Jahre so, dann wurde eine Stelle im Bereich der Organisierten Kriminalität ausgeschrieben. Das Besondere daran war, dass es bei diesem Job nur um ein Jahr ging. Trotzdem wechselte ich, als die mir sagten, du kannst kommen.
Das war zur damaligen Zeit ein Novum. Ich war kein gelernter Kriminalpolizist, hatte nur die erste Fachprüfung absolviert (die Kollegen von der Kriminalpolizei haben fast alle die zweite Fachprüfung abgelegt) und war zudem noch sehr jung für so einen Job. Deshalb war es auch wie ein Sechser im Lotto, als ich nach diesem einen Jahr gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne, länger zu bleiben. Ich hatte zu der Zeit einen herausragenden Bärenführer, wie man bei der Polizei erfahrene Beamte nennt, die sich junger Kollegen annehmen, zur Seite gestellt bekommen. Durch seine Unterstützung und Fürsprache konnte ich von nun an unbefristet bleiben.
Anfangs waren wir zwölf Leute im Kommissariat 21, wir bearbeiteten Rauschgiftdelikte. Später wurden wir zusammengelegt mit dem Kommissariat 22, das seinerzeit für deliktsübergreifende Organisierte Kriminalität – kurz OK – zuständig war. Darüber hinaus gehöre ich seit 2005 der Mordkommission an. Eine Uniform habe ich zuletzt 1996 getragen.
Mein jetziger Dienstgrad ist Kriminalhauptkommissar (KHK), mehr geht nicht. KHK ist Ende der Fahnenstange, weil ich nur die erste Fachprüfung absolviert habe. Doch ich fühle mich gut aufgehoben, ich möchte nichts anderes machen.
Читать дальше