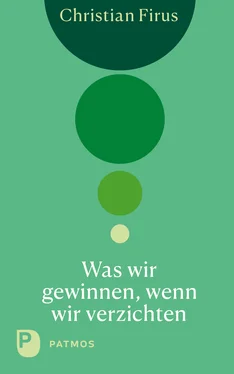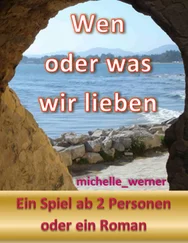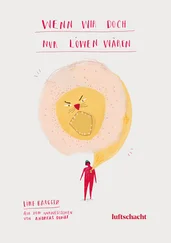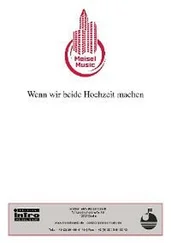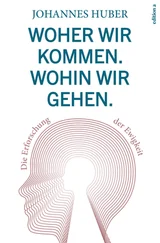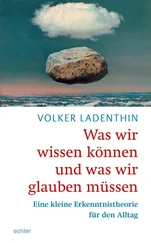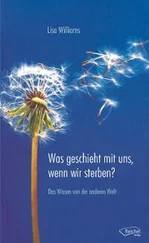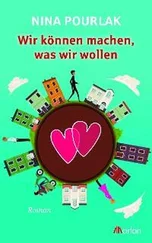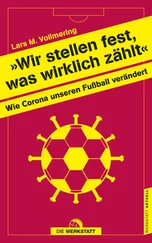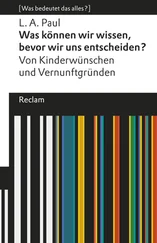Es geht im Leben häufig um die immateriellen Dinge, an denen wir hängen bleiben und die dadurch viel Energie ziehen: alte Kränkungen und Enttäuschungen, Erwartungen an andere, an das Leben und auch an mich selbst, die, warum auch immer, nicht in Erfüllung gingen. Viele Beziehungen scheitern, weil über Verletzungen nicht gesprochen wird, weil man erwartet, der andere solle den ersten Schritt tun, das sei doch das Mindeste. Dieses Festhalten entfaltet manchmal ein tödliches Gift. Aus der Resilienzforschung allerdings ist schon lange bekannt, dass das Verlassen der Opferrolle mit einem deutlichen Zugewinn an seelischer Gesundheit einhergeht. Wem es gelingt, aus diesem Kreislauf unguter, kräfteraubender Gefühle auszusteigen, wird oft eine Entlastung, eine Befreiung von altem Ballast erleben. Und auf einmal erscheint die Haltung von Hans tatsächlich ein Glücksrezept zu sein.
Haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, sich in die Sichtweise des Gegenübers einzufühlen und in Betracht zu ziehen, dass dessen Meinung genauso zutreffend sein könnte wie die eigene? Was wäre, wenn er oder sie recht hätte? Was würde sich dadurch verändern? Könnte ich dabei etwas gewinnen? Aus der Hirnforschung wissen wir, dass wenige Inputs von außen zu Millionen Verschaltungen im eigenen Gehirn führen. Mit anderen Worten: Wahrnehmung ist immer höchst subjektiv und von unseren unzähligen bewussten und meist unbewussten Vorerfahrungen abhängig. Sie ist also keineswegs objektiv und deswegen nicht unfehlbar! Es kann sehr befreiend sein, der eigenen Meinung gegenüber immer mal wieder skeptisch zu sein.
Manchmal passiert Loslassen im vermeintlichen Scheitern und somit sicherlich nicht freiwillig. Der tiefe Fall des ehemaligen Bertelsmann- und Arcandor-Chefs Thomas Middelhoff, der 2014 wegen Steuerhinterziehung und Untreue verurteilt wurde, erzählt davon. Er saß deswegen 24 Monate im Gefängnis. 2017 wurde Middelhoff vorzeitig aus der Haft entlassen. Privatjet, Villen und die Motoryacht, das dreistellige Millionenvermögen – alles weg. Er bekennt sich zu narzisstischen Zügen in seiner Persönlichkeit, er habe um die Aufmerksamkeit der Medien gebuhlt und wollte immer noch bekannter und präsenter sein. Deswegen habe er alles verloren.
Als Wendepunkt beschreibt er seine Arbeit in einer Behindertenwerkstatt als Freigänger während seiner Haft. Es habe ihn glücklich gemacht, etwas Gutes und Sinnvolles zu tun und mit diesen Menschen frohe Momente zu erleben, in denen Geld überhaupt keine Rolle spielte. Heute wünscht er sich, dass alle Manager ein paar Wochen oder besser Monate soziale Arbeit im Rahmen ihrer Ausbildung leisten sollen. Als weiteren entscheidenden Schritt seines Umdenkens in dieser Zeit beschreibt er seine Bekehrung zum christlichen Glauben. Er habe darauf vertrauen gelernt, dass Gott ihn halte, egal was passiert. Bei all dem habe er Demut gelernt und die Verantwortung für sein Scheitern übernommen.4
Ob Middelhoff tatsächlich ein Gescheiterter ist? Ich wage das zu bezweifeln. Er hat gefunden, was mit Geld nicht aufzuwiegen ist: Zufriedenheit und (spirituelle) Verbundenheit.
Eine ähnliche Erfahrung machte Mitte der Neunzigerjahre auch der Liedermacher und Schriftsteller Konstantin Wecker. Durch seinen exzessiven Drogenkonsum ruinierte er sich nicht nur körperlich, er verlor auch so gut wie alles, was er bis dahin besaß. Er machte eine ähnliche Erfahrung wie Middelhoff, begann intensiv zu meditieren und entwickelte eine Spiritualität, die bis heute auch bei seinen Konzerten spürbar und erlebbar ist. Wecker hat sich unter anderem in seinen Büchern Die Kunst des Scheiterns und Das ganze schrecklich schöne Leben öffentlich zu diesem Le-
bensabschnitt bekannt. Er ist davon überzeugt, »dass die Vergangenheit auch in der Gegenwart liegt«. Eine buddhistische Erkenntnis, aus der folgt, »dass wir die Vergangenheit ändern können, indem wir die Gegenwart verwan-deln.«5 So gesehen gibt es vielleicht gar kein Scheitern.
Noch einmal zurück zu Hans. Mir scheint wichtig zu sein, dass Hans auf einer ganz bestimmten Reise ist, nämlich auf dem Weg zurück zu seiner geliebten Mutter. Wollte man dies als ödipale Verstrickung eines längst erwachsenen Mannes deuten, würde man das Märchen gänzlich missverstehen. Vielmehr scheint es Hans um einen derart tiefen inneren Wert zu gehen, der alles Äußerliche, und sei es Gold und Geld, nebensächlich erscheinen lässt. Hans setzt auf Verbundenheit, Zugehörigkeit und Liebe. Damit fokussiert er auf das, was zahlreiche wissenschaftliche Studien als den wichtigsten Grundpfeiler für Lebenszufriedenheit und Glück identifizieren: Gelingende Bindungserfahrungen und glückende menschliche Beziehungen. So die Ergebnisse der Grant and Glueck Study der Harvard Medical School.
Die Studie ist schon deswegen beachtenswert, weil sie seit 1938 Menschen nach dem befragt, was sie wirklich glücklich und zufrieden macht. Dafür werden diese Menschen zum Teil durch ihr ganzes Leben begleitet und immer wieder befragt. Nicht Karrieren, Erfolge, Geld und Ruhm stellen sich als das Glückselixier heraus, sondern gelingende Beziehungen. Middelhoff bestätigt in dem zitierten Interview, dass seine Beziehung zu seiner geschiedenen Frau und seinen Kindern heute besser sei als zu den Zeiten seines vermeintlichen Erfolgs.
Hans wusste dies intuitiv und seine Geschichte will uns auf eine bestimmte Weise wachrütteln und ermutigen, auf das zu setzen, was im Leben wirklich zählt. So möchte ich Sie einladen, sich mit den Fragen nach Zugehörigkeit und Liebe eingehend zu beschäftigen.
?
Wie fühlt sich das an, geliebt zu sein und zu lieben? Wo im Körper spüren Sie das? Wann haben Sie es zuletzt erlebt?
Was hat Sie Ihr Leben bisher über die Liebe gelehrt? Welche beglückenden Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Sind Sie dabei auch in eine spirituelle Dimension vorgestoßen? Und vielleicht geht es Ihnen so wie vielen Menschen, dass Sie Liebeslieder und Liebesgedichte besonders mögen. Wenn ja, welche sind das?
1. Worauf wir verzichten können
Wenn das Glas voll ist, passt nichts mehr hinein
Verzicht auf (noch) mehr
Wo man nehmen will, muss man geben.
Laotse
Ein Professor der Philosophie aus einem westlichen Land reiste einmal nach Asien. Er traf spannende Menschen und Gelehrte. Er stellte ihnen viele Fragen. Fragen nach Meditation und Gott, nach dem Sinn des Lebens und der Unendlichkeit. Doch er fand keine Antworten. Eines Tages wanderte der Professor immer weiter hoch in die Berge. Plötzlich stand er vor dem einfachen Haus eines Zen-Meisters.
Dieser lud den westlichen Mann zu sich ein. Der Professor sprudelte nur so vor Fragen und Wissensdurst. Er zählte dem Meister seine akademischen Titel auf und klagte ihm seine Verzweiflung über all die nicht beantworteten Fragen im Leben.
Der Meister schwieg. Dann sagte er: »Ich mache dir einen Tee.« Ungeduldig wartete der Professor, bis der Meister mit einer Tasse zurückkehrte. Tee trinken?, fragte sich der weit gereiste Gast insgeheim. Ich bin doch gekommen, um Antworten zu bekommen. Ob diese Reise wohl umsonst war? Gedanken schwirrten durch seinen Kopf und als er gerade aufstehen wollte, kehrte der Zen-Meister mit einer Kanne frisch aufgebrühten Tees und einer Tasse zurück. Eine Tasse Tee nach der langen Reise schadet ja nicht, bevor ich gehe, dachte sich der Professor und blieb.
Der alte Mann begann einzuschenken. Der dampfende Tee lief in die Tasse. Immer weiter und weiter. Auch als die Tasse längst voll war und sich das heiße Getränk über den Rand auf die Untertasse ergoss, hörte er nicht auf zu gießen. Erschrocken sprang der Professor von seinem Stuhl auf. »Halt! Genug!«, rief er. »Die Tasse ist doch voll! Sehen Sie das nicht?«
Da hielt der Meister inne und schaute seinem Gast zum ersten Mal ins Gesicht. Seine faltigen Augen umspielte ein Lächeln. Plötzlich sah der Mann gar nicht mehr so gebrechlich aus. Weisheit und Lebenserfahrung strahlte jede Faser seines Körpers aus.
Читать дальше