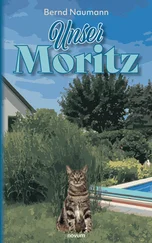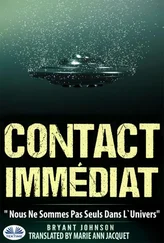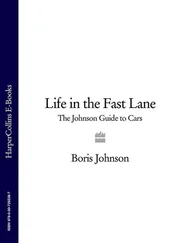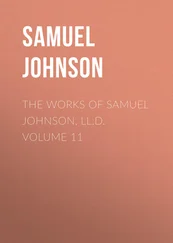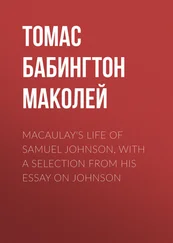LYRISCHES INTERMEZZO, SOMMER 1952.
»DER SINGENDE« ODER JOHNSON ALS »SPITTA«
Der Singende , eine von Ernst Barlachs Plastiken, beeindruckt durch seine glückliche Einfältigkeit. Den gleichen Eindruck erweckt der Abiturient Johnson, wo er Lyrik, vielleicht besser: Gedichte, Gereimtes geschrieben hat. Uwe Johnsons frühe Gedichte waren, im genauen Sinn des Wortes, »Gebrauchslyrik«. Ihnen war aufgegeben, Gemeinschaft im Kreis Gleichgestimmter herzustellen. Stets sind sie dabei auf ferienhafte Umgebung abgestellt. Sie sollten ein Wir-Gefühl möglich machen und die Gemeinschaft des Augenblicks in Gereimtem feiern. Leopold Tober, der heute in Schweden lebende Bruder von Johnsons Schulfreundin Antonie Landgraf, erinnert sich, daß der Schüler Johnson gern sogenannte Katschmarek-Gedichte, also Verse im Slawen-Deutsch, improvisierte. Auch diese stellten Unterhaltung für eine Gemeinschaft dar. Sie konnten lauten: »Gut wenn sich im Grase liegt/Schlecht wenn sich in Fresse fliegt/Abgeschrieben wenn Granatsplitter.«
Das Insel-Tagebuch, eine Art Gedicht-Sammlung, die Kurt Hoppenraths Witwe Louise aufbewahrt hat, ist auf den 25. bis 28. Juni 1952 datiert, also binnen weniger Tage in der Zeit unmittelbar nach bestandenem Abitur entstanden. Da war der frischgebackene und gewiß vom Gefühl neu gewonnener Freiheit beschwingte Abiturient zusammen mit Schulkameraden beiderlei Geschlechts auf einer Insel im Krakower See, dem Großen Werder vermutlich. Teilnehmer erinnern sich, daß Johnson damals leidenschaftlich »Kann denn Liebe Sünde sein« sang. Daß er andererseits häufig allein am Wasser saß. Da wird der Schulabgänger dann gedichtet haben. Einige Resultate dieser Mußestunden werden im folgenden zum ersten Mal vorgelegt. Ihnen vorangestellt war ein gleichfalls gereimtes Vorwort:
Statt eines Vorwortes
Auf dem Landungssteg der Insel
Stand ein Hund, der mit Gewinsel
Mir eine herzliche Begrüßung machte.
(Weil ich für ihn das Futter brachte.)
Weiter stand da noch ein Schild,
Wirklich ein sehr schönes Bild,
Daß das Betreten verboten sei,
Andernfalls sei Strafe dabei.
Als der Schreiber stellt sich vor
Ein gewisser Berthold Mohr.
Dadurch wurde mir sehr klar,
Daß es hier nicht anders war
Als da, von wo ich hergekommen,
Doch hab ich das nicht tragisch genommen.
Man kann ja nicht gleich bis zum Nordpol verreisen,
Schon wegen der Aussicht, da zu vereisen.
Auch hier war ich nun ganz allein
Und wollte versuchsweise glücklich sein.
Davon, wie dies mir gelungen,
sei hier nun ein Lied gesungen.
Was im konformen Stil dieser Gedichte umgeht, ist eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, zu der unabdingbar das gemeinsame Singen gehört. In den hier zur Rede stehenden Versen hat Uwe Johnson, der nicht eben gut singen konnte, gesungen. Hat sich so noch einmal der verbindenden Nähe einer Gruppe anvertrauen wollen. Gemeinschaftliches, gemeinschaftsbildendes Singen, wie Johnson es von seinen Schulen kannte, jetzt als literarische Handlung. Für die Feriengemeinschaft auf der Insel im Krakower See, auf ihr hatte die Familie Mohr einmal eine Pacht besessen, schrieb Uwe Johnson Verse wie die folgenden:
Nieder-Geschlagenes
Große und auch kleine Tropfen
Leise an die Scheiben klopfen.
Es regnet. Es regnet ungebührlich
Und viel zu sehr kontinuierlich
Große und auch kleine Tropfen.
Ich frage nur: Ist dieses nötig?
Wenn nicht, so bin ich gern erbötig,
Für morgen und auch übermorgen
Für lauter Sonnenschein zu sorgen.
Doch bin ich nicht als Petrus tätig.
Ich sitze den ganzen Tag im Haus,
Denn der Regen läßt mich nicht raus.
Er macht da draußen große Pfützen.
Da kann die Sonne tagelang sitzen
Und trocknen die wieder aus.
Der Regen katzenähnlich schnurrt
Und äußerst geistverwirrend surrt.
Als ich den Hund vorhin mal fragte,
Was er zu diesem Wetter sagte,
Hat dieser Kerl mich angeknurrt.
Vielleicht über Irland ein neues Tief
Oder es regnet mal ohne Motiv.
Vom Trübsinn des Wetters angesteckt,
Habe ich Bosheit in mir entdeckt
Und mache aus posi-negativ.
Das Barometer: Veränderlich,
Doch nichts am Wetter ändert sich
Außer der Stärke des Regens
Und Hoffnung klammert sich vergebens
An das tröstliche Wort: Veränderlich.
Oder auch:
Verschlafenes
Dieweil nach stattgehabter Kauung
Empfiehlt sich gründliche Verdauung,
Ging mitten ich in die Natur
Mit einer Badehose nur
Und sonst nichts weiter angetan.
Im starken, unbewußten Tran,
Ließ ich mich dort, wo Rindvieh weidet,
Das ungewöhnlich unbekleidet,
Zu dem Verdauungsschlafe nieder
Und streckte meine langen Glieder
Unbekümmert, ungehindert in das Gras.
Da Platz genug war, konnt’ ich das.
Als mir dann die Augen sanken,
Hatte ich nur den Gedanken:
O wie ist das schön!
Dann habe ich gegähnt.
Man konnte sich im Himmel wähnen,
Genau so schön ist es gewesen.
Und wenn dies jemand sollte lesen,
So möge er recht herzhaft gähnen!
Ferien in der Gemeinschaft als der Himmel auf Erden. Doch eines: Die erotische Erfüllung läßt sich hinter der so erfrischend kalauernden wie häufig verunglückten Melodik dieser Zeilen als ein Wunsch verspüren. Man schlief, nach Geschlechtern getrennt, in einer scheunenartigen Behausung. Der sehnsüchtig-erschreckte Ruf aus Mädchenmund »Die Jungen kommen« wurde neben der Frage, ob Liebe denn Sünde sein könne, zum Schlager dieser Saison. Es blieb beim bloßen Rufen. Die Disteln, die die Mädchen in hoffnungsvoller Furcht in die Eingangsluken der Schlafscheunen legten, blieben ohne Funktion.
Kalamität
Ich schlief dort unterm Dach.
Darauf wies ich das Fehlen nach
Einer Leiter, mittels derer
Mein an siebzig Kilo schwerer
Körper auf den Boden käme,
Ohne daß er Schaden nähme.
Schließlich fand ich dann auch eine
Besser war sie schon als keine,
Doch war sie außerdem gebrechlich:
Tatsächlich lebensgefährlich schwächlich.
Den ersten Abend trug sie mich,
Nur knarrte sie absonderlich,
Denn sie war, wie schon gesagt
äußerst schwach, da hoch betagt.
In Heu und Decken eingepackt
Verschlief ich meine erste Nacht,
Nur träumte ich von einer Leiter!
Die ich hochstieg, immer weiter – – –
Bis das Ding, das altersschwache
Zusammenbrach mit viel Gekrache.
Davon bin ich aufgewacht.
Es war schon mitten in der Nacht,
Ich hab es noch drei Mal geträumt
Und morgens wild vor Wut geschäumt.
Man liebt doch eine romantische Nacht
Nur, wenn man sie ohne Aufregung verbracht.
Ein psychoanalytischer Interpret würde diesen »Traum« vielleicht als einen von gefürchteter Bestrafung bei geträumter Erfüllung erotischer Sehnsucht verstehen: die zusammenbrechende, sich hoch erstreckende Leiter. Wie auch immer: Die Landschaft und die Atmosphäre der engeren Heimat des Abiturienten Uwe Johnson, zwischen Güstrow und Müritz, erscheinen in diesen Versen aufbewahrt. Es wird genau diese Wasser-Landschaft sein, die zunächst auch die Spiel-Welt der Babendererde abgeben wird. Erst im Zuge der Überarbeitung des Textes wird sie durch die großartigere Müritz (deren Name »Meer« bedeutet) ersetzt werden. Die aber würde erst der Student Johnson in seine Erfahrung bringen.
Bereits in den beiden Jahren vor dem Abitur waren die Oberschüler der Brinckman-Schule am Krakower See gewesen. Man fuhr mit dem Fahrrad bis Krakow, setzte dann auf die Insel über. Ein Wandervogel-Leben griff Platz. Man schlief auf Heuböden, schwamm in den Seen, sammelte Möweneier und beobachtete Fischreiher auf einer Nebeninsel. Wenn Johnsons Schulkameradin Brigitte Stüwe, damals noch Martens, aus dem Wasser stieg, spielte die Clique auf einem von Hand aufgezogenen Grammophon das allseits beliebte »Kann denn Liebe Sünde sein«. Unbeschwerte Tage, die dann in den Abschlußband der Jahrestage und in das Verhältnis zwischen Pagenkopf und Gesine eingehen durften:
Читать дальше