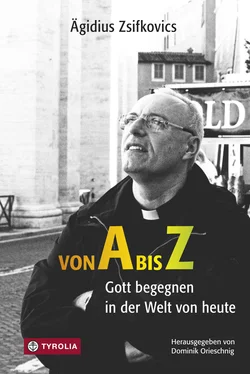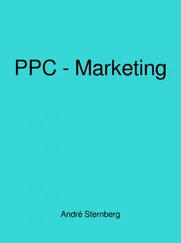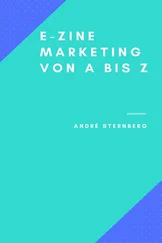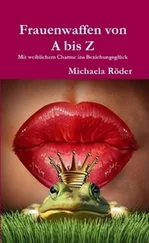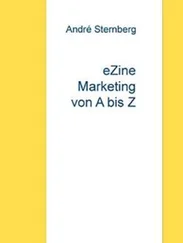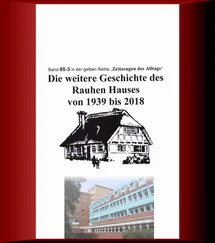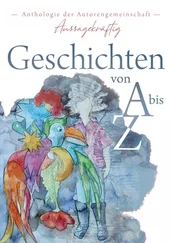Ägidius Zsifkovics - Von A bis Z
Здесь есть возможность читать онлайн «Ägidius Zsifkovics - Von A bis Z» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Von A bis Z
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Von A bis Z: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Von A bis Z»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Illustriert wird der Band durch doppelseitige Bilder aus dem Zyklus Wandlung von Heinz Ebner. In den Farben des Regenbogens gehalten verwebt der Künstler weltliche und religiöse Bildelemente und lässt – ganz der Intention der Texte folgend – die Präsenz des Göttlichen in der Welt erahnen.
Von A bis Z — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Von A bis Z», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Für einen stabilen Menschen braucht es religiöse Bildung und der Ort religiöser Bildung an der Schule ist primär der Religionsunterricht. Die Antworten auf die letzten Fragen des Menschen kann und soll der säkulare und weltanschaulich neutrale Staat nicht selbst geben. Deshalb kooperiert er mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften, die für die Ziele und Inhalte des Religionsunterrichts verantwortlich sind. Und er beschränkt sich darauf, für den Religionsunterricht wie für jedes andere ordentliche Lehrfach die erforderlichen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen zu gewährleisten. So soll ein konfessionell-profilierter Religionsunterricht junge Menschen zu verantwortlichem Denken und Verhalten im Hinblick auf Religion und Glaube befähigen und ihnen die Entwicklung einer gesprächsfähigen Identität ermöglichen. Das schließt die Hinführung zu einer konkret erfahrbaren und anschaulichen religiösen Lebenswelt ebenso ein wie die Erziehung zu Kommunikationsfähigkeit über die eigene regionale Kultur hinaus und zu Anerkennung der Andersheit des anderen. Der konfessionelle Religionsunterricht will zur freien Entscheidung und Herausbildung eines eigenen Standpunktes befähigen und leistet damit etwas Essentielles für die ganze Gesellschaft: Er fördert automatisch auch die Anerkennung des Anderen. Denn tolerant kann nur sein, wer einen eigenen Standpunkt hat. Etwas, das von manchen gesellschaftlichen Gruppierungen gerne übersehen oder bewusst verschwiegen wird, wenn sie in meinungsterroristischer Weise „Toleranz“ für alles und jeden, aber in erster Linie für sich selbst einfordern. Die Weitergabe des christlichen Glaubens kann also wirkungsvoll nur im Dialog mit der vorherrschenden Kultur und in Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und Problemen erfolgen. Deshalb ist der Religionsunterricht in der Schule für die Kirche und für die Zukunft des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft von großer Bedeutung.
So wie ich mich aber in meinen Gedanken nicht darauf beschränkt habe, vom Wert des Religionsunterrichts für die Kirche selbst zu sprechen, sondern auf seine brennende Gesellschaftsrelevanz hingewiesen habe, lässt sich auch der jesuanische Auftrag keinesfalls auf pädagogisch Auszubildende und auf die Schule beschränken. Im Prinzip sind wir alle „Auszubildende“ in der Botschaft Jesu und ist unser ganzes Leben ein lebenslanges Lernen in Sachen Nächstenliebe. Wenn ich also von Schule, von Schülerinnen und Schülern und vom Religionsunterricht spreche, meine ich im Letzten uns alle, die wir noch zu lernen haben.

B wie BISCHOF
Oder: „Wonach es einen vorher gelüstet, davor darf es einem danach auch nicht grausen!“ (Gertrude Zsifkovics)
Bischöfe sind im Idealfall wie ein „Leatherman“ oder ein Schweizer Messer: multifunktionale Tools ihrer Kirche, die in einem Rund-umdie-Uhr-Job als Oberhirten, Seelsorger, Prediger, Lehrer, Gesetzgeber und Richter, Ombudsmänner und Mediatoren die ihnen überantworteten Diözesen leiten und damit das Gesicht der Kirche vor Ort darstellen. Am Vorbild des pannonischen Heiligen und Bischofs Martin von Tours erläutert Ägidius Zsifkovics die Rolle des Bischofs zwischen geistlichem Anspruch, kirchlicher Karriere und nüchternem Alltag – mit erstaunlichen Einblicken in die traditionelle Grundausstattung und Garderobe eines Oberhirten.
Der heilige Martin ist eine Gestalt, die viel über das Bischofsamt verrät. Das beginnt bereits bei seiner Bestellung zum Bischof. Der Legende nach haben ihn schnatternde Gänse verraten, als er sich in einem Stall versteckte, um der drohenden Ernennung zum Bischof von Tours zu entgehen. Eingedenk dieser Episode landen die Federtiere alljährlich zum Martinsfest gut gebraten auf den Festtafeln. Die Legende verweist auf zwei christliche Eigenschaften, die gerade einem Bischof nicht schlecht zu Gesicht stehen: Bescheidenheit und Demut. Wer weiß, vielleicht hätten andere in dieser Situation die Gänse getreten oder zumindest an den Schwanzfedern gezogen, damit sie ja ordentlich Lärm machen und das Volk Gottes auch ganz verlässlich zum „Besten aller Kandidaten“ führen. So wenig der kirchliche Leitungsdienst ohne Gestaltungswillen und ohne gesunden Ehrgeiz zu bewerkstelligen ist: Karrierismus ist im kirchlichen Bereich eine besonders problematische Erscheinungsform, die von Papst Franziskus zu Recht stark kritisiert wird. Der heilige Martin steht für eine andere Haltung!
Wie das bei mir war? Wenn ich mich als Kind überessen habe, hat meine Mutter immer gesagt: „Wonach’s dich zuerst gelüstet hat, davor braucht’s dir jetzt auch nicht zu grausen!“ Den Ruf in das Bischofsamt anzunehmen, entsprang ehrlich gesagt keiner „Lust“, aber er ging einher mit einem tief empfundenen Gefühl der Freude und der Dankbarkeit, dem eine schlaflose Nacht mit allen nur erdenklichen gedanklichen Anfechtungen vorausgegangen war. Ich hatte als bischöflicher Sekretär, als Ordinariatskanzler und als Generalsekretär der österreichischen Bischofskonferenz zu lange mit Bischöfen und ihren Amts- und Lebenswegen zu tun gehabt, um nicht zu wissen, dass sich unter der Mitra auch eine unsichtbare Dornenkrone befinden kann. Dass man als Bischof – noch mehr als der Priester – für den Rest seines Lebens einer Gemeinschaft gehört, mit der man in Gott verbunden ist und in der man für jeden Einzelnen sowie für alle zusammen persönliche Verantwortung trägt. Ein nach menschlichen Maßstäben unmöglich zu erfüllendes Unterfangen! Und doch habe ich diesen Dienst, den ich nie angestrebt habe, am Tag der Weihe mit großer innerer Zuversicht angenommen und mein Schicksal in Gottes Hände gelegt. Er hatte mich stets geführt und würde es wohl auch weiterhin tun, so mein Gebet und meine Hoffnung am Tag meiner Bischofsweihe, an dem mir auch meine Mutter ihren Segen gab. Bis jetzt habe ich mich nicht überessen.
Ein Bischof braucht Vorbilder – und das sollten keine Eintagsfliegen sein. Martinus, der pannonische Heilige und Bischof von Tours, der Mann der Aktion und der Kontemplation, ist ein Vorbild, das einen ein Leben lang begleiten kann. Ich mache mich selbst, aber auch meine Mitchristen immer wieder auf die Insignien des Heiligen aufmerksam: den Hirtenstab, den geteilten Mantel in der Hand und die Mitra auf dem Haupt – Attribute, Zeichen, die uns alle an diesen großen Europäer, Mann des Glaubens und der konkreten Tat erinnern. Und noch mehr daran, dass wir als Christen die Verbindung mit Jesus suchen und pflegen sowie das Evangelium im Alltag in die Tat umsetzen.
Der Hirtenstab ist ein Zeichen, dass jeder Bischof durch seine Weihe mit dem apostolischen Ursprung, mit Jesus Christus verbunden ist. Der Hirtenstab ist kein Spazierstock für den Alpintouristen, sondern ein Instrument, das dem Volk Gottes anzeigt, in welche Richtung es in der Nachfolge Jesu zu gehen hat. Der Hirtenstab ist ein Zeichen, die zerstreute Herde zu sammeln und zu verteidigen, Mutlose und Hilflose zu stärken, Suchenden, Irrenden den Weg zu weisen. Martinus mit dem Hirtenstab in der Hand tat dies damals in stürmischen Zeiten der Völkerwanderung, am Übergang von der Antike zum Mittelalter. Er erinnert uns daran, es ihm in den Herausforderungen unserer Tage nachzumachen und uns auf die richtige Richtung unseres Lebens zu besinnen.
Als ich mich nach meiner Ernennung zum Bischof mit den entsprechenden Insignien ausstatten musste, suchte ich in Rom einen traditionellen Anbieter für den geistlichen Berufsstand auf. Keine Sonderanfertigungen, sondern solide Konfektionsware, liturgisches „Pret à porter“. Der Seniorchef des Ausstattungshauses, ein gestandener Römer mit jahrzehntelanger Erfahrung und Menschenkenntnis, die er sich im Umgang mit Priestern und Bischöfen von Wladiwostok bis Tahiti, von Hammerfest bis Kapstadt erworben hatte, stand persönlich im Geschäft und beriet mich. Als wir in die Abteilung für Bischofsstäbe kamen, steuerte er auf ein bestimmtes, etwas massiv wirkendes Modell zu, zog es heraus und stellte es vor mir mit einem dumpfen Geräusch fest auf den Boden. „Eccellenza“, sagte er, „prenda un modello come questo – la curvatura piú grossa fa piú effetto nei casi difficili!“ – „Nehmen Sie ein Modell mit etwas breiterer Krumme – die zeigt bei den schweren Fällen mehr Wirkung!“ Und er schwang, mitten im Laden, den Bischofsstab mit einer Vierteldrehung nach unten, so als ob er jemandem damit eines über den Kopf geben wollte. Ein paar junge Priesterkandidaten hinter dem nächsten Regal, die sich gerade ihre ersten Kollarhemden kauften und die Szene beobachtet hatten, machten große Augen. Nachdem ich aus dem ersten Staunen herausgekommen war, wurde mir klar, dass der Mann eine schlichte Wahrheit – wenn auch etwas brachial – auf den Punkt gebracht hatte: Dass der Bischof jemand ist, der sich wie ein Hirte schützend vor die Herde stellen muss, wenn sie angegriffen wird. Unter allen Umständen. Egal gegen wen. Egal mit welchen Konsequenzen für den Hirten, seine Gesundheit und sein gesellschaftliches Ansehen. Aber der Bischof ist auch jemand, der den gekrümmten Hirtenstab benötigt, um die verlorengegangenen Schafe sanft einzufangen und in die Gemeinschaft zurückzuholen. Wenn das nicht auch die Bedeutung eines Bischofsstabes ist, dann verkommt er zum bloßen Fetisch kirchlich-religiöser Macht – ähnlich den prächtigen Stöcken und Wedeln von Schamanen ausgestorbener Kulte, die man im ethnologischen Museum besichtigen kann.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Von A bis Z»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Von A bis Z» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Von A bis Z» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.