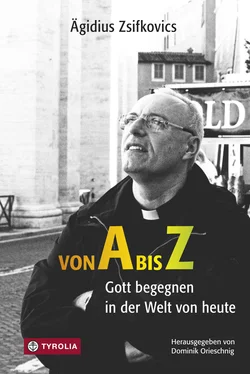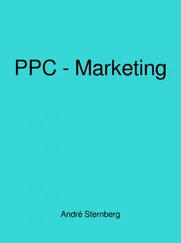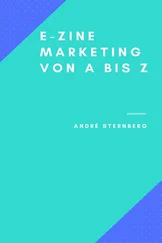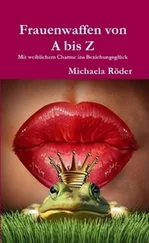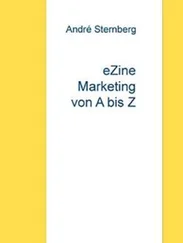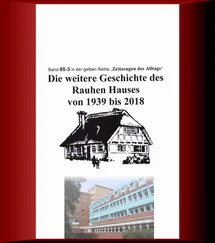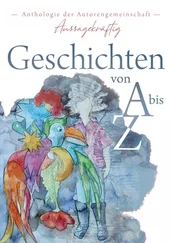Osteraugen können entdecken, dass im Menschen Jesus von Nazareth das Leben endgültig zum Durchbruch gekommen ist; ein – trotz Leid und Tod am Kreuz – erfülltes und gelungenes Leben, so wie Gott sich wahres Leben vorstellt. Osteraugen verschließen sich nicht vor der Not. Sie nehmen die vielen Todessignale in unserer Welt wahr, sie haben einen Blick dafür, wo das Leben zu kurz kommt oder auf der Strecke bleibt, wo einer mundtot gemacht wird, wo einer unter die Räder kommt. Sie erkennen, wo wir aufstehen müssen gegen Ungerechtes, Eingefahrenes und Erstarrtes.
Osteraugen lassen sich aber auch leichter zudrücken. Sie sehen die eigenen Fehler und können deshalb über die Schwächen der Anderen gelassen hinwegsehen. Osteraugen sehen weiter. Sie bleiben nicht auf das Schwierige und Unsympathische fixiert, das uns an unseren Mitmenschen immer zuerst auffällt; sie bleiben nicht an Krankheit, Leid, Tod haften, sondern schauen hinter die Fassade des vordergründig Abstoßenden und entdecken den Anderen, so wie Gott ihn sich gedacht hat. Sie sehen einen Weg, wo vorher keiner war, und sie sehen im Ende schon wieder einen neuen Anfang. „Erlöster müssten die Christen aussehen, damit man an ihren Welterlöser glauben kann.“ Vielleicht hätte Friedrich Nietzsche diesen Vorwurf nicht formuliert, wenn er mehr Christen mit Osteraugen begegnet wäre.
Vielleicht könnten wir als Kirche gelassener sein, wenn immer mehr Christen – Geweihte und Laien – den Auferstandenen wirklich „im Blick“ hätten. Denn diese Perspektive wäre die heute so notwendige Neuevangelisierung! Die Mitte unseres Glaubens und unserer Kirche ist und bleibt dieser Auferstandene und unsere lebendige Beziehung zu ihm durch Gebet, Gottesdienst und tätige Nächstenliebe.
Oder: Was macht ein ausgedienter Kühlschrank im Wald?
Die Beichte ist in einer Gesellschaft der Selbstoptimierer sicher das unpopulärste aller Sakramente, aber angesichts des von Papst Franziskus für 2016 ausgerufenen „Jahres der Barmherzigkeit“ von großer Aktualität. Bischof Zsifkovics wird nicht müde, das „Sakrament der Versöhnung“ aus der Vergessenheit zu holen und es als befreienden Bestandteil menschlichen Lebensstils ins Bewusstsein zu rufen. Dass der Bischof den Beichtstuhl einmal als „Duschkabine für die Seele“ bezeichnet hat, zeigt sein praktisch-elementares Verständnis von Beichte, die er in einer Reihe mit gesellschaftlichen Praktiken wie Umweltschutz und Recycling sieht:
Jesus lädt uns Menschen zum Glauben an das Evangelium ein, sagt aber gleichzeitig: „Kehrt um!“ Glaube und persönliche Umkehr sind also aufeinander bezogene Forderungen Gottes an den Menschen. Die Beichte als das Sakrament der Versöhnung ist ein großartiges Geschenk des Auferstandenen an uns. Dennoch erweckt allein das Wort „Beichte“ in vielen Menschen unangenehme Gefühle. Sie reichen von totaler Ablehnung bis hin zu völliger Gleichgültigkeit. Von den einen abgelehnt, weil sie den Beichtstuhl vielleicht als Ort der Demütigung oder der Indiskretion erlebt haben, und von den anderen ahnungslos belächelt, weil sie nie erfahren durften, was für ein Geschenk die Beichte für den Menschen eigentlich ist. So ist dieses Sakrament zunehmend nicht nur zum ungeliebten und vergessenen, sondern auch zum unbekannten Sakrament geworden. Doch gerade darin liegt für unsere heutige, an Geist und Geistlichkeit so arme Zeit die große Chance, die befreiende und belebende Wirkung der Beichte neu zu entdecken.
Als Beichtvater wie als Sünder, der selbst zur Beichte geht und genau weiß, wie schwer dieser Schritt sein kann, bin ich überzeugt: der Beichtstuhl ist der Ort, an dem nicht nur der Einzelne, sondern die ganze Welt ihre größte Reparatur erfahren kann. Wie viele politische und soziale Programme, Expertentreffen, Arbeitsgruppen und Gesetzesbeschlüsse könnte eine gute Beichtpraxis überflüssig machen? Denn die Beichte verändert die Welt im Kern: beim Einzelnen selbst. Umkehr, Reue und die versöhnende, verzeihende Liebe, die Gott selbst dem Beichtenden schenkt, machen die Beichte zum Sakrament der Heilung. Hier erfährt der Mensch die Wiederherstellung zerbrochener Beziehungen: zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und dadurch letztlich zu Gott, der den innersten Kern unseres Menschseins darstellt. Ein Mensch, der sagt, dass er ohne Sünde sei, die Beichte nicht brauche und alles mit und für sich selbst regeln könne, belügt sich selbst – das sagte schon der Apostel Johannes.
Dieser Selbstbetrug kommt in der heutigen Zeit dennoch häufig vor. Wir alle trennen und entsorgen zwar unseren Haushaltsmüll und kennen die Bedeutung von Recycling für uns und unsere Umwelt, weil wir wissen, dass wir Menschen in einer sensiblen Beziehung zur Natur stehen, die unaufbereiteten Abfall auf uns selbst zurückfallen lässt. Die meisten von uns hätten zurecht ein schlechtes Gewissen, einen alten Kühlschrank im Wald zu entsorgen oder Frittierfett in den Ausguss zu schütten. Doch wie sieht es mit der seelischen Müllentsorgung aus?
Der Akt seelischer Versöhnung mit sich selbst wird offensichtlich weit zurückhaltender praktiziert als jener der Versöhnung mit der Umwelt. Wäre es anders, bräuchten wir mehr Beichtstühle in unseren Kirchen. Dabei ist Gott der Meister des wahren „Recyclings“: Er, der sich in den Kreislauf des Lebens hineinbegeben hat, indem er selbst Mensch wurde und in Leiden, Tod und Auferstehung alle Tiefen und Höhen des menschlichen Lebens durchgemacht hat; er, der in der Eucharistie Teil von uns selbst wird, kann sogar unsere schwersten Sünden in Gutes verwandeln. Aus dem Misthaufen unserer Fehler können Rosen wachsen, wenn wir unsere Schwächen erkennen und sie bewusst in Gottes gütige Hände legen.
Papst Franziskus sagt es ganz klar: „Es gibt keine Situation, die Gott nicht ändern kann, es gibt keine Sünde, die er nicht vergeben kann, wenn wir uns ihm öffnen.“ Gott will nicht, dass unsere Seele zu einer Deponie für Sondermüll verkommt. Er will nicht, dass unsere fehlerhaften Haltungen wie ranziges Öl unseren Zugang zur Welt und zu ihm verkleben und uns an unserer freien Entfaltung behindern! Gott ist unser Freund, er will unser Bestes, unser Heil und unsere Heilung.
Das führt zur entscheidenden Frage: Wie kann ich so beichten, dass es mir echte innere Heilung ermöglicht? Der bekannte Mailänder Kardinal Carlo Maria Martini hat drei Schritte aufgezeigt, wie das Sakrament der Versöhnung als echtes Geschenk erfahren werden kann, das dem Menschen Frieden, Befreiung und Lebensfreude bringt. Diese drei Schritte helfen auch mir persönlich bei der Beichte jedes Mal sehr und ich praktiziere sie als drei einfache Bekenntnisse. Diese Bekenntnisse sind Teil der Weisheit, die die Kirche über Jahrhunderte hinweg angesammelt hat und dem Menschen heute als Arznei für die Seele anbietet:
Erstens: Das Bekenntnis des Lobes (confessio laudis). Ich beginne die Beichte mit Positivem, nämlich mit einem Bekenntnis der Dinge, für die ich Gott loben und danken möchte. Ich nenne das viele Gute beim Namen, das Gott in meinem Leben gewirkt hat: Ereignisse, die mir viel bedeuten; Menschen, die ich liebe; Situationen, in denen mir geholfen wurde. Es wird wohl niemanden geben, dem nichts einfällt, wofür er dankbar sein müsste. Und indem ich dankbar Rückschau halte, wird mir umso mehr bewusst, dass ich mich des vielen Guten durch mein Verhalten nicht immer würdig gezeigt habe. Diese Einsicht kann einen Menschen tief bewegen und echte Reue bewirken. Denn oft sind, wie Papst Franziskus sagt, „in unserem Leben die Tränen die Brille, durch die wir Jesus sehen“.
Zweitens: Diese Reue führt mich zum Bekenntnis des Lebens (confessio vitae) – zum ehrlichen Bekenntnis der Dinge in meinem Leben, von denen ich vor Gott wünschte, dass sie besser nicht da wären. Das ist der Moment, die „alten Kühlschränke“ und anderen Sondermüll, den wir versteckt halten, offen anzuschauen. Es kommt hier nicht darauf an, nur seine Fehlhandlungen zu berichten bzw. sie anhand der Zehn Gebote abzuarbeiten. Ein solcher Automatismus führt meist nicht zu einer tiefgreifenden Veränderung in uns. Das Sakrament ist kein Zauberding, das uns von außen verwandelt wie der Zauberstab des Harry Potter. Graben wir daher tief hinein in unser Inneres und blicken wir – wenn es sein muss durch die Brille unserer Tränen! – auf die wunden Punkte, die Tiefenströmungen und negativen Haltungen, die uns immer wieder der Sünde ausliefern und die nicht gut sind für uns und unser Leben.
Читать дальше