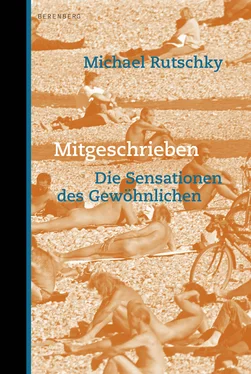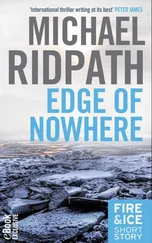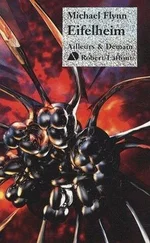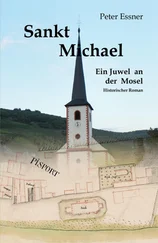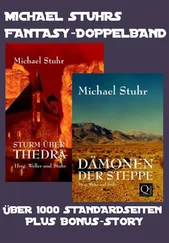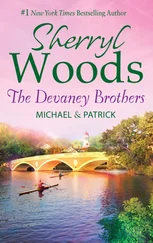Eigentlich sollte er N. festhalten, während der Hund trinkt, denn der Brunnenrand ist sehr schmal. Aber die Angst, die Türkenkinder könnten Tasche und Kamera – vor allem die Kamera – beiseite bringen, setzt sich durch, und R. lässt den Hund balancieren, damit er die beiden Objekte im Auge behalten kann.
Nach ein paar vorsichtigen Schritten fällt der Hund herunter.
R. telefoniert längere Zeit mit Henning Norps. Schließlich kommt der auf seine Ehe zu sprechen, dass sie von Auflösung bedroht sei.
Das Problem? Dass Frauke kein oder nur sehr wenig Selbstgefühl besitze – das ihm ja, trotz mancher Anfechtungen, nicht abgehe … Sie fühle sich von ihm erdrückt, weiche deshalb in Aktivitäten aus, die ihre Selbständigkeit bekräftigen und von ihm, Henning, wegführen.
R. muss schweigen zu dieser Deutung. Sie steht in genauem Gegensatz zu seiner eigenen. Frauke Norps verachtet ihren Mann; sie fühlt sich als Fabrikantentochter dem Arbeitersohn gründlich überlegen; sie findet seine Anpassungs- und Aufstiegsleistungen lächerlich.
Henning Norps’ Deutung stammt gewiss aus der Eheberatung, die sie irgendwann aufsuchten, »weil es nicht mehr ging«. Frauke wird sie dort entwickelt, erfunden haben: als eine richtig elegante Lösung des Problems. Die Wahrheit durfte sie nicht sagen: Sie hätte Henning tief gekränkt. Sie hätte ihn vernichtet.
Er hofft auf einen Neuanfang, wenn die Kinder aus dem Haus sind – »der arme Henning«, spottet später Achim, schon ziemlich betrunken, als R. von dem Telefongespräch erzählt, »der arme Henning soll sich eine neue, eine geile Frau suchen.«
Im Pissoir des Hallenbades regelmäßig die Befürchtung, mit den nackten Füßen in fremdem Urin zu patschen.
Schließlich muss einmal festgehalten werden, dass Michel, der sich die Haare schwarz färbt, der sich sehr sorgfältig kleidet – »ein richtiger Stenz«, wie Anita Albus bemerkte, nachdem sie ihn zufällig auf der Straße getroffen hatte –, schließlich muss einmal festgehalten werden, dass dieser Michel sehr wenig Sorgfalt auf seine Fingernägel verwendet.
Stets lässt er sie zu lang wachsen, und sie ragen hässlich über die Fingerkuppen hinaus; manchmal brechen welche ab, und er muss sie stutzen, lässt die anderen, unabgebrochenen aber stehen, sodass die Nägel ganz unregelmäßig ausschauen; viele haben Trauerrand.
Heute fiel es R. wieder auf, als sie nebeneinander stehend die Stelle in einem Manuskript besprachen, auf die Michel den Zeigefinger gelegt hatte.
Schon seit Tagen erwartet R. von jeder Nachrichtensendung, sie werde melden, dass Helmut Schmidt erschossen worden ist. Heute gab es wenigstens Andeutungen zu einem Attentatsversuch auf die Königin Elisabeth.
Das müsse ja eine Lebensaufgabe sein, spottet Kathrin angesichts dreier nackter Männer, die sich von der Sonne ein ganz unwahrscheinliches Tiefrotbraun haben einbrennen lassen. Aufpassen, dass die Haut sich nicht gleich nach der ersten Sitzung schält; regelmäßig wiederholtes Einkremen; die Aufmerksamkeit, dass wirklich jedes Stück Haut am Körper der Sonnenschein erreicht.
»Ich glaube«, sagt Kathrin, »das ist nur was für Männer.« R. fällt ein jüngerer auf, der gerade die Liegeposition wechselt: In geradezu lächerlicher Manier scheint das Geschlechtsteil den Mittelpunkt seiner Selbstinszenierung zu bilden. »Eigentlich«, erklärt Kathrin, »habe ich nichts dagegen.« – »Vor allem, wenn man das Leiden bedenkt, das die Unterdrückung von so viel Exhibitionismus mit sich bringen würde.« Sie lacht.
Es scheint sie beide mit Unbehagen zu erfüllen, dass so viele Splitternackte an der Isar herumliegen.
»Man müsste«, so R. zu Goetz, als sie zu dritt im Rolandseck sitzen, »man müsste jetzt gegen die CDU, die ja eine Kampagne gegen den Pazifismus angefangen hat, eine Kampagne wegen mangelnden Patriotismus’ starten. Man muss sie als vaterlandslose Gesellen hinstellen. Denn sie verraten die deutschen, sogar die europäischen Interessen mit ihrer bedingungslosen Folgsamkeit gegenüber den USA.« – »Und wie startet man eine solche Kampagne?« – »Indem man irgendwo, an einer ganz unauffälligen Stelle damit anfängt.«
Der Juttavater erwartet sie, wie immer, am Fahrstuhl. Er wirkt nicht krank, er wirkt vollkommen greisenhaft. Die Juttamutter übernimmt gleich die Darstellung seines Zustands.
»Die Gallensteine, die Gallensteine«, unterbricht er sie plötzlich (überhaupt pflegt er, wenn er was sagen möchte, ein einziges Wort zu wiederholen, statt einen Satz zu bilden). Die Juttamutter hat nichts einzuwenden gegen die Demonstration, und er holt sie herbei: Dunkelbraune Brocken in einer Plastiktüte.
»Steine« ist nicht das treffende Wort – eher erinnern sie R. an die Braunkohle, wie sie kurz nach dem Krieg zu Hause verheizt wurde. Und die durchsichtige Plastiktüte stellt die Gallenblase dar, die nun im greisenhaften Körper des Juttavaters fehlt.
Wie Howard am Videogerät die Sexszene betrachtet, die er kürzlich von sich und Marion (die einverstanden war) aufgenommen hat; wie Marion mit Howard und Ken vor dem Kaminfeuer eine Orgie feiert, die Letzteren an die schöne Zeit erinnert, die er mit einem Wohnkumpan verbrachte, eine Erinnerung, die Ken auf einen heißen Sommer hoffen lässt; wie Howard, betrunken und stoned, den gleichfalls betrunkenen und berauschten Ken ins Bett lockt, nachdem Marion zu ihrem Ehemann zurückgekehrt ist, und wie Ken Howard zum Fenster hinauswirft, als er, Howards Geschlechtsteil im Mund, bemerkte, in welche Szene er von diesem verwickelt worden war; wie Vince Lopardo mit bloßen Händen in das Kaminfeuer greift, um mit den brennenden Scheiten die Strandvilla anzuzünden, die er für den Tod seiner Tochter verantwortlich macht –: diese Szenen beschäftigen R. nach dem Aufwachen. Gestern hatte er den ganzen Tag mit der Lektüre dieses amerikanischen Paperbackromans zugebracht und eine Theorie dazu entwickelt: »Lesen, um die Regression komplett zu machen«, die Regression, die der Besuch in einer Familie bewirkt.
»Karasek hat einen Reisebericht geschickt«, seufzt Gaston Salvatore, »wollen Sie ihn lesen?« – »Wie ist er denn? Haben Sie ihn gelesen?« – »Nein, ich lese Magnus’ neues Stück.« (»Der Menschenfreund«, nach Diderot; Michel spottete neulich, es werde mit jedem Spieltag Tausende einbringen, »wie ein Spielautomat Geld ausspuckt«.)
»Ich habe Angst«, fährt Gaston Salvatore fort, »dass wir Karasek absagen müssen.«
Am Morgen kamen die Nachrichten, dass im Augustheft 16 Seiten gestrichen werden müssen; dass dies Heft draußen einen Aufkleber mit den wichtigsten Themen bekommen solle; dass am besten in diesem Heft schon die Bilder beschriftet werden, um sie gefälliger zu machen. Dirk Bickel weiß von einem Brief, den der Verleger der Herausgeberin geschrieben habe, im Auftrag der Gesellschafter, ein Brief, von dem er beim Geschäftsführer Papst sogar eine Kopie gesehen habe. Darin stehen diese Forderungen zu lesen.
»Möchten Sie ein Glas Weißwein?«, fragt die Herausgeberin zärtlich Michel, dann Gaston Salvatore, dann den Art Director Bexte, dann R. (mag sein, dass die Reihenfolge anders verlief).
Die Konferenz ist fast vorbei. Welche 16 Seiten gekürzt werden, war schon vorher genau beschlossen, die Beschriftung der Bilder hat viel Spaß gemacht; Bexte schlägt statt des Aufklebers eine Banderole vor, dafür wurden Schlagzeilen zur Feuilleton-Reise von Rainald Goetz, zum Anthony-Blunt-Porträt und zur Seveso-Katastrophe entwickelt – Bodo Kirchhoffs Bericht über seine Äthiopienreise, den die Herausgeberin sogar mit dem Autorennamen außen drauf sehen wollte, verschwand, als sie kurz den Raum verließ, dort gleich wieder.
Trotzdem bleiben die Gefühle – ja, was? Herzlich, ein wenig zu innig. Sie benehmen sich wie Kinder, die besonders brav sein wollen, nachdem sie etwas ausgefressen haben und bestraft worden sind. Mit der Pointe, dass die Rollen von Strafenden und Bestraften ineinander verschwimmen.
Читать дальше