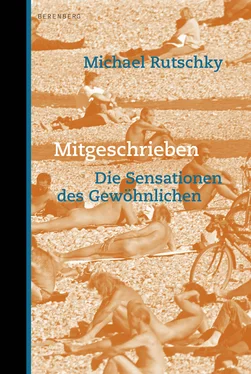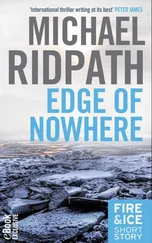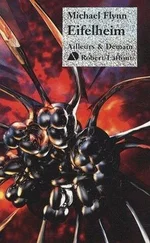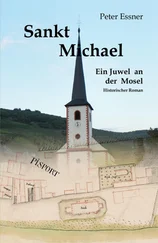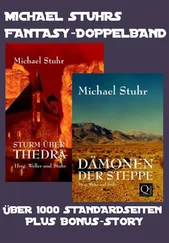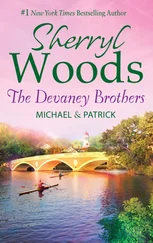Goetz und R. trinken noch ein Bier zusammen; dann fährt er mit seinem alten Mercedes-Diesel zu einem Punkfest in der Nähe von Nürnberg.
Kathrin bringt aus dem Briefkasten eine Todesanzeige mit. Dieter Garbrecht, am 29. April auf einer Urlaubsreise in New York verstorben (»der Tag, an dem wir die elektrische Schreibmaschine kauften«). Schockhaft entsteht ein Gefühl der Leere, des Unglaubens, der Unwirklichkeit; »das also nennt man fassungslos«.
R. will Genaueres wissen; Kathrin hält es, was den Schock angeht, für wirkungslos. Nachmittags versucht R. Michael Schröter zu erreichen, er ist aber nicht da. Dann ruft R. doch Annette Garbrecht an: Dieter Garbrecht erlitt einen Gehirnschlag und stürzte unglücklich. Er zog sich so schwere Schädelverletzungen zu, dass er drei Wochen bewusstlos im Krankenhaus lag.
Es ist gut, dass er starb, denn die Hirnschäden wären irreparabel gewesen.
Mittags bricht Kathrin überstürzt nach Frankfurt auf: um Margarete Freudenthal (Gred Sallis) zu interviewen, die schon nächste Woche nach Israel zurückkehrt. Außerdem wird heute der Juttavater operiert, und sie hat versprochen, danach eine Woche in Kassel zu verbringen.
Abends fährt R. mit M. und dem Hund nach Schleißheim, um ihren Geburtstag mit einem Essen zu feiern. Aber die Schlosswirtschaft hat heute geschlossen – was R. irgendwie ahnte. Bleibt der Frankenhof in der Karl-Theodor-Straße; M. isst mit Appetit – »nur dass das Artischockengemüse zu salzig ist« – trotzdem fühlt R. sich irgendwie impotent, weil er ihr nicht mehr bieten konnte.
Um 22 Uhr – sie sehen im österreichischen Fernsehen einen schlechten französischen Krimi mit Romy Schneider und Maurice Ronet – ruft nicht, wie verabredet, Kathrin an, sondern der Juttabruder. Sie sei nicht bei ihnen eingetroffen, ob sie sich bei R. gemeldet habe?
Um 22.30 Uhr ruft sie dann endlich selber an, manisch erregt, und startet einen Redeschwall. Wie sie mit der alten Dame sofort in ein intensives Gespräch geraten sei. Dass Margarete Freudenthal im Frankfurter Bahnhofsviertel in einem Hotel mit haut gôut untergekommen sei. Dass ihr zweiter Mann vor wenigen Jahren mit 94 gestorben sei. Dass das Opfer offensichtlich der Sohn sei, der, von Depressionen gelähmt, in Australien vegetiere, und so weiter.
Dieter Garbrechts Mutter fragt Annette Garbrechts Vater, ob sie noch ein Valium nehmen dürfe. Sie habe bereits ein anderes Beruhigungsmittel geschluckt – bei der Übermittlung von dessen Namen entstehen Schwierigkeiten. Annette Garbrechts Mutter gibt Dieter Garbrechts Mutter das Valium, das diese mit einem Schluck Wasser hinunterspült, bevor Annettes Vater auf die Frage hat antworten können (er ist gar kein Arzt). »Was hast du da geschluckt?«, fragt ihr Ehemann (sie ließ sich von ihm heiraten nach dem Tod seines Vaters, pflegte Dieter Garbrecht zu spotten, weil der Mann schon glücklich wäre, wenn er ihr bloß die Füße küssen dürfte). »Was hast du da eben genommen?« – »Valium.« – »Was?« – »Valium.« – »Hat nicht der Arzt gesagt, du darfst nicht …?« – »Ach was. Es hat mir schon damals, als Dieters Bruder starb, sehr geholfen. Ich will hier doch keine Szene machen.«
Das ist die Szene. Sie spielt im Restaurant Krohn, dem Eingang zum Hamburger Friedhof Ohlsdorf gegenüber, kurz vor der Beerdigung.
Trotz der Szene mit seiner Mutter will R. das Lächerliche, Gezierte, manchmal geradezu Tuntenhafte von Dieter Garbrecht nicht richtig vorstellbar werden. Dass er tot ist und – in welcher Haltung? mit welchem Gesicht? – in dem Sarg da liegt, das lässt sich mit keinem Bild des lebendigen Mannes verknüpfen.
»Ich habe gestern Abend noch mit Goetz telefoniert«, erzählt R., »er hat es schwer bereut.«
Er habe sowohl Enzensberger als auch Salvatore, erzählt Michel, telefonisch die Leviten gelesen wegen ihres Auftritts am Mittwoch; Enzensberger sei einverstanden mit seinem, Michels, Vorschlag, die Buchmessen-Passage so zu fiktionalisieren, dass die Redaktion unerkennbar bleibt, eine Prozedur, der Goetz bereits zugestimmt hat.
Im Übrigen, so Michel, habe er Goetz’ Argumente genauso schlecht gefunden wie die aller anderen, aber ihm habe die Haltung gefallen: die Reportage über das Feuilleton lieber zurückzuziehen, als eine wichtige Passage daraus zu streichen.
Von Salzburg kommend, sind sie wieder über die »Deutsche Alpenstraße« nach Reit im Winkl gefahren.
M. erinnert sich, wie befriedigend sie seinerzeit die Weihnachtsferien fand, welche die Familie hier, statt zu Hause, verbrachte; wie sie während der Anreise im Zug die Frauen mit den vollen Einkaufstaschen betrachtete und sich freute, dass sie dies Jahr nicht dazu gehöre. Dass Vater und Sohn unter dem Aufenthalt litten, habe ihr nichts ausgemacht.
Sie sitzen im Hotel zur Post, und R. erinnert sich, hier an verschiedenen Abenden mit dem Vater Bier getrunken zu haben, während M. sich anderswo amüsierte – gewiss ist das Phantasie: Es wird nur ein einziger Abend gewesen sein, an dem sie, womöglich, ein Bauerntheater besuchte, das Vater und Sohn verschmähten in ihrer depressiven Verstimmung.
Dann telefoniert R. mit Kathrin: Dem Juttavater geht es schlecht, weil die Leber nicht arbeitet; zwar sprach sie heute länger mit ihm, aber die Vergiftung machte ihn konfus: Er weinte, weil er seiner Frau so schwer unrecht getan habe – Kathrin und Jutta konnten ihn nicht davon überzeugen, dass er phantasiere.
Gestern lag eine Ansichtskarte im Kasten. Ein junger Mann mit platinblonder Perücke, ausgestopften Brüsten, einer Schärpe »Miss America« quer über dem grellbunten Kleid, hält ein Schild hoch: »Not Every Boy Dreams of Being a Marine.«
Abgestempelt ist die Karte: »Boulder, Mar 27‚ 81, Colo«. Der Text: »Von der großen US-Tour Grüße. Ich finde es unglaublich aufregend. In NY könnte ich wohl leben. Herzlich Dieter.«
Vor drei Wochen starb er in der Stadt, von der jetzt zu lesen ist, dass er dort gern leben würde.
Warum Achim nicht schreibe in der Zeitschrift? Sie sind von der Schlosswirtschaft, Schleißheim, ins Rolandseck, Schwabing, gewechselt, was mehr Alkohol ermöglicht, weil Autofahren unnötig ist.
Achim erklärt, wie er jeden Tag mehr Zeit in der Redaktion verbringt, als er eigentlich müsste; wie ihm daraus das Gefühl entsteht, er habe sich »ohnehin schon viel zu weit eingelassen«. Wie er abends vor allem lesen muss (was er schon den ganzen Tag getan hat): Er macht sich ein Abendessen aus belegten Broten und liest bereits, während er es verzehrt, »wenn es nichts mehr zu lesen gäbe, müsste ich sterben«. Wie soll er da zum Schreiben kommen?
Während er das nächste Kapitel schreibt, plagen R. wieder einmal tiefe Zweifel an dem Buch. Was ihn freilich nicht vom Schreiben abhält. Er pflegt diese Art von Zweifeln zu den »masochistischen Phantasien« zu rechnen, die ihn oft heimsuchen (wie neulich die Flugangst, als es von Frankfurt zurück nach München ging). Den ganzen Tag ist Musik zu hören, Purcell, »Dido und Aeneas«; Satie, frühe Klavierstücke; Mahler, dritte, vierte, fünfte Symphonie, »Das Lied von der Erde«, »Kindertotenlieder«. Abends hat R. das Kapitel fertig; es fühlt sich, wie immer, roh und misslungen an. Aber merkwürdigerweise kann er sich gleich daranmachen, das nächste zu präparieren, bis, nach 22 Uhr, das Fernsehprogramm eingeschaltet werden darf.
Gegen halb sieben Uhr morgens holt Achim ein Exemplar seiner Schlüssel ab, das er am Samstag für den Notfall hier erneut deponiert hatte – Kathrin händigt ihm die Schlüssel aus, R. verharrt im Halbschlaf.
Er verlor, wie er später erzählt, sein ganzes Schlüsselbund bei einem Zug um die Häuser – wovon er am Samstag proklamiert hatte, dass es nie wieder vorkommen werde.
Am Nachmittag ruft R. ihn zu Hause an: Ja, er sei nicht ins Büro gegangen, wegen des Katers, insbesondere des moralischen.
Читать дальше