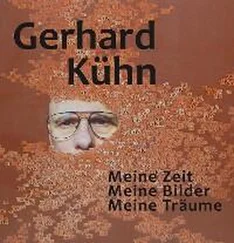Sammy Gronemann - Erinnerung an meine Jahre in Berlin
Здесь есть возможность читать онлайн «Sammy Gronemann - Erinnerung an meine Jahre in Berlin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Erinnerung an meine Jahre in Berlin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Erinnerung an meine Jahre in Berlin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Erinnerung an meine Jahre in Berlin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Sammy Gronemann wurde 1875 als Sohn eines Rabbiners geboren. Nach dem Jurastudium ließ er sich als Anwalt in Berlin nieder und bestätigte sich mit Erfolg als Schriftsteller. Er zählte zu den führenden Köpfen der zionistischen Bewegung. 1933 emigrierte er zunächst nach Paris, dann nach Tel Aviv, wo er 1952 starb.
Erinnerung an meine Jahre in Berlin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Erinnerung an meine Jahre in Berlin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ein jüdischer Restaurateur wollte in dem ostjüdischen Viertel um die Dragonerstraße herum ein rituelles Restaurant eröffnen. Der Polizeipräsident verweigerte die Konzession mit der Begründung, daß in dieser Gegend schon genügend Gastwirtschaften vorhanden seien, und er die Bedürfnisfrage verneinte. Ich klagte beim Bezirksausschuß gegen den Polizeipräsidenten mit der Begründung, daß es sich hier um eine Gaststätte besonderer Art, nämlich um ein rituelles Restaurant handle. In der Verhandlung las mir der Vorsitzende Stadtrat Schulz eine von ihm eingeforderte Auskunft der Berliner Jüdischen Gemeinde vor, in der Herr Dr. Ismar Freund als Vertreter der Gemeinde erklärte, der betreffende Restaurateur stände nicht unter Aufsicht der Gemeinde, so daß also der Betrieb von ihr aus nicht als rituell bezeugt werden könne. „Ja“, sagte der Herr Stadtrat, „damit entfällt Ihre Begründung, Herr Rechtsanwalt.“ Ich stutzte einen Moment, denn wie sollte ich diesem christlichen Richter klarmachen, daß es rituelle Betriebe geben könne, ohne daß die Aufsicht eines Gemeinderabbinats existiere. Ich half mir, indem ich sagte: „Herr Stadtrat, ich werde Ihnen eine Analogie geben. Es gibt doch eine Menge junger Mädchen, die nicht unter Kontrolle stehen und auch sehr nett sind.“ – Dieses Beispiel leuchtete ihm ein, und mein Klient erhielt eine Konzession.
VI.
Im Sommer 1909 fuhr ich mit meiner Frau zu deren Eltern auf die „Datsche“ im ukrainischen Urwald. Wir kamen auf der kleinen Station Korostyn zwischen Kowel und Kiew in sehr früher Morgenstunde an. Dort, an dem Verladeplatz des Holzes aus dem Walde meines Schwiegervaters, wurden wir mit einem prächtigen Frühstück empfangen und fuhren dann einige Stunden durch den märchenhaften Wald zu dem Landhaus. Das lag nun also stundenweit von jeder Siedlung entfernt, ganz einsam, und nur die Familie nebst Dienerschaft, die in einem besonderen Hause wohnte, bildeten meinen Umgang. Für mich war das ein vollkommen neues und unbekanntes Leben. Nie war ich in eine derartig enge Berührung mit der Natur gekommen, und ich wanderte staunend zwischen dem Baumriesen umher. Schon morgens ganz früh in Tallis und Tefillen erging ich mich in einem merkwürdigen Wohlgefühl, so ungestört mich als Jude der „Welt“ präsentieren zu können. Vor der Tür auf der Terrasse wurde schon der Samowar gezündet, der den ganzen Tag brannte, und an den sich jeder Ein- und Ausgehende im Vorübergehen selbst bediente. Herrlich war es, vor dem Hause zu frühstücken, dabei die fleißigen Spechte und Meisen in ihrer Arbeit an den Bäumen zu beobachten, und wie nett war es, wenn etwa Eichhörnchen aus dem Walde heranhüpften und zutraulich am Frühstück teilnahmen. Welche Freude für die Kinder, wenn solch ein Tierchen ihnen auf die Schultern kletterte. Ich bewunderte die riesigen Ameisenhaufen und sonstige Fauna des Waldes, und bei den langen Spaziergängen traf ich kaum jemals einen Menschen. Ja, einmal stieß ich auf einen alten russischen Bauern, der mich freundlich begrüßte. Da ich kein Wort russisch verstand, half ich mir pantomimisch und gab ihm eine Zigarre, die er zu meiner Verblüffung grinsend und mit Wohlbehagen – zu verspeisen begann. In diese Weltabgeschiedenheit war offenbar noch nie eine Zigarre gelangt. – Alles dort war mir neu. Ich hatte eben der Natur nie so unmittelbar gegenübergestanden wie in jener Zeit. War ich doch in der Großstadt aufgewachsen, und hatte ich doch kaum je Gelegenheit gehabt, die Welt wirklich, wie sie Gott geschaffen hat, kennenzulernen. Hier befand ich mich mitten in einem jungfräulichen Wald. Er war wundervoll, gewaltig, herrlich schön, – ich empfand ja die Schönheit und die Majestät der Natur, aber ich weiß nicht, was es war, es sprengte mir fast das Herz. Ich war überwältigt und wurde regelrecht melancholisch. Ich verlor meinen gesunden Schlaf, meine Laune, entlief fast immer meiner Umgebung und streckte mich einsam irgendwo im Walde hin, unfähig zu denken, ganz und gar mich dieser rätselhaften Depression hingebend. Die Meinen waren recht beunruhigt, und meine sehr gescheite Schwiegermutter erklärte, daß sie das nicht länger mit ansehen könnte, ich würde da vollkommen gemütskrank, und wir beschlossen, daß ich den auf Monate berechneten Aufenthalt abbrechen und auf Reisen gehen sollte.
Meine Reise ging zunächst über Kiew nach Odessa. Stundenlang fährt man da durch die Steppe, ohne ein Haus, oft auch nur einen Baum zu sehen, und gerade diese Eintönigkeit bietet wieder ein besonderes Interesse.
Odessa war für mich recht interessant. Die große steinerne Treppe, die in dem Film „Potemkin“ eine solche Rolle spielt, daß Treiben auf der prachtvollen Strandpromenade, dem Nikolai-Boulevard und Alexanderpark waren anziehend genug. Mit Erstaunen bemerkte ich im jüdischen Restaurant, daß die Jugend dort im allgemeinen weder Hebräisch noch Jiddisch verstand, sondern ganz russifiziert war. Es ist ein eigenartiges Gefühl, im Gewühl herumzuspazieren, wenn man kein Wort der Landessprache versteht, und es war für mich ein interessanter Sport, mit Hilfe meiner Sprachführer, und noch mehr durch Pantomime, mich mit allerhand Leuten zu unterhalten. In dem sehr eleganten Hotel, in dem ich abgestiegen war, sprach man freilich deutsch, französisch, englisch und jiddisch. Ich stand morgens vor dem Hotel und sah mir das Treiben an, als der Geschäftsführer dienstbeflissen an mich herantrat, ob er mir bei Einkäufen behilflich sein könne, ob er mir einen Wagen besorgen solle oder vielleicht Theaterbillets, ob ich weibliche Gesellschaft auf’s Zimmer wünsche (unter „Commodité“ auf Rechnung zu setzen). Er war recht enttäuscht, als ich auf keinen dieser verlockenden Vorschläge einging, und grübelte angestrengt, was er mir noch offerieren könne. Endlich kam ihm eine Erleuchtung: „Haben Sie schon Schekel gezahlt?“ – Der Mann hatte eben alles auf Lager. – Nachdem ich von Odessa genug hatte, fuhr ich nach Rumänien über die Grenzstation Ungheni, vorbei an Kischineff, das traurige Erinnerungen an den Progrom von 1903 erweckte. Unterwegs machte ich die Bekanntschaft eines ungarischen höheren Eisenbahnbeamten, eines alten Junggesellen, der sich als Lebemann aufspielte und mir allerhand seltsame galante Erlebnisse, die er in Berlin gehabt haben wollte, erzählte. Ich habe ihm wie noch zu berichten ist, später auch ein erstaunliches, kleines Abenteuer verschafft. – In Russisch Ungheni im Wartesaal geschah es, als ich zur Verständigung mit dem Kellner in einem Polyglott Kunze blätterte, daß der Kellner hinter das Büffet sprang und nun auch mit dem gleichen Sprachführer – bloß russisch-deutsch statt deutsch-russisch – erschien, wonach dann die Verständigung leicht vor sich ging. – Nun fuhren wir mit der kleinen Vicinalbahn zu dem eine Stunde entfernten rumänischen Ungheni. Kurz vor der Station hielt auf offener Strecke der Zug, und über das Feld kamen mehrere in Zivil gekleidete Herren, gefolgt von einigen Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett. Die Herren gingen den Zug entlang, ließen sich die Pässe zeigen, auf die sie irgendeinen Stempel drückten und zurückgaben. So geschah es auch im letzten Abteil mit meinem Reisegefährten. Meinen Paß aber sah sich der Beamte mißtrauisch an und fragte mich, woher ich käme. Ich sagte: „Von Iskorost.“ – „Wo liegt das?“, fragte er. (Die Unterhaltung wurde französisch geführt). Ich sagte: „Bei Korostyn.“ Auch dieser Ort war ihm erstaunlicherweise unbekannt. „Und wo liegt das?“ – Ich sagte: „Bei Uschomir.“ – Er blieb eine Weile nachdenklich und stellte dann die erstaunliche Frage: „Haben Sie schmutzige Wäsche?“ Ich antwortete ahnungslos: „Ja, natürlich.“ – „Gut“, sagte er, und statt mir meinen Paß zurückzugeben, gab er ihn einem Soldaten und erklärte mir: „Auf der Station werden Sie ihre Anweisungen für die Quarantäne erhalten.“ Ich bekam keinen kleinen Schreck, – meine Verulkung hatte schlechte Wirkungen hervorgerufen – aber schon hatte er sich umgedreht, gab auf rumänisch dem Soldaten Anweisungen, und einer der Krieger stellte sich auf das Trittbrett vor meinem Fenster, während der Herr sich, höflich den Strohhut lüftend, entfernte. Wenige Minuten darauf standen wir in der Station, und mein militärischer Begleiter lieferte mich im Stationsbüro ab. Dort saß ein korrekter Herr, der mich den Koffer öffnen ließ, ihn durchsah und dann erklärte: „Sie werden unter Eskorte nach Bukarest kommen in das Spital, und nach drei Tagen, wenn sich nichts Verdächtiges zeigt, werden Sie entlassen.“ – Ich versuchte, ihm das auszureden, aber er erklärte: „Mein Herr, meine Vorschriften sind streng. Ich kann davon nicht absehen.“ Ich sah, daß ich es anders versuchen mußte. Den Weg der Korruption zu beschreiten, traute ich mich damals nicht, – ich sagte: „Also gut, dann ist nichts zu machen, wenn Ihre Instruktionen so formell sind. Aber sagen Sie mir bitte, was haben Sie dort für einen Kachelofen?“ Er war nun seinerseits recht erstaunt und fragte mich, wieso mich das interessiere. Ich erklärte ihm, ich wäre Korrespondent großer Berliner Zeitungen und sammle folkloristisches Material. Ich würde natürlich auch über die Ergebnisse hier interessante Berichte schreiben. Er stutzte etwas. Offenbar war es ihm nicht ganz recht, wenn ich von Grenzschikanen berichten würde. Aber ich ließ ihm gar keine Zeit, sondern verwickelte ihn in ein allgemeines Gespräch. Nach einigen Minuten saßen wir am Tisch, und ich erzählte unaufhörlich allerhand Anekdoten. Er hatte sich wohl an diesem Posten lange nicht so gut unterhalten, und wir waren bald gute Freunde. Als dann der Zug nach Bukarest einlief und meine Wache mich in Empfang nehmen wollte, sagte ich, ihm nun auf die Schulter klopfend: „Nun, jetzt sind wir doch gute Freunde. Können Sie wirklich nichts für mich tun?“, worauf er lachte, dem Soldaten den Paß abnahm und mir gute Reise wünschte. Ich sah wieder einmal, daß man mit Humor und guten Witzen oft die schwierigste Situation überstehen kann. Mein Reisegefährte, der ungarische Beamte, war sehr glücklich, mich wieder zu sehen. Wir machten Station in Jassy. Wir kamen dort 2 Uhr mittags an, und unser Zug ging erst abends um 6 Uhr weiter. In einem Caféhaus erfrischten wir uns, – es war ein glühendheißer Tag. Ich fragte den bedienenden Kellner, wie es Dr. Lippe gehe (dem Alterspräsidenten des I. Kongresses) und erhielt befriedigende Auskunft. Mein Reisegefährte, Herr Komarow, war erstaunt, daß ich auch in Jassy Bekannte hatte. Aber er sollte noch mehr erstaunen. Ich trennte mich von ihm, da ich das Judenviertel besichtigen wollte, und wir verabredeten ein Treffen am Bahnhof kurz vor sechs. Ich wanderte nun durch das Judenviertel, Straßen auf Straßen voll Trödlerläden. Ich hatte den Eindruck, daß die Juden von Jassy davon leben, daß sie sich gegenseitig alte Hosen verkaufen. Dann bestieg ich die Straßenbahn, um auch andere Teile der Stadt zu besichtigen. Neben mir saß eine höchst anziehende junge Dame. Ich hielt meinen Reiseführer aufgeschlagen in der Hand und fragte naiv, als wir an einer schmutzigen, zerfallenen Kaserne vorbeikamen, ob das die Kathedrale sei. Sie war ziemlich verblüfft und versuchte, mich aufzuklären. Als ich dann aber, als wir an einer stattlichen Kirche vorbeikamen, auf meinen Plan deutend frug, ob das die Kaserne sei, gingen ihr die Augen auf, und sie fragte mich, ob ich sie verulken wolle. Ich sagte entrüstet: „Ich kann mir nicht denken, daß Sie das jetzt erst merken.“ Sie meinte: „Wenn Sie die Stadt sehen wollen, müssen Sie sich einen Wagen nehmen und sich führen lassen.“ – „Also führen Sie?“, sagte ich. Sie lachte, – und bald saßen wir in einem Wagen und begannen eine Rundfahrt, bei der sie mir die nicht allzu zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt zeigte. Diese Wagenfahrt war in jeder Beziehung ein Genuß. So herrliche Pferde wie hier und in Bukarest habe ich kaum je gesehen, und die Kutscher, feist und glattrasiert, – durchweg Eunuchen – in den samtenen langen Kitteln mit den seidigen Schärpen bilden eine Sehenswürdigkeit für sich. Sie bilden eine besondere Sekte unter dem Namen „Lipovaren.“ Auf dieser Fahrt kamen wir gleich zu Anfang an einem Gartenlokal vorbei, und dort saß eine große Gesellschaft von jungen Leuten und Damen an langen Tischen. Als sie des Wagens und meiner Begleiterin ansichtig wurden, entstand ein großes Hallo, der Wagen wurde angehalten, man umringte uns, und erst allmählich entnahm ich dem Gesprächswirrwarr, daß es eine Gesellschaft von Studenten der Universität und daß meine Begleiterin eine Assistenzärztin eines dortigen Professors war. Sie erzählte ihrer Gesellschaft, wie sie an mich geraten war, und die jungen Leute beschlossen, alle mir die Eskorte zu geben. Sie bestiegen die wartenden Wagen, und so kam es, daß ich vor sechs an der Spitze einer großen Wagenprozession vor dem Bahnhof landete, wo mich Herr Komarow erwartete. Er war ziemlich erstaunt, daß ich so schnell Bekanntschaft in Jassy gefunden hatte. Ich stellte den alten Herren als meinen Onkel vor und erklärte ihm, daß die Damen der Gesellschaft alles meine Cousinen, also auch seine Verwandten seien, und er war ganz erstarrt, als die jungen Damen ihn umringten und abküßten. – Daß meine Depression sich inzwischen einigermaßen gegeben hatte, geht aus dieser Erzählung vielleicht zur Genüge hervor.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Erinnerung an meine Jahre in Berlin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Erinnerung an meine Jahre in Berlin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Erinnerung an meine Jahre in Berlin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.