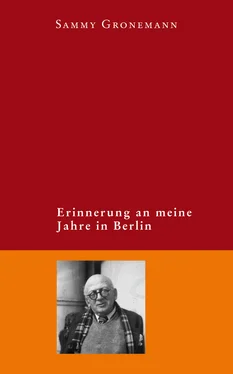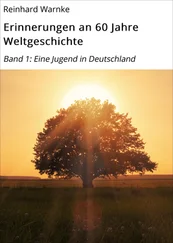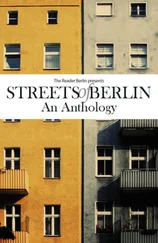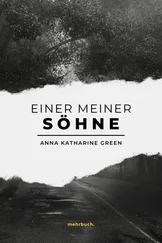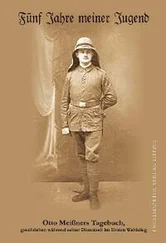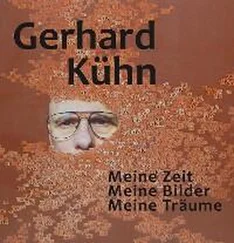1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Während jenes Kongresses wurde auch der „Kulturverband jüdischer Frauen für Palästina“ gegründet, der dann Jahre hindurch unter der Leitung von Betty Leschinsky und meiner Frau gewirkt hat, bis sich dann später daraus die „WIZO“ entwikelte. Dieser Kulturverband hat Jahre hindurch ausgezeichnete praktische Arbeit geleistet. Die von ihm ins Leben gerufene palästinensische Spitzenindustrie hat für unser Werk viele Freunde gewonnen. Die Erzeugnisse wurden überall hin versandt und fanden viel Beifall. Es war kurios zu sehen, wie so viele jüdische Frauen, denen man vergebens von all dem Großen erzählte, was in Palästina geschah, wenn ihnen ein kleines Spitzentüchlein gezeigt wurde, enthusiasmiert wurden. Das war eigentlich ein Beweis dafür, wie wirklich irgendwelche praktischen Erfolge, etwas, was man zeigen kann, durchschlagender wirken als die schönsten Theorien.
Auf diesem Kongreß wurde auch auf Antrag von Nahum Sokolow die hebräische Sprache als offizielle Sprache des Kongresses und der Bewegung anerkannt, wenn auch nur unter Widerständen. Bemerkenswert ist, daß Sokolow bei anderer Gelegenheit auf dem Kongreß, als man von ihm verlangte, er solle hebräisch und nicht deutsch reden, sich dagegen erklärte, mit der hebräischen Sprache zu demonstrieren. Er sagte, die Zeiten seien vorüber, wo man das für gut gehalten hätte.
Der Kongreß endete, wie gesagt, mit einem Sieg Wolffsohns über die Opposition, und Wolffsohn freute sich beinahe kindlich über seinen Erfolg. Der wurde dann auch ausgiebig gefeiert. Wolffsohn und ein Teil der Delegierten blieben noch einige Wochen in Scheveningen, und ich kann mich kaum an angenehmere Wochen als die, die wir dort verlebten, erinnern. In dem jüdischen Restaurant Keyl war eine vergnügte Tafelrunde täglich vereint, zu der neben dem Ehepaar Wolffsohn die Leschinskys und Sokolow, Alexander Marmorek, Schmarjahu Levin, der Maler Pilichowski und einige holländische Freunde gehörten. Wir speisten in der Glasveranda, und Neugierige drückten sich ihre Nasen an den Fensterscheiben platt, um den jüdischen Hofstaat anzustaunen. Levin, Pilichowski und ich aber heckten täglich neue übermütige Streiche aus. Wenn wir abends in irgendeinem Caféhaus saßen, zahlte immer Sokolow, und dann wurde die Summe repartiert. Wir verstanden es aber stets, ihn durch Zwischenbemerkungen so konfus zu machen, daß er die Rechnung unzählige Mal von neuem beginnen mußte, was er dann schmunzelnd und in guter Laune auch duldete. Vor allem aber wurde damals von Pilichowski, Levin und mir mit großem Erfolge die sogenannte „Witz-Obstruktion“ betrieben, eine Methode, um unerträgliche Anekdotenerzähler mundtot zu machen. Ich werde mich schwer hüten, das Rezept zu verraten.
Wolffsohn spielte täglich mit Josef Israels einige Schachpartien. Beide taten sich auf ihre Meisterschaft viel zu Gute, spielten aber in Wirklichkeit sehr mäßig. Es ist seltsam zu sehen, wie so viele bedeutende Menschen viel mehr Gewicht auf ihr Hobby oder auf irgendeine Nebenbeschäftigung legen, selbst wenn sie darin nicht Besonderes leisten, als auf ihre wirkliche erfolgreiche Tätigkeit. So war es kurios festzustellen, daß der große Maler Israels auf nichts so stolz war als auf ein kleines Buch, das er über Spanien geschrieben hatte.
Bevor die Gesellschaft auseinander flatterte veranstaltete Wolffsohn bei Keyl ein Diner. Auch Josef Israels hatte sein Erscheinen in Aussicht gestellt und den dringenden Wunsch ausgesprochen, einmal wieder gefüllten Fisch zu essen, ein Gericht, an das sich bei ihm Jugenderinnerungen knüpften. Das gab große Aufregung bei Keyl, da dem holländischen Traiteur dieses Gericht unbekannt war, – aber einen solch berühmten Gast hatte Keyl noch nie bei sich gesehen, und es wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um seinen Wunsch zu erfüllen. Schließlich gab meine Frau das Rezept, ein Spezialbote holte den Hecht aus Rotterdam, und dann verbot der Arzt wegen des schlechten Wetters Josef Israels die Teilnahme. Er bekam aber das Gewünschte in seine Villa geschickt.
So schien der Frieden im zionistischen Lager, zunächst wenigstens, gesichert, und ich konnte mit gutem Gewissen mich meiner Anwaltspraxis widmen. Das tat ich mit großer Lust und Hingabe, denn ich liebte meinen Beruf von ganzem Herzen. Und ich wußte mir, falls ich noch einmal im Wege der Seelenwanderung auf diese Welt kommen sollte, keinen besseren und meinen Anlagen mehr entsprechenden. Ich vermute freilich, daß, wie ich freimütig gestehen will, bei dieser meiner Liebe zur Advokatentätigkeit auch wieder ein nicht eben nur ideales Motiv mitspielen mag, nämlich meine Vorliebe für jede Art Gedankensport. Juristerei – oder besser gesagt Prozeßführung – ist ja im Grunde nichts anderes als eine Art Schachspiel, bei dem an Stelle der Figuren juristische Begriffe treten, und das Spiel wird in beiden Fällen nach ein-für allemal festgesetzten, an sich ganz willkürlichen Regeln gespielt. Wenn der Turm im Schachspiel nur gerade, der Läufer nur schräg gehen darf, beruht das auf einer ganz willkürlich aufgestellten Norm, – an sich könnte es ebensogut umgekehrt sein. Und wenn der Gesetzgeber für manche Handlungen bestimmte Formvorschriften statuiert, oder wenn etwa eine Berufungsfrist auf eine Woche, eine Verjährungsfrist auf drei Jahre festgesetzt werden, ist das nach gewöhnlichen logischen Maßstäben nicht zu begründen. Nach solchen Normen also wird Schach gespielt oder werden Prozesse geführt. Ein bedeutsamer Unterschied besteht freilich: Beim Prozeßführen sind es die Kiebitze, – als solche kann man wohl die Advokaten bezeichnen – die das Spiel machen, während die Parteien zusehen.
Natürlich hat der Advokat nicht nur Denksport zu treiben, sondern er hat die Aufgabe, der gerechten Sache, oder die er als solche erkennt, zum Siege zu verhelfen. Und er hat das volle Recht der Subjektivität, von der im weitesten Umfang Gebrauch zu machen sogar seine Pflicht ist. Seltsam ist und nachdenklich stimmt es, daß die deutsche Sprache Rechtsanwalt und Staatsanwalt in Gegensatz stellt. Recht und Staat, d. h. Recht und Gesetz stehen wirklich in einem gewissen Gegensatz. Das Gesetz humpelt immer hinter der Rechtsentwicklung hinterher. Eine Kodifikation erfolgt regelmäßig erst dann, wenn eine Rechtsanschauung sich bereits allgemein im Bewußtsein des Volkes durchgesetzt hat. In diesem Moment ist ja nun die Rechtsentwicklung schon weiter fortgeschritten, so daß das neue Gesetz dieser wieder nicht entspricht, so daß also, theoretisch gesehen, das Gesetz das Recht nicht einholen kann. Es ist ungefähr die Geschichte von Achilles und der Schildkröte. – Nun hat mich meine Praxis so ziemlich mit allen Schichten der Bevölkerung in Berührung gebracht und allerlei Einblicke in die verschiedensten Milieus eröffnet. Meine Erinnerungen wären nicht vollständig, wenn ich nicht einiges aus diesen meinen Erfahrungen erzählen wollte. Zunächst will ich noch einige Fälle skizzieren, die Einblicke in das Milieu jener aus dem Osten nach Berlin verschlagenen Juden eröffneten, die sich nur schwer in die Sitten und Gebräuche Westeuropas einfügen konnten. Es wird sich dabei nicht immer vermeiden lassen, daß ich auch Dinge erzähle, die schon in früheren Büchern von mir skizziert sind, die aber hier kaum fehlen dürfen.
Da ist es bisweilen schon sehr schwierig, die Identität solch eines Klienten festzustellen. Sehr oft wurden z. B. in Galizien Ehen nur vor dem Rabbiner geschlossen, denen der Staat die Anerkennung versagte, so daß die Kinder aus solchen Ehen offiziell als unehelich galten und eigentlich den Namen der Mutter führen mußten. So stand es auch im Passe. Sie aber nannten sich im Leben nach ihrem Vater. – Da kam einmal zu mir ein Kaufmann namens Förster in Gesellschaft eines mir auch schon bekannten jungen Mannes, der sich Apfelbaum nannte, den er als Reisenden anstellen wollte. Er bat mich, den Vertrag zu machen. Ich stutzte und bat Förster, einige Augenblicke ins Wartezimmer zu gehen, da ich mit Apfelbaum etwas zu besprechen hätte. Förster entfernte sich, offensichtlich befremdet, und ich sagte nun dem Herren Apfelbaum, daß mir ja bekannt sei, daß er gesetzlich den Namen Apfelbaum gar nicht führe, denn er hatte mich mit der Regelung seiner Paßangelegenheit betraut. Ich fühlte mich verpflichtet, erklärte ich ihm, bevor ich den Vertrag formulieren würde, Förster hierüber aufzuklären. Wohl oder übel mußte Apfelbaum sich dem fügen, und ich rief nun Förster herein und setzte ihm, der recht unruhig auf meine Eröffnung wartete, den Fall auseinander, erleichtert atmete er auf. „Ach“, sagte er, „das ist alles? – Meinen Sie, ich heiße Förster?“
Читать дальше