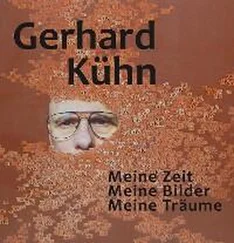Sammy Gronemann
Erinnerungen an meine Jahre in Berlin
SAMMY GRONEMANN
ERINNERUNGEN AN MEINE JAHRE
IN BERLIN
Aus dem Nachlaß herausgegeben
von Joachim Schlör
© e-book Ausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2014
eISBN 978-3-86393-521-4
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung, Vervielfältigung (auch fotomechanisch), der elektronischen Speicherung auf einem Datenträger oder in einer Datenbank, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg der Datenübertragung) vorbehalten.
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeische-verlagsanstalt.de
Vorwort
Erinnerungen an meine Jahre in Berlin
Anhang
Nachwort
Abbildungen
Glossar
„Zu den Bekanntschaften, die ich in jener Zeit gemacht habe, kann ich in gewissem Umfange auch die nähere Bekanntschaft mit mir selbst rechnen, soweit man sich überhaupt selbst kennen lernen kann, will man nicht dazu kommen, jede Beziehung mit sich selbst abzubrechen.“
Sammy Gronemann
„Verzeihen Sie, wenn Ihr Buch weit wertvoller ist, als Sie es haben möchten.“
Otto Abeles
Israel Shilony, geboren in Berlin, hat in den siebziger Jahren eine Versammlung im Van-Leer-Institut von Jerusalem besucht und seinen Eindruck so beschrieben: „Ich konnte mich überallhin umschauen und die Gesichter beobachten. Fast alle waren sehr alte Herrschaften (und erst daraus wurde mir klar, daß ich selber so alt bin...), da saßen sie mit ihren schönen, alten, lebenserfahrenen, kultivierten Gesichtern, es war einfach ein aufregender Anblick! Und dann wurde mir bewußt, daß dies das letzte Mal ist, dieses Gesamtbild wunderbarer Köpfe des deutschen Judentums.“ In diesem Augenblick, so Shilony, wurde ihm klar, „daß ein Museum entstehen muß, um das deutsche Judentum im Bild für das Auge festzuhalten“. Weil Nahariya die einzige Stadt der Welt ist, die von deutschen Juden gegründet wurde, sollte das Museum hier seinen Platz finden, inzwischen ist es nach Tefen in den galiläischen Bergen umgezogen.
Januar 2003. Der Vortragssaal im Goethe-Institut von Tel-Aviv ist gut gefüllt. Im Publikum sitzen Menschen, wie sie von Shilony beschrieben wurden: lebenserfahren, gütig, neugierig. Ich stelle den ersten Band von Sammy Gronemanns Erinnerungen (Berlin 2002) vor, eine Mitarbeiterin des Goethe-Instituts liest einige Stücke aus seinem Buch Schalet . Beiträge zur Philosophie des wenn-schon (1927, Neuauflage Leipzig 1998). Zum Abschluß werden von einem Kassettenrecorder drei Lieder aus dem Musical Shlomo ha-melech we Shalmai hasandlar abgespielt, der Text, von Nathan Alterman ins Hebräische übertragen, beruht auf dem Stück Der Weise und der Narr von Sammy Gronemann. Und auf einmal singen und swingen die Zuschauer im Saal mit. Irgend etwas ist es mit diesem Namen, mit der Erinnerung an diesen Mann – wenn man von ihm spricht, geht ein Lächeln über die Gesichter.
Den „Scholem Aleichem der Jeckes“ hat ihn Schalom Ben-Chorin genannt, und seine Witwe, Avital Ben-Chorin, erinnerte sich bei den Veranstaltungen an die Zeit, als sie mit 16, 17 Jahren als Hausmädchen bei Sammy Gronemann und seiner Schwester Elfriede Bergel-Gronemann in Tel-Aviv arbeitete. In solchen Fragmenten tragen wir die Erinnerungen an den Autor, Anwalt und zionistischen Politiker zusammen. Wir brauchen nicht nur Museen, wir wollen wenigstens die Texte der vertriebenen Autoren wieder lesen können. In einem Seminar an der Universität Potsdam haben Studierende des interdisziplinären Studiengangs Jüdische Studien die Erinnerungen gelesen und sich daran gemacht, Quellen zusammenzutragen, die von den Stationen dieses Lebens berichten, damit diese erste deutsche Ausgabe der Erinnerungen auch verstanden werden kann. Die Ergebnisse sind im Nachwort festgehalten. Ich bedanke mich bei allen, die sich an diesem kleinen Ausbruch aus dem universitären Alltag beteiligt haben. Möge es nützen.
Joachim Schlör
ERINNERUNGEN AN MEINE JAHRE
IN BERLIN
I.
Mich zog’s von Abdera nach Athen. Nicht länger wollte ich in Hannover „an der Leine“ angebunden sein. Mich lockte Berlin: „Spree-Athen.“ Ich fürchtete, unter den Philistern entweder einen Windmühlenkampf zu führen oder, was noch schlimmer gewesen wäre, selbst im Sumpfe des Philistertums zu versinken. Hatte ich mich doch nicht völlig dem ständigen „Frosch-Mäuse-Krieg“ entziehen können, der fortwährend innerhalb der Synagogen-Gemeinde geführt wurde. – Ich war ganz gegen meinen Willen in diese Streitigkeiten verwickelt, und wohl oder übel mußte ich mich dem gesellschaftlichen Rhythmus dort anpassen. „Gott soll schützen vor der Provinz“, sagt der alte Jacobi bei Georg Hermann. Das schlimmste aber ist die große Provinzstadt, die sich wer weiß wie großstädtisch vorkommt. Als ob schnurgerade Straßen und höchst korrekt und symmetrisch angelegte Schmuckplätze es ausmachten. Über die Architektur dieses Hannover ließe sich vieles sagen, – aber dazu ist hier nicht die Gelegenheit. Da hatte der Geheimrat Professor Haase von der Technischen Hochschule, der als eine Art Felix Dahnsche Wotangestalt durch die Straßen der Haupt- und Residenzstadt wandelte, einen neuen Stil erfunden, eine Art neuer gotischer Backsteinarchitektur, deren groteske Abscheulichkeit bei jedem Fremden baß Verwunderung erregte und die er mit dem an sich nicht unschönen niedersächsischen Stil zu verschmelzen suchte. Die Hannoveraner freilich waren auf diesen ihren Stil höchst stolz. – Hübsch war der Stadtwald, die Eilenriede, die freilich mehr Parkcharakter hatte und in der die Stadtverwaltung Orgien der Bevormundung und Ordnung feierte. Alle Bänke hatten Inschriften wie „Für Erwachsene“, „Nur für Kinder“, „Nicht für Kindermädchen“. – Doch gab es dort eine Reihe netter Gartenwirtschaften, zu denen man im Sommer schon in aller Frühe hinausfuhr. In meiner Junggesellenzeit radelte ich täglich mit meiner Schwester schon um halb sieben dorthin, um nur nicht jenen – vorsorglich kalendarisch nicht festgelegten – Tag zu versäumen, an dem den Stammgästen gratis Erdbeeren mit Schlagsahne verabfolgt wurden. Dieser Stadtwald lag im Osten der Stadt, anschließend an das vornehme Wohnviertel. Beiläufig bemerkt, ist es wohl die einzige Stadt, in der das Villenviertel im Osten liegt, – sonst gilt ja immer der Westen als vornehm, – warum, ist mir nie aufgegangen. (Vielleicht deshalb, weil man im Westen länger schlafen kann?) – Am andern Ende der Stadt, im Westen, führte die 2 km lange Herrenhäuser-Allee vorbei an dem alten Welfenschloss, umgebaut zur Technischen Hochschule, zum Herrenhäuser Park, dessen langweilige Taxushecken-Anlagen, nach Versailler Muster angelegt, an vergangene Herrscherpracht erinnerten. Gegenüber dem Welfenschloss aber, an der anderen Seite der Allee, lag der Georgen-Garten, eine schöne englische Parkanlage, und dort in der Kaffeewirtschaft trafen sich nachmittags, besonders am Sabbat-Nachmittag, eine Anzahl jüdischer Honorationen. Es war, man denke, eine Wirtschaft mit biblischer Bedienung. Dort servierten freilich nur eisgraue alte Damen den Kaffee. Erfreulicherweise gab es aber in der Stadt auch anders geartete Lokalitäten mit weiblicher Bedienung, in denen eben jene Stützen der Gemeinde zwar gern verkehrten, aber nach Möglichkeit vermieden, sich zu begrüßen oder zu erkennen. Ich freilich machte mir immer ein besonderes Vergnügen daraus, wenn ich etwa im „Bienenkorb“ solche Würdenträger fand, sie mit besonderer Herzlichkeit laut zu begrüßen, was nicht immer mit gleicher Herzlichkeit erwidert wurde.
Sabbat war der Synagogenbesuch unerlässlich, und nachher, zwischen zwölf und eins, setzte die große Besuchsparade ein. Mit langem Gehrock und unvermeidlichem Zylinderhut auf dem Kopf, am Arm die festtäglich gekleidete Frau, wandelte man die Straßen entlang, um die pflichtschuldigen Besuche zu absolvieren. Und es wurde da genau Rechnung geführt. Auch ich und meine Frau konnten uns diesem Brauche nicht entziehen, so stumpfsinnig diese Besuchstouren auch waren. Bis ich dann endlich auf eine erlösende Idee kam: Wir zogen, vorschriftsmäßig adjustiert, los, aber versteckten uns bald in irgendeinem Hauseingang und beobachteten die vorüberziehenden Paare. Wie wir nun ein solches Paar entdeckten, dem wir solchen Besuch „schuldig“ waren, suchten wir schleunigst die betreffende Wohnung auf, um mit dem Ausdruck unseres lebhaften Bedauerns, die Herrschaften nicht getroffen zu haben, unsere Karten abzugeben. So konnten wir uns dann oft an einem Vormittag einer großen Schuldenlast entledigen.
Читать дальше