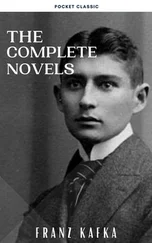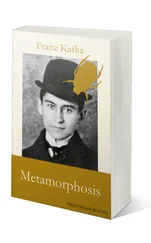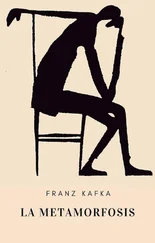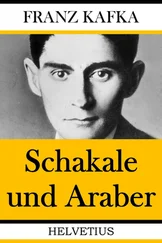Das Stakkato der Schreibmaschinenmusik verklang, die Kolleginnen wünschten einander wie immer einen schönen Feierabend, die Räume der Lindström AG leerten sich, doch Felices Arbeitstag war noch nicht zu Ende. Sie hatte sich vor Kurzem auf eine Kleinanzeige im Tageblatt gemeldet, da suchte jemand eine tüchtige Schreibkraft in Nebentätigkeit für die Abendstunden, das passte. Felice wurde bei einem Professor vorstellig, der schnell erkannte, welch hoch qualifizierte junge Frau er engagiert hatte. Dreimal die Woche wurde vereinbart, Felice konnte sofort anfangen. Während ihr der Professor mit sonorer Stimme naturwissenschaftliche Abhandlungen diktierte, von denen sie nur Bruchstücke kapierte, flogen ihre flinken Finger mechanisch über die Tastatur einer Remington. Kein Wunder, dass Felice der Sinn wenig nach Briefeschreiben stand, wenn sie am fortgeschrittenen Abend nach Hause kam, die Hand ins Kreuz gestützt wie eine alte Frau. Sie lehnte sich mit dem schmerzenden Rücken an den warmen Kamin, um sich etwas Linderung zu verschaffen, im Bett fielen ihr sofort die Augen zu. Als die Fakturistin bei Lindström krank wurde und Felice auch noch deren Arbeit übernehmen musste, bekam sie zu allem Überfluss Ärger mit der Mutter, die zeterte, als sei Felice auf krummen Pfaden unterwegs gewesen: Jetzt kommst du erst nach Hause? Weißt du eigentlich, wie spät es ist, Felice? Alle Handarbeiten bleiben liegen, soll ich etwa den Pullover für Ferri fertigstricken? Der gereizte Ton der Mutter war nicht zu überhören. Die selbstständige Tochter entzog sich ihrer Kontrolle, und dann auch noch diese Gestalt aus Prag, von der man nichts Genaues wusste. »Ihr letzter Brief ist so nervös«, schrieb Franz, »dass man das Verlangen bekommt, Ihre Hand einen Augenblick lang festzuhalten.«
Ja, gerade jetzt hätte Felice dringend einen Vertrauten in ihrer Nähe gebraucht, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. Aber Händchenhalten war ein Kunststück zwischen Spree und Moldau, und was nutzte es schon, Franz mitzuteilen, dass sie gern Strindberg las, oder ihm Anekdoten der Bürokolleginnen zum Besten zu geben, wenn sie über das Wichtigste, was sie beschäftigte, über Ernas missliche Lage, schweigen musste wie ein Grab? Franz reinen Wein einschenken, viel zu riskant. Nicht auszudenken, wenn er mit seinem Antwortbrief in deutlichen Worten auf die derzeitige Situation einginge. Felice hatte ihre Mutter ja bereits dabei ertappt, wie sie unter dem Vorwand, nur eine Briefmarke zu suchen, neugierig in ihren privaten Papieren herumkramte, als sei ihr Schreibtisch ein offener Zeitungskiosk. Auch Toni war schon mal mit hochrotem Kopf aus Felices Zimmer hinausgeschlüpft, als die früher als erwartet nach Hause kam, weil der Professor ausfiel. Noch schlimmer wäre, wenn Franz’ Mutter Wind von der Sache bekäme und das Geheimnis der beiden Schwestern auf dem Umweg über Prag nach Berlin vordringen würde.
Unwahrscheinlich war das nicht. Erst vor ein paar Wochen, Mitte November, hatte wieder ein Brief aus Prag auf Felices Schreibtisch gelegen, doch die Schrift auf dem Kuvert war nicht die gewohnte. Felice riss den Brief auf, unterschrieben hatte Julie Kafka. Wie kam die Frau dazu, ihr zu schreiben?
»Ich habe durch Zufall einen an meinen Sohn adressierten Brief vom 12/11 datiert und mit Ihrer w. Unterschrift verseh’n zu Gesicht bekommen. Ihre Schreibweise gefiel mir so sehr dass ich den Brief zu Ende las, ohne zu bedenken, dass ich dazu nicht berechtigt war.« Felice versuchte sich zu erinnern, was sie an jenem 12. November an Franz geschrieben hatte, vielleicht vom bevorstehenden Firmenjubiläum, von einem Besuch beim Zahnarzt? Felice war erbost, man steckte seine Nase nicht in Briefe, die jemand anderem galten. Wie weitsichtig, kein Wort über Erna verloren zu haben! Trotzdem saß Felice beim Weiterlesen die Angst im Nacken, was wollte Julie Kafka, die sich so schmeichlerisch wand, bloß von ihr? Es ging, das stand nach wenigen Zeilen fest, um Franz: »Dass er sich in seinen Mußestunden mit Schreiben beschäftigt, weiß ich schon viele Jahre. Ich hielt dieß aber nur für einen Zeitvertreib. Auch dieß würde ja seiner Gesundheit nicht schaden, wenn er schlafen und essen würde wie andere junge Leute in seinem Alter. Er schläft und isst so wenig, dass er seine Gesundheit untergräbt, und ich fürchte dass er erst zur Einsicht kommt, wenn es Gott behüte zu spät ist. Darum bitte ich Sie sehr, ihn auf eine Art darauf aufmerksam zu machen und ihn befragen wie er lebt, was er isst, wie viel Mahlzeiten er nimmt, überhaupt seine Tageseintheilung. Jedoch darf er keine Ahnung haben, dass ich Ihnen geschrieben habe überhaupt nichts davon erfahren, dass ich um seine Correspondenz mit Ihnen weiß. Sollte es in Ihrer Macht stehen, seine Lebensweise zu ändern, würden Sie mich zum großen Dank verpflichten und zur glücklichsten machen.« Da schlug ein besorgtes Mutterherz. Julie Kafka sah nachts die Lampe im Zimmer ihres Sohnes brennen, aber tagsüber kam er kaum aus dem Bett. Er war ein schlechter Esser, magerte ab und wurde immer blasser. Schließlich wäre ein regelmäßiger Lebenswandel auch ganz in Felices Sinn, hinsichtlich einer gemeinsamen Zukunft mit Franz. Konnte Felice der Frau lange böse sein?
Als brave Schwiegertochter in spe erfüllte sie Julie Kafkas Bitte. Acht Stunden Schlaf, riet sie Franz, weniger sei der Gesundheit abträglich. »Halte Maß! Behalte das Ziel im Auge! Ist es Dir nicht möglich, Dein literarisches Schaffen auf zwei, drei Stunden täglich zu beschränken?« Welch absurder Vorschlag für einen wie Franz! Wahrscheinlich brauchte er an manchen Tagen schon ein bis zwei Stunden, um die Wortbrocken in seinem Kopf zu ordnen und überhaupt einen einzigen Satz zu formulieren, der ihn zufriedenstellte. Er hatte es ihr doch beschrieben, und von Max wusste sie, dass diese Literaten sich einen Dreck um den Feierabend scherten, die kriegten schlechte Laune, wenn man sie nicht schreiben ließ, sobald ihnen Sätze kamen. Trotzdem warf sie den Brief an Julie Kafka noch am selben Tag ein.
Die Verschwörung der Frauen blieb Franz nicht lange verborgen. Denn in einem Brief an Max Brod entschlüpfte Felice die Frage, ob Franz seine Post denn nicht an sicherem Orte aufbewahre. Der konnte eins und eins zusammenzählen: »Ich nahm Deine heutigen Briefe als ein Ganzes und Deine Ratschläge betreffend das Essen und den Schlaf verblüfften mich nicht besonders, was sie doch eigentlich hätten tun müssen, da ich Dir doch schon geschrieben hatte, wie froh ich bin, die gegenwärtige Lebensweise gefunden zu haben, welche die einzige halbwegs befriedigende Lösung der Widersprüche ist, in denen ich leben muss. Als mir aber Max heute eine auch nur ganz zarte Andeutung machte, wegen der Aufbewahrung von Briefen und wie seine Sachen vor den Eltern niemals sicher sind – seines Vaters Suchen und Forschen in allen Zimmerecken ist mir geradezu schon aus der Anschauung bekannt – da liefen mir mit diesen Bemerkungen alle zugehörigen Bemerkungen aus Deinen heutigen Briefen zusammen, denn Deine Briefe waren mir wie immer so auch diesmal so gegenwärtig wie der Gesichtsausdruck des Menschen, mit dem ich spreche – und ich wusste bald nicht alles zwar, aber genug, um Max zu zwingen, alles zu sagen.« Franz machte Felice keine Vorwürfe, er fing an, sich für seine kleine Schlamperei zu rechtfertigen: »Natürlich trage ich jetzt nicht alle Briefe bei mir herum wie in jenen ersten armseligen Zeiten, aber den letzten oder die zwei letzten noch immerhin. Ich trage zuhause einen anderen Rock und hänge den Rock des Straßenanzuges an den Kleiderrechen in meinem Zimmer. Die Mutter gieng durch mein Zimmer, als ich gerade nicht darin war – mein Zimmer ist ein Durchgangszimmer oder besser eine Verbindungsstraße zwischen dem Wohnzimmer und dem Schlafzimmer der Eltern – sah den Brief aus der Brusttasche schimmern, zog ihn mit der Zudringlichkeit der Liebe heraus, las ihn und schrieb Dir.« Franz hatte seine Mutter daraufhin zur Rede gestellt. Sie war nicht nur in sein Zimmer, sondern in einen verbotenen Raum eingebrochen, wo sie nichts zu suchen hatte. Franz versprach Felice hoch und heilig, in Zukunft besser achtzugeben. Konnte Felice sich darauf verlassen?
Читать дальше