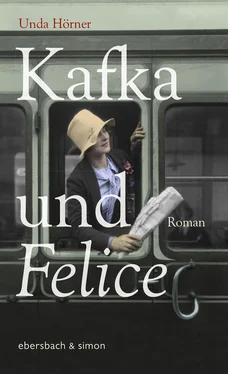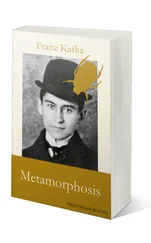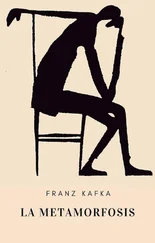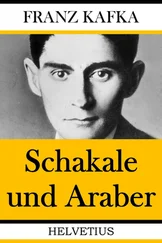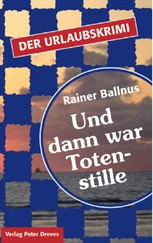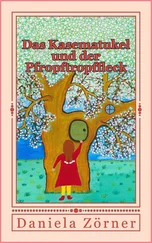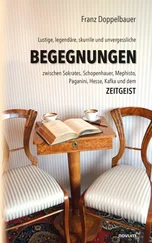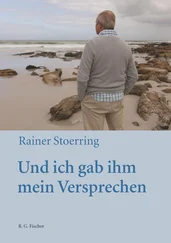Der Parlograf, hob Felice schwungvoll an, und erklärte einmal mehr, was es mit dem neuartigen Gerät auf sich hatte, der Schalltrichter, die tickenden Nadeln auf der rotierenden Wachswalze, die aufgezeichnete Stimme wie von fern. Felice vergaß darüber fast, ihre weiblichen Reize spielen zu lassen, hin und wieder ein unschuldiger Augenaufschlag, ein aufreizendes Lächeln, ein absichtslos zu Boden gleitender Handschuh, zugegeben, genau dieses Repertoire fiel ihr schwer. Denn wenn sie bei Lindström, wo sie gern den Verkehr mit Geschäftskunden pflegte, eines gelernt hatte, dann den sachlich-freundlichen Umgang mit dem männlichen Geschlecht. Noch nie war ihr etwas Unangenehmes widerfahren, eine anzügliche Bemerkung, eine Äußerung des Zweifels an ihrer Kompetenz. Felice hatte ihr sachliches Verhalten Männern gegenüber auf der Arbeit derart gut eingeübt, dass ihr ein Rollenwechsel partout nicht gelingen wollte, sie konnte nicht aus ihrer Haut, nein, sie wollte es gar nicht. Ihrem Tischherrn schien auch gar nichts zu fehlen, er hörte Felice mit aufmerksamer Miene zu, als sie erläuterte, dass Odeon-Grammofongeräte inzwischen ein großer Exportschlager seien, ebenfalls Schellack-Schallplatten.
Ganz bezaubernd, wie anschaulich, wie begeistert Sie von Ihrem Beruf erzählen können, gnädiges Fräulein! Der Kinderarzt war ein guter Zuhörer. Die Rede kam auch auf Jascha Heifetz, das zwölfjährige Wunderkind, das die Berliner vor Kurzem im Beethovensaal entzückt hatte, ob es von dem jugendlichen Geiger auch schon Schallplattenaufnahmen gebe, fragte der Arzt. Es ging auf Mitternacht zu, die Weinflasche war längst geleert. Wir brauchen noch was zum Anstoßen, rief Felices Tischherr dem vorbeieilenden Kellner zu, Champagner!
Die letzten zehn Sekunden des alten Jahres wurden heruntergezählt, das Orchester hob an, der Mitternachtswalzer. Der Kinderarzt verneigte sich vor Felice, Prost Neujahr!
Felice hatte schon einen leichten Schwips. Noch ein Tanz, man holte die Mäntel von der Garderobe und ging hinaus; Feuerwerk prasselte über der Stadt, mit Raketendonner wurde die Zahl 1913 in den Berliner Nachthimmel geschrieben.
Zum Abschied hauchte der Kinderarzt Felice einen Kuss auf den Handschuh: Darf ich hoffen, Fräulein Bauer, Sie bald wiederzusehen?
»… ein fröhliches neues Jahr meinem liebsten Mädchen; ein neues Jahr ist eben ein anderes Jahr und wenn das alte uns auseinandergehalten hat, vielleicht treibt uns das neue Jahr mit Wundern und mit Gewalt zusammen. Treibe, treibe, neues Jahr!« Mit diesen Wünschen aus Prag begann 1913. Dass Wunder und Gewalt es richten sollten, war für Felices Geschmack allerdings allzu schweres Geschütz. Sie wusste, was wirklich half: Offenheit und Vertrauen. Bekämen sie das nicht hin, sollte sie den Briefwechsel mit Franz von heute auf morgen lieber beenden. Dem Spuk ein Ende machen. Sich auf den sympathischen, rotblonden Kinderarzt einlassen, der mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen schien, statt auf einen sensiblen Künstler und unzufriedenen Büroangestellten zu warten.
Doch schon am ersten Arbeitstag im neuen Jahr wurde Felice von ihren Kolleginnen mit Fragen bombardiert. Kein Mensch interessierte sich für den Festtagsbraten, für den Silvesterball und den Kinderarzt. Stattdessen wollte die Stenotypistin Emmy Brühl wissen, was denn der Doktor aus Prag geschrieben hätte? Warum er über die Feiertage nicht in Berlin gewesen sei? Weil er einen Roman schreiben müsse, Der Verschollene , eine Geschichte, die in den Vereinigten Staaten von Amerika spiele, gab Felice bedeutungsschwanger zur Auskunft, als verlange die Welt bereits händeringend nach diesem Buch, das außer in Franz’ Kopf noch kaum existierte.
Den Kolleginnen bei Lindström waren die Veränderungen in Felices Leben nicht verborgen geblieben. Denn das Phantom Franz schrieb auch an die Büroadresse, Felice hat schon wieder Verehrerpost, so wurde getuschelt, wenn auf ihrem Schreibtisch ein Kuvert lag, abgestempelt in Prag und mit der gleichmäßigen Handschrift, die alle schon bestens kannten. Niemandem war entgangen, dass Felice häufig ein Gähnen unterdrückte, doch den Kolleginnen fiel auch ein neues Leuchten in ihren Augen auf.
Na, wen hast du da an der Angel?, fragte Emmy Brühl.
Für einen kurzen Moment gewährte Felice der Brühl, deren Neugier unbezähmbar war, einen Einblick in das Medaillon an ihrer Brust.
Hui, fuhr es aus der heraus, fescher Bursche!
Wenn Felice im Heer der vielen Angestellten in geschäftsmäßigem Schneiderkostüm durch die Straßen der Stadt hastete, um die nächste Elektrische zu erwischen, fühlte sie sich herausgehoben aus der grauen Menschenmasse und von einer geheimnisvollen Aura umgeben. Nie, noch nie zuvor im Leben, war Felice so viel Aufmerksamkeit zuteil geworden. Es klang paradox: Dieser Mann, der so weitschweifig über seine finsteren Abgründe schreiben konnte, trug ein hell strahlendes Licht in ihre von Sorgen umwölkten Tage. In diesem Meer aus Lügen und Verschweigen waren Franz’ Briefe eine von reinen Blumen bewachsene Insel, auf die sie sich jederzeit retten konnte. Als Felice dem netten Kinderarzt gleich in der ersten Januarwoche zufällig erneut begegnete und der sie unumwunden fragte, ob sie ihn auf den vor der Tür stehenden Faschingsball im Eispalast begleiten wolle, griff sie kurzerhand zu einer Notlüge, die all sein Werben im Keim erstickte. Nein, sagte Felice, es gibt da einen Mann. Ich bin verlobt.
Offenheit und Vertrauen: Beseelt von diesem Vorsatz schilderte Felice Franz den Silvesterabend mit großem Orchester und Feuerwerksspektakel und ließ, auch hier wollte sie Farbe bekennen, den netten Kinderarzt nicht aus. Normale Männer verabredeten sich mit dem Rivalen in einer nebligen Schlucht zum Duell, zumindest in Romanen las man das, aber einer wie Franz trat nur allein gegen sich selbst an: »Nein, ich klage, ich jammere eigentlich, ich hätte wollen, dass der Kinderarzt zu Euch hinaufgekommen wäre, dass er sich als der nette Mensch, der er an Sylvester war, auch weiterhin bewährt hätte, dass er lustig gewesen und lustig aufgenommen worden wäre. Wer bin denn ich, dass ich mich ihm in den Weg zu legen wage? Ein Schatten, der Dich unendlich liebt, den man aber nicht ans Licht ziehn kann. Pfui, über mich!« Franz’ Brief nahm mit dem nächsten Satz eine jähe Kehrtwendung: »Ich wäre zerfressen vor Eifersucht, wenn ich aus der Ferne hören müsste, dass dem Kinderarzt tatsächlich alles das gelungen ist, was ich ihm auf der vorigen Seite so dringend wünschte und die Unwahrheit, die Du ihm sagtest, war nicht aus Deinem reinen Innern, sondern aus mir heraus gesprochen und ich will fast glauben, dass Deine Stimme in jenem Augenblick einen kleinen Beiklang von der meinigen gehabt hat.«
Derlei Liebesbriefe klangen so anders als das übliche Säbelrasseln der strammen preußischen Kerle, anders auch als das Süßholzraspeln der Schmocks auf dem jüdischen Heiratsmarkt. Nur Franz’ Strenge befremdete Felice, und sie fragte ihn, ob er denn auch herzlich lachen könne. Ja, unbedingt, behauptete er: »… ich bin sogar als großer Lacher bekannt …« Natürlich, hatte er sich nicht mit der ahnungslosen Brühl schon einen Scherz erlaubt? Felice hatte zu ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag im November Geschenke der Kolleginnen auf ihrem Platz gefunden, nebst einem Gedicht, das die Brühl gereimt hatte. In etwas holperigen, aber lustigen Versen wünschte sie Felice einen Ehemann mit Adelstitel. Felice hatte Franz das verraten, und er konterte mit einem Wunsch für das Fräulein Brühl, es sollten »… von heute ab Abend für Abend nach Geschäftsschluss ein Jahr lang bis zu ihrem nächsten Geburtstag zwei rasende Prokuristen rechts und links neben sie treten und ihr ununterbrochen und gleichzeitig, bis Mitternacht Briefe diktieren.«
Kurze Zeit später schickte Franz aus reinem Spaß am Jux eine anonyme Glückwunschkarte an die Brühl. Die Kollegin drehte und wendete die Karte ratlos in den Händen, und Felice, die in Franz’ Schabernack eingeweiht war, verspürte eine diebische Freude über ihr Rätselraten. Ein heimlicher Verehrer? Ein Kunde? Ja, Franz hatte auch Humor, eine Seite an ihm, die Felice besser kennenlernen wollte. Es fiel so schwer, auf dem Papier zu lachen.
Читать дальше