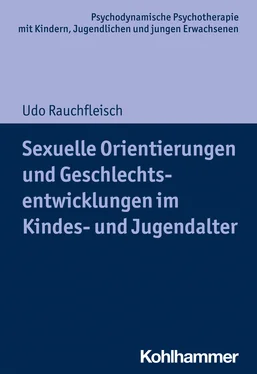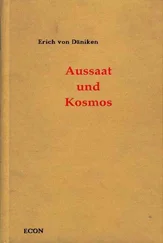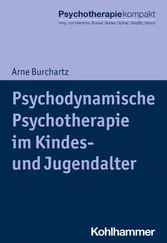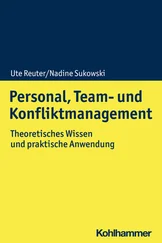Im Anschluss an Morgenthaler (1987) habe ich innerhalb der Entwicklung vom Kleinkind zum Erwachsenen drei wichtige Stationen unterschieden, die für die schwule und die heterosexuelle Orientierung von zentraler Bedeutung sind. Die erste Station liegt in der narzisstischen Entwicklung der frühen Kindheit und beinhaltet die Entstehung des Selbstbildes. Die zweite wichtige Weichenstellung erfolgt in der ödipalen Phase mit den in dieser Zeit typischen Auseinandersetzungen mit den wichtigsten Personen der Kindheit. Die dritte Station liegt in der Pubertät und reicht über die Adoleszenz bis ins Erwachsenenalter.
Die Aufgabe der frühen Kindheit ist die Ausbildung der oben beschriebenen Identität, in der sich die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit zu einer Ganzheit zusammenfügen. Damit hängt eng eine zweite Aufgabe zusammen, nämlich die der Abgrenzung der eigenen Person von anderen Menschen, mit dem Ziel, Autonomie zu erlangen. Dabei geht es um die Fähigkeit, selbstständig entscheiden und handeln zu können.
Morgenthaler (1987) ist der Ansicht, dass je nach den lebensgeschichtlichen Erfahrungen, die das Kind in der Frühzeit seiner Entwicklung macht, entweder das Streben nach Autonomie oder das Bedürfnis, die Identität zu stärken, größer ist. Beide Entwicklungswege bewegen sich gleichermaßen im Bereich der psychischen Gesundheit. Es sind »normale«, die weitere Entwicklung stabilisierende Maßnahmen, mit deren Hilfe das Kind pathologische Entwicklungen zu vermeiden vermag.
Das Spezifische in der Entwicklung des schwulen Mannes sieht Morgenthaler in der Betonung des Bedürfnisses nach Autonomie. Wann immer im Erleben dieser Kinder und der späteren Erwachsenen Gefühle von Insuffizienz, Enttäuschungen und emotionalen Belastungen auftreten, »retten« und regulieren sie ihr innerseelisches Gleichgewicht durch ein verstärktes Streben nach Autonomie. Dies ist nach Morgenthaler in der frühen Kindheit eng gebunden an autoerotische Aktivitäten. Mit Hilfe der Autoerotik vermögen diese Kinder Störungen ihres seelischen Gleichgewichts und den in solchen Situationen drohenden Autonomieverlust zu verhindern. Die enge Beziehung zwischen Autoerotik und Autonomiestreben bleibt, so Morgenthaler, lebenslang erhalten und führt dazu, dass sich auch die sexuellen Interessen (Geschlechtspartner*innen-Orientierung) später verstärkt auf die eigene Person und auf Partner des gleichen Geschlechts richten.
Im Unterschied zu dieser Entwicklungslinie sind die heterosexuellen Männer Persönlichkeiten, die in ihrem Selbstbild dem Identitätsbewusstsein und dem Identitätsgefühl Priorität einräumen.
»Sie orientieren sich nach polaren Gegensatzpaaren, um genau zu spüren und zu wissen, wer sie sind. Auch Homosexuelle haben das Bedürfnis zu spüren und zu wissen, wer sie sind, doch erst in zweiter Linie. Ihr Identitätsbewusstsein kann unscharf begrenzt sein, ohne dass sie dadurch verunsichert werden. Auch Heterosexuelle besetzen ihre innere und äußere Autonomie, doch selten so weit, dass ihre Identität dadurch in Frage gestellt wird. Sie können sich gelassener in Abhängigkeit begeben, weil sie, in dieser Hinsicht, weniger konfliktanfällig sind als Homosexuelle« (Morgenthaler, 1987, S. 88–89).
Als charakteristische Entwicklungslinie der lesbischen Frau postuliert Gissrau, dass für diese Frauen eine sie prägende Erfahrung in der frühen Kindheit das Erleben des »erotischen Blicks ihrer Mutter« ist, »den sie als lustvolles affektives Interaktionsmuster internalisieren« (Gissrau, 1993, S. 317). Die Mütter von später lesbisch empfindenden Frauen können sich, gemäß Gissrau, in der präverbalen Entwicklungsphase ihrer Kinder den erotischen Genuss am Stillen, Wickeln, Baden, Einreiben gestatten, wodurch es frühzeitig zu einer erotischen Stimulierung der Töchter komme. Es sei aber auch denkbar, dass die Mütter durch ihre sie erotisch ansprechenden Babys entsprechend stimuliert worden seien. Auf jeden Fall ist nach Gissrau die erste Weichenstellung in Richtung der lesbischen Entwicklung »das Ausmaß an erotischer Anerkennung, das die Mutter in ihren Interaktionen während der ersten Lebensjahre zulassen kann« (Gissrau, 1993, S. 317).
Bei Verwendung der Konzepte von Morgenthaler und Gissrau für die Erklärung der Entwicklung bisexueller Menschen müssen wir vermuten, dass diesen Kindern die Bedürfnisse nach Identität und Autonomie in gleicher Weise wichtig sind. Durch die in unserer Gesellschaft dominierenden Heterosexualitäten tritt im Erleben bisexueller Jugendlicher und junger Erwachsener im Allgemeinen zuerst die heterosexuelle Komponente ins Bewusstsein und erst später das gleichgeschlechtliche Begehren.
Obschon von anderen theoretischen Grundannahmen ausgehend, finden sich doch ähnliche, die bisherigen Ausführungen ergänzende Überlegungen bei einigen Autor*innen der Analytischen Psychologie von C. G. Jung. So hat Hopcke (1991) den Versuch unternommen, im Rahmen der Analytischen Psychologie ein Modell zum Verständnis lesbischer, schwuler, bisexueller und heterosexueller Entwicklungen zu formulieren. Hopcke sieht die sexuelle Entwicklung als Resultat eines je individuellen Zusammenwirkens der drei Archetypen der Anima, des Animus und des Androgynen.
Für Hopcke liegt das Spezifische der lesbischen und schwulen Entwicklung darin, dass es bei diesen Orientierungen um eine komplexe Interaktion der drei genannten archetypischen Konfigurationen geht, wobei dem Androgynen eine synthetisierende Funktion zukommt. Die lesbische und schwule Entwicklung stellen ein harmonisches (gesundes) Zusammenspiel dar, in dem Animus und Anima zusammen mit dem hermaphroditischen Selbst, der androgynen Ganzheit, in je individueller Weise durch die körperliche und emotionale Verbindung mit einer anderen Frau bzw. mit einem anderen Mann aktualisiert und gelebt werden.
Bei einer kritischen Auseinandersetzung mit den psychodynamischen Entwicklungstheorien, wie Gissrau, Morgenthaler und Hopcke sie formuliert haben, stellen sich zumindest zwei Fragen:
Zum einen bleibt in den skizzierten Konzepten die Frage unbeantwortet, warum im Sinne Morgenthalers die einen Kinder der Identität Priorität einräumen, während die anderen Kinder der Autonomie eine besondere Bedeutung beimessen. Es bleibt auch offen, wie die »Weichenstellungen« zustande kommen. Die gleiche Frage stellt sich beim Konzept von Hopcke, nämlich wie es zu dem spezifischen Zusammenspiel der drei archetypischen Konfigurationen kommt.
Vermutlich müssen wir hinsichtlich der Ätiologie der sexuellen Orientierungen der biologischen Dimension in Gestalt eines genetischen Faktors einen Einfluss beimessen. Wie groß dieser Einfluss ist und wie er genetisch zustande kommt, ist aber nach wie vor unbekannt. Eine neuere große genetische Studie zeigt (Price, 2018), dass das sexuelle Verhalten des Menschen ein höchst komplexes Phänomen ist und die in dieser Studie identifizierten Genvarianten nur einen Bruchteil, nämlich weniger als ein Prozent, des sexuellen Verhaltens erklären.
Zum anderen kann man sich fragen, ob die Betonung der Identität oder der Autonomie nicht Ursache, sondern Folge der vom Kind gespürten gleichgeschlechtlichen Orientierung ist. Gissrau deutet diese Möglichkeit an, wenn sie darauf hinweist, dass bei dem engen Ineinandergreifen des mütterlichen und des kindlichen Verhaltens denkbar ist, dass die erotische Stimulation möglicherweise nicht von den Müttern ausgegangen ist, sondern die Mütter durch ihre sie erotisch ansprechenden Babys entsprechend stimuliert worden seien und auf die Kinder reagiert hätten.
Wir finden eine ähnliche Interaktion auch zwischen trans Kindern und ihren Eltern. In Fällen, in denen beispielsweise die Mütter das nicht-geschlechtsrollenkonforme Verhalten ihrer Kinder geduldet und unter Umständen sogar gefördert haben, ist ihnen immer wieder vorgeworfen worden, sie hätten ihre Kinder manipuliert. Die Realität ist nach meiner Erfahrung häufig umgekehrt: Diese Mütter haben früh gespürt, dass ihr Kind sich nicht dem ihm bei Geburt zugewiesenen Geschlecht zugehörig fühlte, und haben darauf – in einfühlsamer und entwicklungsfördernder Weise – mit einer Unterstützung hinsichtlich des vom Kind gewünschten Rollenverhaltens reagiert.
Читать дальше