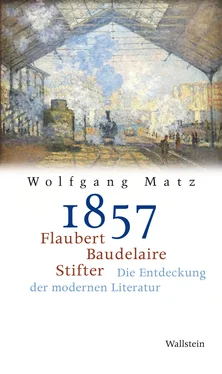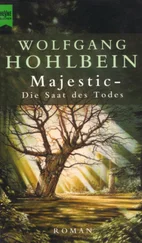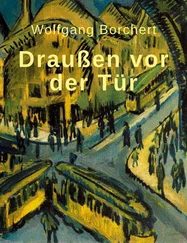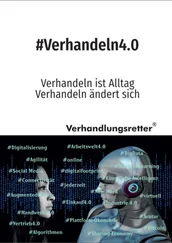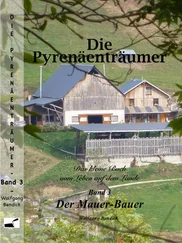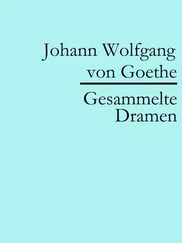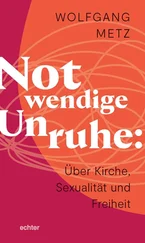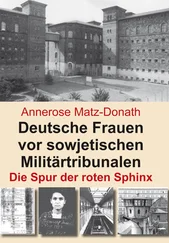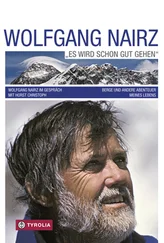Das Engwerden der Welt, dies ist vielleicht die lebensweltliche, phänomenologische Kurzformel für die zentrale Erfahrung des neunzehnten Jahrhunderts, die in anderen Formeln Entzauberung der Welt heißt, Anbruch der Moderne oder des bürgerlichen Zeitalters. Fast alle Künstler empfanden die Moderne des neunzehnten Jahrhunderts als Bedrohung. Schreiben wurde ein Beruf. Der unästhetische Zustand des empirischen Lebens und der ästhetische Zustand der Kunst sollten in diesem Beruf zueinanderfinden. Die Kunst lebt aus der Differenz, die Ästhetik ist eine Wissenschaft vom Unterscheiden. Das Schöne unterscheidet sich vom Hässlichen, das Seltene vom Alltäglichen, das Gekonnte vom nur Gewollten, das Schwierige vom überall Zugänglichen, das schwer zu Verstehende vom Allgefälligen, die Kunst, mit einem Worte, von allem, was nicht Kunst ist. Nicht jeder ist imstande, Kunst zu schaffen, und nicht jeder ist imstande, Kunst aufzunehmen, zu verstehen und zu genießen. Kunst ist elitär, Kunst ist unbürgerlich und undemokratisch. Kunst ist undemokratisch auch in dem Sinne, dass sie noch niemals durch autoritäre Herrschaft verhindert wurde und durch Demokratie nicht befördert: die Ilias entstand so wenig in der Demokratie wie die Göttliche Komödie oder Goethes Faust . Genau an dieser Stelle beginnt das Problem von Bürgerlichkeit und Demokratie, das für so viele Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts essentiell wurde und das in so vielen Korrespondenzen, von Beyle bis Zola und darüber hinaus, eine so große Rolle spielt. Doch muss der Nachgeborene sich hüten, diese Terminologien umstandslos in seinem heutigen Sinne zu interpretieren: Bürgerlichkeit und Demokratie sind häufig schlechterdings Synonyme für das, was den Prozess der Moderne ausmacht.
Jenseits politischer Polemiken ist unleugbar, dass der demokratische Prozess der Moderne nivellierend wirkt, denn das ist sein eigentlicher und guter Zweck. Die Demokratie wünscht zu verhindern, dass singuläre Gestalten wie Napoleon das Ruder der Geschichte ergreifen und ihren singulären Utopien Millionen opfern. Henri Beyle war ein Verehrer Napoleons, und er schrieb seine Biographie. Der singuläre Künstler spürte die Verwandtschaft zum singulären Politiker. Und er spürte auch, dass die wohltuende Nivellierung der politischen Welt die künstlerische nicht unberührt lässt. Er spürte, in der heraufziehenden bürgerlichen und das heißt demokratischen Gesellschaft wird die Mehrheit dem Freund des Singulären mitteilen, was sie zu halten gedenkt von den Differenzen und Nuancen der Künstler, von ihrer Verfeinerung, Aufnahmefähigkeit, Empfindlichkeit: nicht viel. Wo die traditionellen gesellschaftlichen Hierarchien verlorengehen, verliert auch der Künstler viel, zumindest jenen Ort, den er über Jahrhunderte innegehabt hat. Das Spiel von Geist, Kunst und Macht, wie es Beyle bei seinen Aufenthalten in der Villa Sommariva mitspielte, ist zu Ende; mächtig werden nun die Herren de Rênal und Valenod, und diese haben zwar erhebliches Interesse an Macht, aber durchaus keines an Geist und Kunst. Was sie vom Künstler verlangen, ist ein Quadratmeter pikante Mythologie für den Salon und äußerstenfalls eine halbe Stunde unkonzentrierte und unterhaltsame Lektüre vor dem Schlafengehen. Die Herrschaft des Bürgertums bedeutet für den Künstler die Herrschaft des Apothekers Homais und des Notargehilfen Léon Dupuis, und was diese von der Kunst erwarten, steht in dem einschlägigen Roman.
In der Tat, wo die traditionellen gesellschaftlichen Hierarchien verlorengehen, verliert der Künstler zumindest jenen Ort, den er über Jahrhunderte innegehabt hat, und die Suche nach einem neuen wird zum zentralen Problem für Autor und Autorschaft des neunzehnten Jahrhunderts, zu einem Problem auch des Kunstwerks selbst. Die Frage nach der Möglichkeit künstlerischer Produktion überhaupt wird nicht nur eine biographische Konstante im Leben vieler Schriftsteller, sie durchdringt auch alle ihre Werke.
Briefe, Briefwechsel und Tagebücher, Memoiren, Biographien und Gespräche bilden in der europäischen Tradition seit Jahrhunderten neben den künstlerischen Werken im engeren Sinne ein Korpus der Reflexion, der Erfahrung, des Austauschs und des geistigen Gedächtnisses, ohne den diese Tradition überhaupt nicht zu denken wäre. Einer kleinlichen und vergesslichen Epoche blieb es vorbehalten, den Tod des Autors zu erklären und Biographisches mit dem Bannfluch zu belegen. Die Literaturwissenschaft fand dazu kurzatmige Theorien von werkimmanenter oder politischer Interpretation, die glaubte, Beschäftigung mit Biographien nur aus sozialphysiognomischem Interesse zulassen zu können. So sonderbar es ist, literarische Werke durften interpretiert werden in Hinblick auf gesellschaftliche, politische, ästhetische Bedingungen, der Einfluss anderer Werke durfte diskutiert werden, nur eines blieb unbeachtet: die schlichte Tatsache, dass jedes Werk geschaffen ist von einem empirischen Individuum in einem ganz bestimmten historischen und biographischen Augenblick. Jeder kennt die Klage, die Beschäftigung mit der Biographie eines Künstlers drohe die mit seinem Werk zu verdrängen. Warum aber soll das bloße Werk für sich umstandslos wichtiger sein als das Individuum, das es schuf?
Ist die Welt wirklich so, wie sie in der Divina Commedia steht, oder gleicht sie nicht eher der in der Comédie humaine ? Die Naivität einer solchen Frage soll nur die allgemein bekannte Tatsache illustrieren, dass der Wahrheitsgehalt von Literatur weder von einer abstrakten Richtigkeit ihrer Aussagen oder Begriffe abhängt noch von einer im realistischen Sinne korrekten Abmalung der Welt; denn wäre es so, dann hätte keine Seite von Dante oder Balzac, von Flaubert, Baudelaire oder Stifter heute mehr als archivarisches Interesse. Jedes Verfahren philosophischer Interpretation von Literatur der Vergangenheit hat es also zwangsläufig mit einer Form der Relativierung zu tun, mit Historisierung . Es zählt zu den befremdlichsten Standards des intellektuellen, akademischen und publizistischen Lebens, dass die Geschichtsschreibung vor der Beschäftigung mit dem Individuum haltzumachen hat. Was anderes ist eine Biographie als die Geschichte eines Menschen? Welcher vernünftige Mensch aber liest Dichtung und Wahrheit oder Vie de Henry Brulard , die Tagebücher von Amiel oder die Briefe Hölderlins, Biographien über Chateaubriand, Balzac, Heine und all die anderen allein aus sozialphysiognomischem Interesse? Nein: Er liest sie aus Interesse an einer Gestalt, an einer intellektuellen Physiognomie, an einer geistigen Existenz, die sich so und nicht anders verwirklicht hat, nur hier in diesem geschichtlichen und individuellen Moment. Und auch der Schriftsteller, gerade der Schriftsteller ist kein Exempel für allgemeine Demonstrationen der Sozialwissenschaft, sondern ein einzigartiges Individuum, an dem der Leser sehr zu Recht ein individuelles Interesse nimmt.
Die werkimmanente Interpretation ist eine posthegelianische Erfindung und zugleich eine abstrakte Idolatrie des Geistigen gegenüber dem Geflecht der Wirklichkeit, in das es verstrickt ist. Schon durch seine Verbindung mit dem Gesamtwerk des Autors ist das einzelne Werk auf eine Weise beeinflusst, die in ihm allein unmöglich zu erkennen ist; ob ein Werk am Anfang eines Lebens oder an dessen Endes steht oder in diesem womöglich das einzige blieb, das ist dem Werk nicht äußerlich. Man lese dies kleine, aber vollkommene Distichon, dessen Goethescher Ton sofort erkennbar ist:
Tritten des Wand’rers über den Schnee sei ähnlich mein Leben,
Es bezeichne die Spur, aber beflecke sie nicht.
Und dann lese man in der Biedermannschen Ausgabe von Goethes Gesprächen seine Herkunft nach: »Als während der Unterhaltung bei Goethe der erste Schnee fiel. Goethe schlug vor, jeder solle ein Gedicht auf ihn machen.« Nicht Goethe, sondern sein »Urfreund« Karl Ludwig von Knebel, als Schriftsteller nicht eben bedeutend, schrieb die zwei Verse, »und Goethe, der andere so gern anerkannte, war so entzückt davon, daß er ausrief: Knebel, für dieses Distichon gäb’ ich einen Band meiner Werke hin!« Der werkimmanenten Interpretation entginge das ganze Vexierspiel, das von der Frage der Autorschaft hier in Gang gesetzt wird. Wäre das Distichon von Goethe selber, dann läse man ein vollkommenes, aber doch winziges Seitenstück zu einem überwältigenden Werk, das eine augenblickliche Lebensempfindung in Worte fasst, wie man sie von diesem Dichter erwartet; es ist jedoch von Knebel und damit ein kleines, aber vollkommenes, einzigartiges Juwel in einem Werk, von dem die Literaturgeschichte nichts aufbewahrt hat – und auch dieses, eine wundervolle Anverwandlung des Goetheschen Geistes, nur als Teil des biographischen Komplexes von Goethes Leben.
Читать дальше