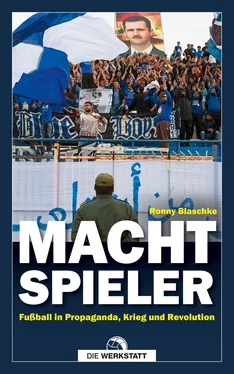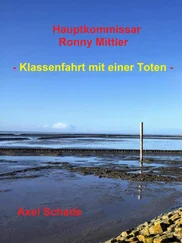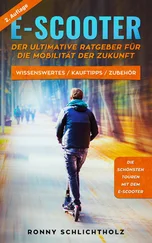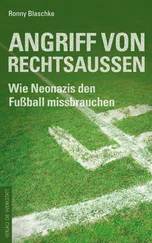Gegen die Bevormundung aus dem Westen
Diese Episode zeigt, wie sehr sich die Fankultur seit ihrem Entstehen Mitte der 1970er Jahre gewandelt hat. In der Sowjetunion hatten insbesondere die Gruppen der großen Moskauer Klubs von Anfang an unter Beobachtung gestanden. Ihre Emotionen und undurchsichtigen Hierarchien wurden als „Gefahr für die Ordnung“ gedeutet. Erst recht in angespannten Zeiten: nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan 1979, dem westlichen Olympia-Boykott in Moskau 1980, dem Aufkommen der Solidarność in Polen. Zeitweilig wurden in Stadien Flaggen und Schals verboten. Der Komsomol, die Jugendorganisation der Kommunistischen Partei, wirkte auf kritische Anhänger ein.
Die Polizei, die Pressezensur und der Geheimdienst KGB verhinderten, dass Schlägereien im Stadionumfeld eine größere Öffentlichkeit erreichten. Sogar die Massenpanik beim UEFA-Pokal-Heimspiel 1982 zwischen Spartak Moskau und dem HFC Haarlem, bei der mindestens 66 Menschen starben, wurde erst sieben Jahre später ausführlich diskutiert. Auch im politischen Vakuum der 1990er Jahre war an eine strategische Fanarbeit nicht zu denken, so vernetzten sich Hooligans und Neonazis, berichtet der freie Journalist und Osteuropa-Experte Thomas Dudek. Einige Hooligans übernahmen Sicherheitsdienste für regionale Mandatsträger, andere schüchterten politische Gegner ein.
Robert Ustian gehört zu der überschaubaren Gruppe, die sich dagegenstemmt. Als Mitglied des Netzwerks Football Supporters Europe FSE möchte er beim Aufbau einer präventiven Fan-Betreuung helfen, so wie sie in Deutschland durch sozialpädagogische Fanprojekte seit drei Jahrzehnten zum Standard geworden ist. Vor und während der WM war Ustian ein gefragter Interviewpartner für internationale Medien. Auf einer Konferenz diskutierte er mit Vertretern von Borussia Dortmund und dem tschechischen Verein Slovan Liberec: „Diese Leute haben nicht mit dem Finger auf uns gezeigt. Sie sprachen über ihre Probleme mit rechten Fans – und über Lösungen.“
Robert Ustian wird emotional, wenn es um „arrogante Berichte“ einiger Menschenrechtsorganisationen geht: „Man muss sich auf die Geschichte und die Besonderheiten unseres Landes einlassen, um etwas bewirken zu können. Schon im Zarenreich kamen Reformen stets von der Spitze. Leider haben wir keine Kultur, in der wichtige Veränderungen an der Basis angestoßen werden. Alles geht von oben nach unten.“ Ustian kann aus dem Gedächtnis polemische Passagen aus britischen Medien zitieren. Er betont, dass es auch in Russland reformwillige Querköpfe gibt. Nur brauche man mehr Kraft und Geduld, um ihre Ideen sichtbar zu machen.
Der Einfluss der Kirche wächst – auch im Sport
Jahrelang wurde die WM 2018 als Verstärker für politische Forderungen genutzt, von Unterstützern und Gegnern Russlands. Nach der Annexion der Krim 2014 forderten Stimmen aus EU und USA einen Boykott der WM. Im März 2018 sagten Regierung und Königsfamilie aus Großbritannien einen Turnierbesuch ab. Sie reagierten auf einen Giftanschlag auf den früheren Spion Sergej Skripal und dessen Tochter in Salisbury. Etliche Länder schlossen sich an wegen der Unterstützung Russlands im syrischen Bürgerkrieg für den Präsidenten Assad, auch wegen Hackerangriffen sowie Einmischungen in ausländische Wahlen. Russische Spitzenpolitiker deuteten dies als „westliche Propaganda“.
In ihrem Sammelband „Russkij Futbol“ verdeutlichen die Herausgeber Martin Brand, Stephan Felsberg und Tim Köhler, dass der russische Fußball seit mehr als 120 Jahren für Propaganda genutzt wird. Zum Beispiel 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm: Das russische Team verlor 1:2 gegen Finnland, das damals noch als Großfürstentum zum Russischen Reich gehörte. Kritiker werteten dies als Zeichen für den Untergang des Zarentums. Oder zwei Jahrzehnte später: Die Rote Armee nutzte den Fußball, um ihre Soldaten bei Laune zu halten.
Jenseits des Militärs wurden Klubs an Industriebranchen gekoppelt. Dynamo Moskau war in der Obhut des Geheimdienstes, Lokomotive gehörte zur Eisenbahn, ZSKA zur Armee. In den 1930er Jahren herrschten unter Stalin Willkür und Verfolgung. Wer in Zeiten von Zwangskollektivierung mit neuen Ideen auftrat, machte sich verdächtig. Nikolai Starostin, Mitbegründer von Spartak Moskau, wurde wegen „bourgeoiser Arbeitsmethoden“ zu Lagerhaft verurteilt. Ob Fußball als Ablenkung im Zweiten Weltkrieg oder als Statussymbol im Kalten Krieg: „Russkij Futbol“ erzählt sowjetisch-russische Geschichte durch das Brennglas Fußball, auch in einer gleichnamigen Plakatausstellung.
Eine relativ neue Entwicklung ist dabei die Unterstützung der Russisch-Orthodoxen Kirche. Ob Dopingvorwürfe, Korruptionsvergehen oder die Verletzung von Arbeitsrechten auf Stadionbaustellen – die Kirche habe sich stark an die herrschende politische Meinung angehängt, tindet die Theologin Regina Elsner, die sich am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin (ZOiS) mit der Russisch-Orthodoxen Kirche beschäftigt: „Seitdem sich der Druck auf Russland international erhöht hat, hieß es auch bei der Kirche immer mehr: Das sind Angriffe von außen, die Russland schaden wollen.“
Unter Wladimir Putin hat der Klerus an Einfluss gewonnen. Der Patriarch Kyrill hat als Vorsteher der Russisch-Orthodoxen Kirche mehrfach Sportler empfangen und in seinen Reden angesprochen, etwa im März 2018 die russischen Olympiasieger im Eishockey. Oft wird der Sport dabei als Instrument im „Kampf der Zivilisationen“ gedeutet, zur „Stärkung des Vaterlandes“. In Brasilien hatte die katholische Bischofskonferenz die Vorbereitungen auf die WM 2014 mit kritischen Kampagnen begleitet, auch gegenüber der Politik. Und in Russland? Für die Verjüngung ihrer Zielgruppen hat die Kirche 2015 ein Komitee für Sport eingerichtet. An der Basis werden Jugendhilfe und Drogenprävention mit Bewegungsangeboten bereichert. Aber aus Menschenrechtsfragen halten sich die Gläubigen heraus, sagt Regina Elsner: „Die Kirche ist inzwischen so eng mit der Politik verbandelt, dass sie eben doch etwas zu befürchten hätte. Vor zehn oder zwanzig Jahren wäre das anders gewesen.“
DFB unterstützt Zivilgesellschaft
Es ist ein komplexes Spannungsfeld, dem sich auch der DFB lange aussetzen musste. Die Ausgangslage einige Jahre vor dem WM war folgende: Halten sich die deutschen Funktionäre in Russland zurück, wird ihnen das als Anbiederei gegenüber Putin ausgelegt. Äußern sie scharfe Kritik, fühlen sich russische Eliten provoziert und laden ihren Ärger auf den Aktivisten ab. Wie politisch darf, wie politisch sollte der DFB handeln? Diese alte Frage wurde neu aufgelegt. Und der damalige DFB-Präsident Reinhard Grindel antwortete in der Regel so: „Wir möchten zivilgesellschaftliche Brücken bauen, ohne mit erhobenem Zeigefinger aufzutreten.“
Innerhalb des DFB wurden frühzeitig Projektpläne in Russland diskutiert. Während des Konföderationen-Pokals 2017 traf sich der DFB in Moskau mit Vertretern aus Stiftungen und NGOs. Grindel hielt eine Rede beim „Petersburger Dialog“, einem Forum, das seit 2001 die Verständigung zwischen den Zivilgesellschaften Deutschlands und Russlands pflegt. Der ehemalige Journalist und Bundestagsabgeordnete Grindel beschrieb Anekdoten der deutsch-russischen Fußballgeschichte, etwa das erste Spiel der DFB-Auswahl 1955 in Moskau. Wenige Wochen nach dem sowjetischen 3:2-Sieg setzte Bundeskanzler Konrad Adenauer die Freilassung der letzten deutschen Kriegsgefangenen durch. Einige von ihnen berichteten später, dass die Radioreportage des Länderspiels ein wichtiges Hoffnungssignal für sie gewesen war. Die Sowjetunion und die Bundesrepublik nahmen bald diplomatische Beziehungen auf.
Reinhard Grindel sprach beim „Petersburger Dialog“ auch über Fangewalt, Doping, Diskriminierung. Unterstützt wurde er von Thomas Hitzlsperger, der als DFB-Botschafter für Vielfalt seinen Lebensweg schilderte. Sowohl Menschenrechtler aus Deutschland als auch regierungsnahe Vertreter Moskaus fanden ihren Ton angemessen. Das gilt schon als Erfolg, weil es die reale Außenpolitik der Regierungen zumindest nicht erschwert.
Читать дальше