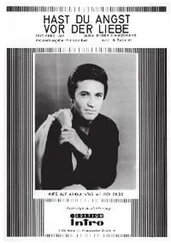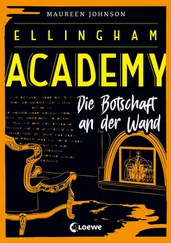Er sah längst über Georg hinweg, erzählte von der Reise mit der 250er BMW im Frühjahr 1943 an den Königssee, »trotz Krieg«, und hielt nicht einmal inne, als die Tür aufging und Mutter zurückkehrte. Sie sah ihren Mann, aufgeräumt und munter im Bett sitzend, und erkannte schnell, dass das Wesentliche gar nicht zur Sprache gekommen war. Ja, die Fahrt mit dem Motorrad von Berlin nach Berchtesgaden, diese Geschichte habe sie immer so gern gehört, sagte Mutter.
Georg stand auf. Ihm war schlecht. Er würde jetzt verschwinden, nur raus aus diesem Zimmer. Er ging ans Bett und gab seinem Vater die Hand. Georg wurde schwarz vor Augen, er suchte Halt bei Vaters Hand, spürte, wie die Beine wegsackten, hörte noch einen Aufschrei und alles war weg.
Das Gespräch am Stehtisch bei Tchibo erstarb. »Camille«, hauchte Roland. Gerade hatte Volker noch den Mund aufgerissen und Nixon einen Kriegstreiber genannt, der niemals Präsident einer Supermacht hätte werden dürfen. Georg und seine Freunde wussten, dass jetzt Hans-Gerds Erklärung der ewigen Verdammnis der USA folgen würde. Erst vor einer Woche hatte er in Geschichte ein Referat über die Supermacht und den Vietnam-Krieg gehalten, das Dr. Wagner prompt als »antiamerikanisch durchseucht« beurteilt hatte. Doch in dem Augenblick, in dem Hans-Gerd Atem geholt und den Mund geöffnet hatte, kam sie herein.
Die Jungen wurden still. Alle vier schauten sie an. »Camille«, hauchte Roland noch einmal. Da stand sie an der Verkaufstheke, bat um ein Pfund Klassik-Mischung, »oh bitte sehr, für die Kaffeemaschine, fein gemahlen, sehr fein«. Sie sprach mit diesem wunderbaren französischen Akzent, der allein die vier in Hochspannung versetzte.
Camille stammte aus Martinique, war vor fünf Jahren mit ihrem Mann hierher gekommen. Jeder in Langenheim, vor allem jeder Mann ab 15, wusste, wer Camille war, diese schlanke, schwarze, nein schokoladenbraune, wunderhübsche Frau, die Model in Paris gewesen war und noch heute gelegentlich für deutsche und internationale Modezeitschriften arbeitete. Jetzt stand sie keine anderthalb Meter vor Georg, eine mittelgroße Frau, wohl ein Meter siebzig, schätzte er. Er sah ihren langen Hals, den Übergang zum kurzen, äußerst feinen und kraus gedrehten schwarzen Kopfhaar. Sie wartete vor dem Verkaufsstand. Ein leichter, aufregender Duft ging von ihr aus, kein 4711 Kölnisch-Wasser oder Tosca, das Georg von seiner Mutter kannte, sondern etwas ganz anderes, Fremdes.
Die Kaffeebohnen liefen durch die laut scheppernde Mühle. Die Verkäuferin fragte, wie es dem Sohn ginge. »Gut, sehr gut! Paul ist im Kindergarten«, sie sprach den Namen ihres Kindes französisch aus. Da fuhr sie plötzlich mit der rechten Hand nach hinten an ihren Haaransatz, hob einige Male das krause kurze Haar mit ihren Fingerkuppen ein wenig an und ließ anschließend die Finger langsam durch ihr Haar gleiten.
Georg sah ihre schlanke Hand, die langen Finger, den goldenen Ehering und einen weiteren goldenen Ring mit drei glitzernden Steinen an ihrem Mittelfinger, die Fingernägel waren fein lackiert, nicht rot, sondern mit einem durchsichtig schimmernden Lack. Das kurze Haar war widerspenstig, es ließ sich durch die Berührung von Camilles Fingern in keiner Weise glätten oder sonstwie bändigen. Dann glitt ihre Hand langsam an ihrer rechten Wange entlang, fuhr den Hals herab und verschwand aus Georgs Blickfeld. Seine Augen wanderten zu Camilles schwarz-weiß gestreiftem Sommerkleid, das das obere Drittel des Rückens frei ließ.
Es war erst Mitte Juni, schon recht warm, aber nicht heiß, die Langenheimer Frauen trugen um diese Zeit meist noch eine dünne Jacke über dem Kleid, nicht aber Camille. Georg starrte auf ihre dunkle Haut. Sein Blick folgte dem Rücken, das Kleid saß eng, betonte den Po, schlank, keine pralle Kugel, die den Stoff spannte, sondern einfach fest und straff. Er träumte davon, ihn zu berühren.
Dann nahm sie die Packung mit dem fertig gemahlenen Kaffee, steckte das Wechselgeld mit ein paar netten Worten an die Verkäuferin in ihre kleine schwarze Ledertasche, drehte sich zu den Jungen am Stehtisch, lachte sie freundlich an und verließ das Geschäft mit einem fröhlichen und französisch akzentuierten »Auf Wiedersehen«. Die vier schauten ihr nach, ihren feinen weißen Schuhen mit den spitzen Absätzen, ihren langen schlanken Beine, die keine großen Schritte machen konnten, denn knapp über dem Knie begann das eng anliegende Kleid. Als sie aus ihrem Blickfeld verschwunden war, senkten alle vier wie auf Kommando ihre Blicke auf die leeren Kaffeetassen.
»Es hat sich doch gelohnt, die sechste Stunde blau zu machen und statt Reli …«, Roland ließ den Satz unvollendet.
»Glückspilz, dieser Manfred Schümann«, sagte Volker. »Maler müsste man sein, in Paris leben und auf so eine Frau stoßen!«
»Und dann nach Langenheim mit ihr ziehen?«, wandte Georg ein.
»Pourquoi pas? Mit ihr kann man auch in Langenheim glücklich sein.«
Hans-Gerd schien keine Lust mehr auf seine Verdammung der USA zu haben und verließ mit einem »Ich muss jetzt gehen« die Runde. Die drei beschlossen, einen weiteren Kaffee zu trinken, 40 Pfennige waren für jeden noch drin. Aber das Gespräch kam nicht wieder in Gang. Jeder schien seinen Gedanken nachzuhängen, die wahrscheinlich irgendwie um Camille kreisten.
Georgs Eltern waren letztes Jahr bei einem Abendessen gewesen, zu dem Herr Schnakel, Vaters Chef, eingeladen hatte und an dem auch Manfred Schümann mit seiner Frau Camille teilnahm. »Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie elegant diese schwarze Frau ist«, hatte Mutter am nächsten Tag Bärbel und ihm erzählt. »Mit ihrem feinen Schmuck und diesen großen Augen! Bei einer Schwarzen wirken die ja noch viel ausdrucksvoller! Und ihr Mann, dieser Manfred Schümann, ein richtiger Künstler, so mit längerem Haar, aber ein ganz feiner Mann, hat in Rom gelebt und natürlich in Paris, und dann trug er den ganzen Abend so einen cremefarbenen Seidenschal!« Mutter schwärmte. Vater hatte überlegt, ein Bild des Malers zu kaufen, den Vorsatz aber bisher nicht umgesetzt. Vielleicht könnte er ihn daran erinnern. Er würde gern mit ihm ins Atelier des Malers gehen und etwas aussuchen. Da würde es wahrscheinlich jede Menge Bilder von Camille geben, vielleicht auch welche, auf denen sie …
Georg unterbrach den Gedanken. Es würde ihm ja doch nicht gelingen, Vater zu einem Atelierbesuch zu bewegen. Ihm nicht, Bärbel vielleicht. Ein Vorschlag von ihm wäre sinnlos nach diesem Streit mit Vater. Seit Georg das Buch von Peter Weiss gelesen und Vater darauf angesprochen hatte, war es richtig schlimm geworden. Aber jetzt wollte er nicht an diese elenden Streitereien und auch nicht an »Die Ermittlung« denken, jetzt nicht, wo dieses Parfum noch im Raum war und dieses Bild von Camille. Sie hatte Mutter bei dem Abendessen damals erzählt, dass sie gerade von einem anstrengenden Foto-Shooting aus Hamburg zurück sei, und Mutter hatte bei ihrem Bericht am nächsten Tag zugegeben, dass sie gar nicht gewusst hätte, was denn ein Foto-Shooting sei. Auch Georg hatte an jenem Sonntagmorgen begonnen, darüber nachzudenken, sicherlich anders als seine Mutter. Er wusste, dass Manfred Schümann neben seiner Tätigkeit als Maler die Firma Flocke, Langenheims große Strumpf- und Wäschefirma, beriet und in einem großen Haus am Stadtwald wohnte, einem Haus mit Studio. Design, Plakate, Werbeauftritte der Firma, so berichtete Mutter weiter, würden alle über Herrn Schümanns Schreibtisch gehen. Diese Tätigkeit hätte die beiden auch bewogen, sich in Langenheim niederzulassen, aber – so Vater bei dem Bericht am Esstisch voller Anerkennung – »sie haben noch eine Wohnung in Paris, im sechsten Arrondissement.«
Georg hatte bei dem Bericht zu träumen begonnen. Camille, Paris, Foto-Shooting, Models, das klang gut. Er hatte als Sängerknabe zweimal in Paris gesungen, einmal die Matthäus-Passion und einmal die frühen Italiener mit seinem Allegri-Solo. Ihr Probenleiter Gambinger hatte es damals so eingerichtet, dass sie Zeit für eine Bustour durch die Stadt hatten und sogar auf den Eiffelturm hatten steigen können. Schon damals war ihm aufgefallen, wie viele Farbige in Paris lebten. Ganz anders als in Regensburg oder in Langenheim. Ob sich Camille wohlfühlte in Langenheim? Sie war die einzige Farbige in der Stadt. Ein paar italienische Gastarbeiter waren auch recht dunkel, aber nicht farbig. Wie sich diese dunkelbraune Haut wohl anfühlte? Einige sprachen in Langenheim abschätzig von den Itakern, wenn sie die sizilianischen Männer meinten, die bei dem großen Automobilzulieferer arbeiteten. Ob Camille auch jemals abschätzige Bemerkungen gehört hatte? Der Gedanke irritierte ihn, er hoffte, dass dies nie geschehen sei und nie geschehe, und er sah noch einmal ihre lange schlanke Hand, die mit den krausen Haaren spielte.
Читать дальше