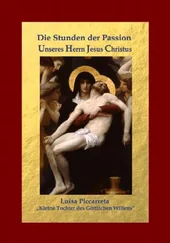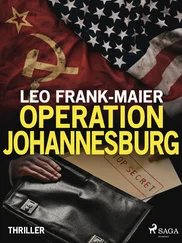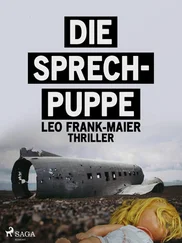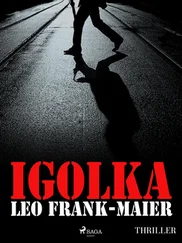Er sah unter den Bürotischen und - sesseln nur die Beine von vier Geiseln, durchwegs Frauen. Die anderen Geiseln waren hinter der Mauerecke, wo der Stiegenabgang zum Saferaum war. Wahrscheinlich hatte der Gangster die männlichen Geiseln näher zu sich beordert, um sicherer zu sein, daß keiner davonrannte. Für Pierre war jetzt nichts zu tun als ruhig zu liegen und abzuwarten. Sollte der Gangster mit Geiseln die Bank verlassen wollen, müßten sie rechts von Pierre vorbeikommen. Dorthin zu dem schmalen Durchgang durch das Schalterpult hatte Pierre gute Sicht gegen die hellen Glasscheiben im Hintergrund. Und freies Schußfeld. Darin bestand die Chance, die sich der Chefinspektor ausgerechnet hatte. Das Risiko war, daß Pierre vorzeitig entdeckt wurde. Blieb also wirklich nichts anderes übrig, als still dazuliegen, den Hustenreiz zu unterdrücken und die acht Damenbeine anzustarren, aus einer Entfernung von circa sechs Metern. Einem der Beine fehlte ein Schuh. Ein Beinpaar war ständig in leichter Bewegung, wahrscheinlich war die Dame nervös, Pierre konnte von Zeit zu Zeit ihr Unterhöschen sehen. Es war blau und es stand »Sonntag« darauf, eines von diesen Wochen-Set-Dingern. Heute war Freitag. In jeder anderen Situation hätte ihn das amüsiert. Christin hatte gern diese Art von Unterwäsche getragen: Sieben reizende Dinger, in rosa oder blau, in allen Farben eben, und auf allen war der Wochentag gedruckt, von Montag bis Sonntag, praktisch. Man brauchte nur jeden Tag das passende aussuchen. Ein Verkaufsschlager, damals als er Christin kennenlernte. Irrtümer waren fast ausgeschlossen, wenn man den Kalender im Kopf hatte – jeder Tag sein eigenes Höschen – Gebot unseres hygienischen Zeitalters. Sicher kam die Idee von Amerika. Christin war damals ganz begeistert. Pierre erinnerte sich an die ersten Schwierigkeiten: Wenn Christin ihre Tage hatte, bevorzugte sie dunkle und stärkere Höschen. Das war eben so. Dann kam der ganze Zeitplan durcheinander. Wegen der »Monatshöschen«. Wahrscheinlich ging es der Geisel sechs Meter vor ihm ebenso. Pierre hätte sie gern gefragt, aber das war jetzt nicht möglich. Wahrscheinlich auch später nicht.
Ja Christin, wenn sie ihre Tage hatte und die dunklen Höschen trug, ohne Aufschrift, das waren problematische Tage, auch für Pierre. Und immer schlimmer wurde es. Es war jetzt gespenstisch still in der langen Schalterhalle. Nur undeutlich und wie aus einer anderen Welt vernahm man den Straßenlärm von draußen. Eine Frau unter den Geiseln wimmerte manchmal oder weinte kurz auf. Immer die gleiche, soweit Pierre feststellen konnte. Sonst war es still wie in einer Kirche.
Still wie in einer Kirche.
Pierre Cousteau sah zwei dunkle Flecken am Fußboden, unter seinem Gesicht, gleich darauf einen dritten. Erst jetzt merkte er, daß er schweißnaß war und es von seiner Stirn tropfte. Und dann hörte er plötzlich wieder diese Stimme in seinem Gehirn, wie damals, vor Jahren. »Bleib ruhig, Liebling, ich bin bei dir«, sagte diese Stimme. Er bekam die Gänsehaut, wie damals immer, und wurde wütend. Er spürte, wie sich seine Nackenhaare sträubten. Und er wehrte sich gegen dieses sonderbare Gefühl, das er nun so lange nicht mehr gespürt hatte. Es war einfach lächerlich und undenkbar, unlogisch, und es war der unmöglichste Ort und die unglaublichste Situation, gerade jetzt an seine Frau denken zu müssen. »Bleib ruhig, ich bin bei dir.« Es war die Stimme Christins, die er in seinem Schädel hörte.
Christin Maginot wurde 1953 geboren, in einem kleinen Dorf namens Orbey im Oberelsaß. Sie war das fünfte Kind, und ihr Vater, der alte Pierre Maginot, war Bauer und Totengräber zugleich. Sie war schon fast zwei Jahre alt, als ihm zum erstenmal der Gedanke kam, daß mit seinem fünften Kind etwas nicht stimmte.
Denn daß sie als Baby fast niemals geschrien hatte, ganz anders als seine vier älteren Kinder, durchwegs Buben, daß sie immer freundlich lächelte, wenn jemand an die Wiege herantrat, war ihm nicht besonders auffallend erschienen. Mit zwei Jahren aber sprach sie immer noch kein Wort, obwohl sie alles zu verstehen schien. Dann war die Sache mit den Stubenfliegen. Die kleine Christin verscheuchte sie nicht mit ärgerlichen Handbewegungen, wie ihre Geschwister es taten. Sie breitete im Gegenteil ihre kleinen Ärmchen aus und ließ die Fliegen daran herumkrabbeln, schien sich darüber auch noch zu freuen und lächelte ihr sonnigstes Lächeln. Und ihre Augen wurden dunkel und traurig, wenn Pierre Maginot ihr die Fliegen verscheuchte. Ihm kam seine einzige Tochter also damals schon sehr komisch vor, aber mit seiner Frau konnte er darüber nicht reden. Denn seit sie nach Christins Geburt aus dem Wochenbett war, wurde sie krank und immer schwächer. Und sie starb fast auf den Tag genau, als Christin zwei Jahre alt geworden war.
Christin mußte die erste Klasse wiederholen, weil sie trotz intensiver Bemühungen von Madame Leclerc, das war die Lehrerin, nicht imstande war, die einfachsten Rechnungen zu lösen. Solange bei den Ziffern die Fingerchen reichten, ging es ja noch. Aber zweistellige Zahlen zu begreifen, ging über ihre Kräfte, da half kein Zureden und kein Schimpfen, Christinchen lächelte lieb und hilflos, es war jede Mühe vergebens. Dann passierte die Geschichte mit dem Bullen, des Nachbarbauern Jungstier, der böse und gefährlich war und deshalb geschlachtet werden sollte. Als das Vieh einmal über den Weidenzaun setzte und die Kinder in panischer Angst davonrannten, ging Christin Maginot auf den Stier zu, redete mit ihm und – was für ein Wunder – der Bulle wurde ganz friedlich und ließ sich von dem kleinen Mädchen sogar streicheln und folgte ihm wie ein braves Hündchen in den Stall. Das ganze Dorf redete davon, damals.
Vier Wochen durfte Christin täglich zweimal den Stier besuchen, ihn tränken und Futter vorwerfen, denn er war stets friedlich, wenn er das Kind nur von weitem spürte. Und der Nachbarbauer hoffte doch noch, er könnte den teuren Bullen erhalten und das Vieh würde zur Vernunft kommen. Aber wenn Christin nicht in der Nähe war, wurde es immer ärger mit dem Stier und er brüllte und attackierte alles, was sich in seine Nähe getraute. Schließlich schlachtete der Bauer dieses gemeingefährliche Biest, an einem Vormittag, als Christin in der Schule war; und als das Mädchen am Nachmittag den Stall leer fand und im Hof die blutigen Fleischteile hängen sah, rannte es heim und weinte drei Tage lang oder vier. Christin Maginot weigerte sich ab diesem Tag, Fleisch zu essen und dabei blieb es. Sie aß weder Fleisch noch Wurst und zuerst die Familie und dann das Dorf gewöhnten sich daran. Das war eben Christin Maginot, die »nicht ganz beisammen war im Kopf«.
Mit vierzehn konnte Christin leidlich lesen und schreiben. Sie ging bei der Dorfschneiderin in die Lehre, hatte flinke, geschickte Hände und wurde mit jedem Monat hübscher. Die Burschen im Dorf pfiffen und schnalzten mit den Zungen, wenn sie das Mädchen sahen.
Gustave, ihr ältester und Lieblingsbruder, hütete und beschützte sie und gab ihr manchmal auch kräftige Ohrfeigen, wenn sie spät nach Hause kam. Denn der alte Pierre Maginot war zu dieser Zeit schon fast immer betrunken und kümmerte sich um nichts mehr, ausgenommen um seinen Weinkeller. Dann kam die Zeit, in der Christin wöchentlich zwei- und auch dreimal abends zur Kirche ging und dort im Chor probte. Denn Christin konnte singen, daß einem die Augen feucht wurden. Beim Ave Maria am Sonntag in der Messe sang sie Oberstimme und die Gläubigen bekamen eine Gänsehaut. Ein junger Dorfpfarrer war da, der prächtig Orgel spielen konnte. Eines Tages nach einer Maiandacht kam Christin spät heim und sagte zu Gustave, daß sie nie mehr im Leben in die Kirche gehen werde. Gustave sprach lange mit ihr und ging dann ins Dorfwirtshaus und betrank sich. Zur Sperrstunde war er so voll und wütend, daß er schrie, er ginge jetzt geradewegs zur Pfarre und erwürge den Dorfpfarrer, dieses Schwein. Er tat es aber dann doch nicht. Christin war konsequenter. Sie ging tatsächlich nicht mehr zur Kirche. Ein Jahr später, es war wiederum im Mai, wurde Christin wieder einmal sehr sonderbar. Sie aß fast nichts und starrte stundenlang zum Fenster hinaus. Ihre Augen wurden ganz hell und ihr hübsches Gesicht eigenartig verzückt, als ob sie geradewegs in den Himmel sehen könnte. Ihre Brüder hatten längst aufgehört, sich über sie zu wundern, nur Gustave schüttelte sie manchmal und schrie ihr in die Ohren, als ob er sie aufwecken müßte. Sie weinte dann manchmal, so wie wenn man ihr etwas Wundersames weggenommen hätte, aber sie war Gustave niemals wirklich böse, er blieb ihr Lieblingsbruder. Als der Zirkus ins Dorf kam, nahm sie Gustave zur Abendvorstellung mit, um sie auf andere Gedanken zu bringen, wie er sagte.
Читать дальше