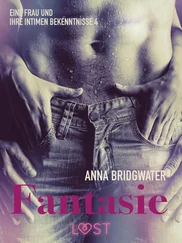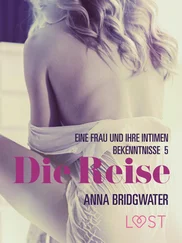Ich versetzte mich im Geiste in die Wohnung meiner Eltern und sah die beiden alten, verzweifelten Menschen um meine Lagerstatt kreuzen, die mit Ausnahme der ersten Armeetage, als ich noch in der Kaserne wohnen mußte – wobei sich jedoch Paps und Mutsch unter den Barackenfenstern abwechselten, um mir im Bedarfsfalle mit Rat und Tat beizuspringen – und mit Ausnahme der Hopfenernte – wobei sie meine Klassenlehrerin für Sonderüberwachung bezahlten –, die seit meiner Geburt das erste Mal leer blieb. Was werde ich ihnen sagen? Werde ich gestehen? Ich stellte mir das Wehklagen meiner Mutsch vor und die schlaffen Schultern meines Paps, die uferlose Trauer derer, denen ich das ganze Leben lang eine einzige Hoffnung war. Also eine Ausrede suchen? Ableugnen? Ja, das war der rettende Gedanke! Ich werde meinen Chef bitten, mir zu bestätigen, daß das Fest bis zum Morgen dauerte und ich meinen Standplatz nicht habe verlassen dürfen. Ach, wie zahlt es sich für mich aus, daß ich noch nie gelogen habe, desto eher wird man mir jetzt Glauben schenken ... doch wie mache ich das meinem Chef klar?! War es nicht gerade er, der mir meine Frau samt dem Helikon anvertraute, damit ich sie unbeschadet an den sicheren Ort schaffte?
Diese Vorstellung war noch schlimmer als die erste. Meine Eltern würden mich gewiß bestrafen, doch ich durfte nicht nur damit rechnen, daß sie mir eines Tages verziehen, sondern vor allem auch damit, daß die Nachricht über meinen Fehltritt nie über die Schwelle unserer Wohnung kam. Bei meinem Chef drohte mir das genaue Gegenteil. Er konnte mir für meinen Fehltritt weder eine Prämie abziehen noch eine Rüge erteilen, da ich ihn außerhalb der Arbeitszeit und des Dienstraumes begangen hatte. Er konnte aber – was weit schlimmer war – die Geschichte in allen Amtszimmern und Arbeitsstätten des Betriebes ausposaunen. Ich erinnerte mich an die perverse Lust, mit der er meine Auskünfte über das Intimleben der Mitarbeiter, denen ihrerseits meine völlige Unbescholtenheit die Sprache verschlug, angehört hatte, wie an die ruchlose Freude, mit der er meine Informationen brühwarm, noch vor mir, telefonisch an Vorgesetzte und Bekannte weitergab. Nein!! Ihm mein Geheimnis anzuvertrauen hieße, mich selbst an den Pranger zu stellen. Das, worauf ich seit meiner Kindheit so viel gegeben, was ich so gehätschelt, sorgsam gehütet und sparsam gemehrt habe, meine Ehre nämlich, der einzige Schatz meines alltäglichen und faden Lebens, der mir ein Gesicht gab, vor allem aber die Hoffnung in mir nährte, ich würde irgendwann irgendwo irgendwie irgendwem begegnen, der diesen Schatz gebührend würdigte und als überaus kostbares Geschenk annahm, um mir dafür zur Vergeltung allezeit sich selber zu schenken, das war plötzlich in Gefahr, aufs Spiel gesetzt, auf Gnade und Ungnade preisgegeben, hatte seinen Sinn verloren wie, so sagte man uns bei der Schulung treffend, eine glückliche Zukunft ohne Kommunismus.
Die meisten Frauen, an die ich ab und zu dachte – ich hatte mich seit den Zeiten von Tante Eliška, der Schülerin Paulová und Hauptmann Kverková auf einen robusten Typ festgelegt, der mir an Temperament, Gewicht und Alter überlegen war, was uns beiderseitige Befriedigung verschaffte –, also die meisten meiner kindlichen Idole stellten offensichtlich keine übertriebenen Ansprüche an ihre Liebhaber. Wie ich wußte, ging eine sehr unterschiedliche Prozession von Männern durch deren Arme; für eine oder mehrere Nächte fand in ihnen nicht nur mein Chef oder unser Generaldirektor eine warme Ruhestatt, sondern auch unser Garagenmeister und unser Heizer, dessen einziger sichtbarer Vorzug die hundert Kilo Lebendgewicht waren, deren gute Hälfte sein Bierbauch ausmachte. Im selben Augenblick jedoch, da sie einen künftigen Ehemann ins Auge faßten, verwandelten sie sich in hochgeschlossenste Puritanerinnen. Auf der Herrentoilette, die nur durch eine dünne Trennwand von dem Raum abgeteilt war, wo sie sich frischmachten, hörte ich so manches Gespräch mit, in dem sowohl der Chef als auch der Generaldirektor, der Garagenmeister und der Heizer mit einem häßlichen Wort bedacht wurden, das belegte, daß sie trotz des flüchtigen Sinnesrausches nicht eine Prise Achtung für sie übrig hatten. Kein Zweifel, daß sie ihren Mädchennamen nur dem zu opfern bereit waren, der ihnen als Gegenleistung einen überließ, dem nicht einmal der Hauch von Schande anhaftete, einen Namen, mit dem sie sich vor Verwandten und Bekannten brüsten konnten, einen Namen, der ihnen Gewicht verlieh und den berechtigten Neid der weitläufigen Umgebung weckte. Mit eigenen Ohren hörte ich eines Tages durch die Trennwand, wie die Sekretärin des Generaldirektors wörtlich sagte:
«Es ist eine Tragödie, meine Damen, doch der einzige Mann, der hier kein Ferkel ist, heißt Vilémek Rosol!»
Wozu ich bemerken muß, daß ich damals tatsächlich so lächerlich und würdelos hieß, wie ich gerade erwähnte: Vilém Rosol, was ja Sülze bedeutet. Die Bemerkung dieser begehrenswerten Frau kam mir in den Sinn, als der Sonnenstrahl, der durch die Garçonnière meiner Frau wanderte, das Messing des Helikons, das über unserer Bettstatt hing, erneut aufflammen ließ. Das unheilbringende Instrument, die Ursache meines Sündenfalls, warf die Couch und uns beide gleich dem Zerrspiegel im Irrgarten zurück. In diesem Spiegel wirkten unsere entblößten Leiber noch unzüchtiger, deshalb schloß ich vor Abscheu und Reue die Augen. In diesem Moment war ich überzeugt, daß meine Situation ausweglos war und daß alles weitere Leben jeglichen Sinnes entbehrte. Ich verlor die Beherrschung, und ein Schluchzen drang aus meiner Kehle. Da hörte ich aus nächster Nähe jene eigenartige Stimme, die mich, wie ich endlich wußte, an das Geräusch zerreißenden Schmiergelpapiers erinnerte.
«Du lieber Himmel, was haben wir denn?»
Ich wandte den Kopf und öffnete die Augen. Die scheußliche Karikatur verschwand. Wieder sah ich den leidenschaftlichen, mit einer leichten Andeutung von dunklem Lippenbart verzierten Mund, das energische Kinn, den festen Hals und weiter unten die ganze athletisch gewölbte Gestalt meiner Frau.
«Ach, du meine Güte», sagte sie erstaunt, «das Kleinchen weint ...!»
Bis dahin hatte mich noch nie eine Frau, mit Ausnahme meiner Mutter, der Tante Eliška, der Schulkameradin Paulová, Hauptmann Kverková und meiner Lehrerinnen weinen sehen. Tapfer schluckte ich die Tränen herunter und trachtete, mich mit aller Kraft zu beherrschen, doch nichts half. Denn zu allen meinen schwarzen Gedanken gesellte sich unverhofft ein weiterer, der stärker als alle anderen war.
«Was Sie wohl jetzt von mir denken werden ...»
«Was soll ich mir wohl denken?»
«Ich sehe Sie zum ersten Mal ... und schon laß ich mich zu Ihnen nach Haus einladen ... und jetzt ... jetzt lieg ... jetzt lieg ich hier so ...»
Sie richtete sich auf, und Besorgnis schwang in ihrer Stimme mit.
«Hat es dir nicht gefallen, Bübchen?»
Meine Antwort waren Schluchzer. Beunruhigt wiederholte sie ihre Frage.
«Do ... doch ...» brachte ich schließlich hervor und barg das Gesicht in den Händen, da ich spürte, wie ich wieder rot wurde.
«Na, warum heulst du mir hier rum?»
«Weil ich ... weil ich nicht so einer bin ...»
«Was für einer?»
«So einer ... der gleich mit jeder schläft ...»
Die Worte, mit denen sie mich zu trösten versuchte, bestätigten meine schlimmsten Befürchtungen.
«Was zerbrichst du dir darüber deinen Kopf, Butzemännchen? Ich bin schließlich eine moderne Frau, und du bist letzten Endes ein Mann!»
«Nein!» schrie ich auf und wiederholte bei einem neuerlichen Weinanfall, «ich bin nicht, ich bin nicht so einer!»
Mich entsetzte, daß sie nicht sogleich antwortete. Dann spürte ich ihre Hände auf den meinen. Vergebens sträubte ich mich. Sie war stärker und zog mir die Hände mühelos vom Gesicht fort. Durch einen Tränenschleier erblickte ich ihre Augen. Sie waren ernst und zutiefst bewegt.
Читать дальше