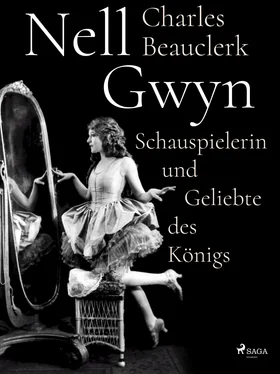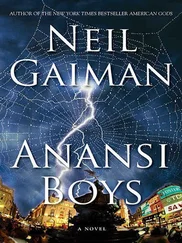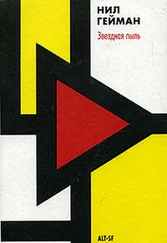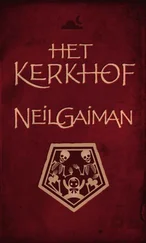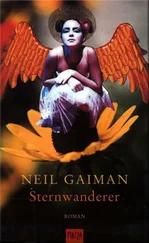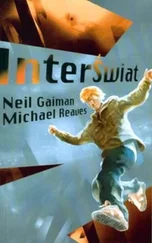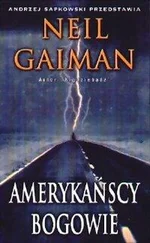1 ...6 7 8 10 11 12 ...30 Die Tatsache, dass der bekannteste damalige Konstitutionalist, Edward Hyde, Earl von Clarendon und gemäßigter Abgeordneter im Londoner Parlament unter Charles I., vom König im Exil zum Lordkanzler ernannt worden war, dass er die Deklaration von Breda verfasst hatte und jetzt als oberster Minister fungierte, bedeutete für das Volk ganz eindeutig, dass der König keineswegs die absolute Monarchie anstrebte. Die wahre Gefahr ging von einer ganz anderen Seite aus. Wie Clarendon in seinen Erinnerungen selber schreibt, hatten die achtzehn Jahre des Bürgerkriegs und der Diktatur das Land traumatisiert, und eine ebensolche Bedrohung ging nun ebenfalls von den Menschen aus, die in der Zeit von 1642 bis 1660 herangewachsen waren, denn ihnen fehlten die natürlichen Bindungen und Loyalitäten, die eine zivilisierte Gesellschaft ausmachen. Er geht sogar so weit, vom Zusammenbruch der bürgerlichen Gesellschaft zu sprechen, und meint, dass noch im Jahr 1660 der Geist der Revolution seinen Schatten auf das politische Leben in England warf.
Schon Charles I. hatte in seiner Rede auf dem Schafott deutlich gesagt, dass die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und dem Parlament von, wie er sie nannte, »üblen Kräften« fehlgedeutet und übertrieben worden waren, von Männern, deren angebliches Eintreten für die Freiheiten des Volkes nichts anderes war als ein Trick, um an die Macht zu gelangen. Diese Leute hatten die Mehrheit seiner gesetzesfürchtigen Untertanen getäuscht und den Krieg herbeigeführt; ihnen lag nichts daran, lediglich die königlichen Vorrechte zu beschränken, nein, sie waren durch und durch Republikaner. Und diese Männer waren mit der Restauration nicht verschwunden, sie hatten nur ihre Kleider und ihre Ausdrucksweise gewechselt und warteten ab, bis ihre Zeit wiederkäme. Und wir werden sehen, dass ihre subversive Tätigkeit erneut spürbar wurde, sobald Clarendon im Jahr 1667 seines Amtes enthoben worden war. So geht es zu auf der Bühne der Politik.
Das Theater ist eine gute Metapher für die oberflächlichen, aber auch für die tiefer gehenden Veränderungen, die die Restauration mit sich brachte, und dieser Vergleich sagt auch einiges aus über Charles’ amüsierte, recht verschmitzte Art, mit den einhelligen Bekundungen der Zuneigung umzugehen, die ihm bei seiner Rückkehr entgegengebracht wurden. In aller Eile wurden Schiffe umgetauft und königliche Wappen erneuert (d.h. man entfernte die Insignien der Protektoratszeit), die Mode zeigte sich wieder elegant, die Maibäume wurden aus den Lagerschuppen hervorgeholt, und die Theater öffneten erneut ihre Tore. Charles war entschlossen, all das zu genießen, solange es währte, war aber gleichzeitig realistisch genug, um zu wissen, dass sich die Lage sehr rasch wieder ändern konnte, ja ändern würde. Er war ganz gewiss ein Mann, der viele Rollen zu spielen verstand, und deshalb wollen wir uns an dieser Stelle fragen, was für ein Mensch der dreißigjährige, frisch auf den Thron gehobene König eigentlich war, denn sein Charakter und seine Lebenseinstellung sind für unsere Geschichte von wesentlicher Bedeutung.
Zunächst sei daran erinnert, dass das Jahr 1660 eigentlich schon das zwölfte Jahr von Charles’ Regentschaft war. Das ist wichtig, denn es bedeutet, dass die übrigen europäischen Monarchen seiner Zeit ihn mit Missachtung, ja Verachtung behandelt hatten, obwohl er doch bereits während der Zeit seines Exils ein regierender Monarch mit einem regelrechten, wenn auch dezimierten Hof war. Es lässt sich wohl kaum ermessen, wie schwer die Demütigungen vonseiten derjenigen auf ihm lasteten, von denen er zu Recht Achtung, wenn nicht sogar Unterstützung hätte erwarten dürfen. Von seinen königlichen »Vettern« ignoriert und in die Verbannung geschickt, war Charles gezwungen, ein mittelloses Wanderleben zu führen. Und das ist keineswegs eine romantische Übertreibung, wissen wir doch aus den Berichten von Clarendon und anderen Kavalieren, dass es selbst dem König oft an Nahrung, Wärme und sauberer Kleidung mangelte.
Die Wochen nach der Schlacht von Worcester, in denen sich Charles verborgen halten musste und während deren viele seiner katholischen Untertanen ihm eine ungewöhnliche Loyalität bewiesen, haben seine von Natur aus vorhandene Neigung noch verstärkt, die Menschen nach ihrem Charakter zu beurteilen und nicht nach ihrem Glaubensbekenntnis. Die heuchlerische und moralinsaure Langeweile seiner presbyterianischen Gastgeber in Schottland hingegen hatte ihn in seiner Abneigung gegen religiösen Fanatismus nur noch bestärkt. (Charles war der Ansicht, der presbyterianische Glaube sei »als Religion für einen Gentleman nicht geeignet«.) Genau wie sein Großvater mütterlicherseits, Heinrich IV. von Frankreich, von dem der berühmte Ausspruch stammt, Paris sei wohl eine Messe wert, konnte Charles religiöse Dogmen nicht ernst nehmen. Wie der Historiker Hesketh Pearson feststellt, »tolerierte er alle Glaubensüberzeugungen und stand allen gleichgültig gegenüber. Ihm war die persönliche Aufrichtigkeit wichtiger als irgendein Glaubensbekenntnis«. 4Charles’ ehemaliger Kaplan, Bischof Burnet, hat einmal gesagt, der König habe seinen eigenen Glauben bzw. seine eigene religiöse Philosophie, und das mutet uns heute ungewöhnlich modern an. Er glaubte, Gott würde einen Menschen niemals dafür verdammen, dass er das Leben mit allen Sinnen genieße, solange er damit anderen nicht schade, denn »das Einzige, was Gott verabscheut, sind Bosheit und die Absicht, Schaden zuzufügen«. 5Der König besaß, wie Burnet halb bewundernd feststellte, eine außergewöhnliche Selbstbeherrschung.
Angesichts seiner frühen Erfahrungen verwundert es nicht, dass Charles eine eher zynische Auffassung von der Beständigkeit des Menschen und seiner dauerhaften Treue vertrat und dass er sich eisern vornahm, stets das eigene Interesse vor das der anderen zu stellen, ganz besonders dann, wenn er damit zum Wohl des Reiches beitrug. Und er hatte gelernt, dass die Menschen ihren König nur respektieren, wenn der seine Macht und Autorität auch geltend macht. All das Gold und die guten Wünsche, mit denen ihn ausgerechnet jene bei seiner Wiedereinsetzung überhäuft hatten, die ihn in den Zeiten der Not im Stich gelassen hatten, werden den König in seiner skeptischen Haltung, niemandem zu trauen, nur noch bestärkt haben.
Charles’ eigene Tugenden, wie Geduld, Stärke und Unparteilichkeit, aber auch der Wille, sich nicht der Verzweiflung anheim zu geben, waren ebenso verantwortlich für seine Restauration wie die Ereignisse in England, die sich seinem Einfluss entzogen. Was an den Jahren im Exil so erstaunt, ist nicht die Lasterhaftigkeit oder das ausschweifende Leben des Königs, denn die Berichte darüber entsprangen weitgehend den Hirngespinsten puritanischer Einbildung und Propaganda, sondern vielmehr seine bemerkenswerte Selbstbeherrschung und Mäßigung. Man könnte sagen, Charles’ Genialität bestand darin, dass er sowohl Distanz zum Volk und den Ereignissen bewahrte als auch beides akzeptierte. Es war ihm gelungen, auf der Welle der Politik zu reiten, ohne von ihr hinweggespült zu werden, und seine Leiden hatten ihn gelehrt, ein aufrichtigerer Demokrat zu sein als seine republikanischen Widersacher. Er hatte gelernt, einen Menschen nicht nach seiner Geburt oder seinem Stand zu beurteilen; wahrer Adel, das wusste er, war eine Charaktereigenschaft.
Im Gegensatz zu seinem Vater, Charles I., und seinem Großvater, James I., die beide eine streng theoretische Auffassung von der Monarchie vertreten hatten, scherte sich Charles II. nicht im Geringsten um politische Abstraktionen und Theorien, denn er wusste nur zu gut, wie flüchtig solche Konstrukte sein konnten. Er hatte eine ganz klare Vorstellung von seiner politischen Aufgabe: Er wollte sich auf dem Thron halten und die Rolle des Königs spielen. Er besaß jene alte, nicht von selbstzweiflerischen Lehren belastete elisabethanische Selbstsicherheit. Wenn er eine politische Philosophie vertrat, dann kommt sie am besten in seiner berühmt gewordenen Abwandlung der Stelle aus dem Buch der Könige zum Ausdruck: »Ich möchte, dass jeder Mann unter seinem eigenen Weinstock und unter seinem eigenen Feigenbaum sitzen kann.« Mit anderen Worten, er glaubte an wirtschaftlichen Wohlstand und an Gewissensfreiheit für alle. Mit seinem Charakter war er ideal geeignet für die konstitutionelle Monarchie und die Schaffung eines neuzeitlichen Staates. In den Auseinandersetzungen, die er mit dem Parlament über die Frage der religiösen Toleranz ausfechten musste, war, wie Churchill sagt, »seine Stimme die einzige, die moderne und tolerante Ansichten vertrat«.
Читать дальше