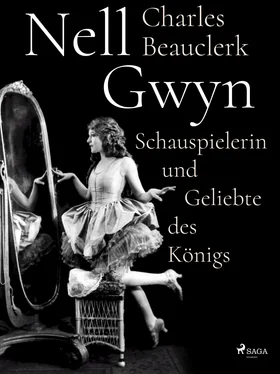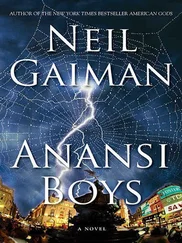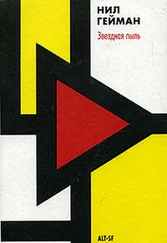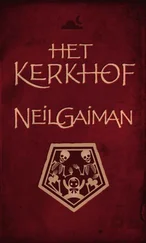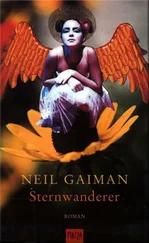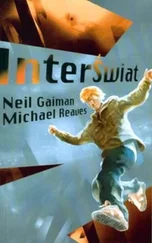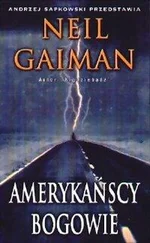Eine Anekdote aus John Downes Roscius Anglicanus (1708) vermittelt uns eine lebhafte Vorstellung davon, wie fürsorglich und treu die verlassenen Kinder der Drury Lane zueinanderhielten. Nells erste Liebe war ein »link-boy«, ein Fackelträger mit Namen Poor Dick, ein heimatloser Bursche, der überzeugt war, dass Nell die Tochter eines Lords sein musste, denn anders konnte er sich ihre außergewöhnliche Schönheit nicht erklären. Der Anblick ihrer nackten, mit Frostbeulen übersäten Füße tat ihm in der Seele weh, und so kaufte er ihr von seinem mageren Lohn ein Paar feine, wollene Strümpfe. Nell zufolge hat er sie ihr selber angezogen und gesagt, wobei seine Tränen auf ihre Frostbeulen fielen, er wäre der glücklichste Mensch auf Erden, wenn die Strümpfe ihr gut täten.
Natürlich ist diese Geschichte nicht belegt, doch sie zeigt uns, dass Nells Schönheit und ihr liebenswertes Wesen ihr bereits in jungen Jahren tiefe Freundschaft und Treue beschert haben. Im Laufe unserer Geschichte werden wir übrigens noch sehen, dass Nell vieles in ihrem Leben ihren zarten und überaus reizenden Füßen zu verdanken hatte. Interessant ist, dass in China, dem Land, aus dem die Geschichte vom Aschenputtel stammt, ein kleiner, wohlgeformter Fuß als Zeichen ungewöhnlicher Tugend und Schönheit galt.
In den Spottversen jener Zeit wird die junge Nell Gwyn als »Cinder-Nell«, d.h. »Aschen-Nell« bezeichnet, denn man nahm an, das Reinigen des Ofens habe ganz gewiss zu ihren Pflichten im Freudenhaus ihrer Mutter gezählt. Ob dem wirklich so war, spielt keine Rolle, doch der Vergleich zeigt, dass ihre Kritiker sie unbewusst mit der Figur der Cinderella assoziierten. In A Panegyrick hieß es:
In ihrer Brust, selbst wenn sie Asche fegte,
der Traum von stolzer Hurerei sich regte.
Und der Verfasser von »The Lady of Pleasure«, vermutlich Etheredge, vermittelt uns ein lebhaftes Bild von Nell, der Straßengöre:
Wer sie sich durch die Straßen mogeln sah,
pechschwarz die Wangen und die Füße bar,
umwölkt von Asche ... Wer hätt’ da gedacht,
wie gut sie sich im Bett des Königs macht?
Wahrscheinlich niemand. Gewiss ist jedoch, dass die kleine Nell Geschichten über den König auf der anderen Seite des Wassers gehört hatte (in London wimmelte es nur so von Gerüchten über sein abenteuerliches Leben) und dass sie in Gedanken dem Tag seiner Rückkehr entgegenfieberte.
Nach dem Tod Cromwells legte sich zwar zunächst noch eine unnatürliche Ruhe über das Land, doch es sollte nicht mehr lange dauern, bis der Prinz aus Aschen-Nells Träumen in sein Königreich heimkehrte. Unter der fast monarchischen Herrschaft des Lordprotectors hatte die republikanische Bewegung viel von ihrer Kraft eingebüßt, und obwohl es immer noch nicht ungefährlich war, in der Öffentlichkeit vom König jenseits des Meeres zu sprechen, hegten doch immer mehr Menschen insgeheim den Wunsch, er möge zurückkehren. Als dann im Mai 1659 Olivers Sohn Richard die Macht aus der Hand glitt und er sich über den Kanal davonmachte, wurde im Parlament unweigerlich der alte Ruf nach dem König wieder laut.
Die Restauration
Cromwell war am siebten Jahrestag der Schlacht von Worcester gestorben, jener Schlacht, in der er den damals einundzwanzigjährigen König Charles II. besiegt hatte. Da der Gestank seiner verfaulenden Milz sowohl den Künsten der Einbalsamierer als auch der Bestatter trotzte, wurde Cromwell schon wenige Tage nach seinem Tod in einer privaten Zeremonie beigesetzt. Wie es dem königlichen Brauch entsprach, fertigte man daraufhin ein wächsernes Abbild des Lordprotectors an, das in Somerset House im Kerzenschein feierlich aufgebahrt wurde. Eben diesem erwies die Öffentlichkeit die letzte Ehre. Gegen Ende der zweiten Woche rückte man dann die Wachspuppe von Old Noll mit ihren Glasaugen wie einen Kranken in eine aufrecht sitzende Position und setzte ihr eine kaiserliche Krone aufs Haupt. Welch eine Ironie, jetzt, im Tod, erhielt er sie endlich, die Königswürde, nach der er sich ein Leben lang gesehnt hatte! Am Tag der Beisetzung selber, fast zwei Monate nach dem Tod des Lordprotectors, wurde sein ganz in schwarzen Samt gekleidetes und mit allen Insignien der Königswürde (Krone, Zepter und Reichsapfel) ausgestattetes wächsernes Abbild in einer offenen Karosse zur Westminster-Abtei kutschiert. John Evelyn war dabei. »Es war der fröhlichste Trauerzug, den ich je sah, denn abgesehen von den Hunden, die von den barbarisch johlend, saufend und Tabak schnupfend durch die Straßen ziehenden Soldaten verscheucht wurden, heulte niemand.«
Olivers Nachfolger im Amt des Protectors war sein dritter Sohn Richard, der im Volk allgemein als Tumbledown Dick bekannt war, der sehr wenig Verlangen nach Macht verspürte und noch weniger dazu fähig war, Macht auszuüben. Auf Druck der Streitkräfte, des Council of State und schließlich des Parlaments selber wurde er im Mai 1659 seines Amtes enthoben. Zwar fügte er sich ausgesprochen bereitwillig, traute sich aber nicht, den Palast von Whitehall zu verlassen, weil er fürchtete, wegen seiner Schulden verhaftet zu werden. Schließlich gelang es ihm zur Zeit der Restauration, sich über die Grenze nach Frankreich abzusetzen, wo er unter dem Namen John Clarke lebte. Es ist schon eine seltsame Fügung, denn genau wie König Charles II. führte er nahezu zwanzig Jahre lang ein unstetes Wanderleben auf dem Kontinent, bevor es ihm im Jahr 1680 gestattet wurde, in die Heimat zurückzukehren. 1
Als Charles am 25. Mai 1660 unter den Jubelrufen »Gott schütze den König!« in Dover an Land ging, hörte man seinen jüngsten Bruder, den Herzog von Gloucester, rufen: »Gott schütze General Monk!« Ohne Monk oder den »guten alten George«, wie ihn seine Soldaten nannten, hätte die Restauration wohl noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Nach dem fehlgeschlagenen royalistischen Aufstand vom August 1659 waren die Machtverhältnisse im Land unklar. Die Armee unter General Lambert stellte zwar eine Bedrohung dar, war aber desorganisiert und das Rumpfparlament wie stets äußerst unzuverlässig. Es stand außer Frage, dass Monk, der Oberbefehlshaber von Schottland und Sympathisant des Rumpfparlaments, der Einzige war, der die Ordnung wiederherstellen konnte. Selbst der König hatte sich nach dem Scheitern des zweiten Protektorats mit Angeboten an Monk gewandt, doch die Zeit war noch nicht reif gewesen, und der General hatte es abgelehnt, die königlichen Schreiben in Empfang zu nehmen.
Dann löste Lambert das Rumpfparlament auf, und Monk machte sich am 1. Januar 1660 halb aus Neigung, halb schicksalsergeben von Edinburgh auf nach Süden. Sein Ziel war es, die Freiheit und die Rechte der drei Königreiche »vor Willkür und Usurpation durch Tyrannen« zu beschützen. Auf seinem Weg nach London wurde Monk immer wieder mit Petitionen für ein freies Parlament bedrängt, doch er weigerte sich zu erklären, für wessen Seite er eintrat. Charles, der nervös wartend in Brüssel bereitstand, nahm durch seine Vermittler Kontakt zu ihm auf, und es entwickelte sich ein stilles Einvernehmen zwischen den beiden Männern. Monk genoss eine so große Autorität, dass sich die Menschen der Wucht seiner schweigenden Mission nicht gerne widersetzten. Das Land lag unter einer dichten Schneedecke, und der General starrte schweigend in die Stille, wie in einem Traum gefangen. (»Er ist ein schwarzer Mönch [Monk]«, schrieb Lord Mordaunt, »und ich kann nicht in ihn hineinblicken.«)
Im Februar 1660 traf Monk in London ein. Die Stadtväter weigerten sich, Steuern zu zahlen, wenn nicht ein freies Parlament einberufen werde. Monk ergriff seine Chance. Er beriet sich mit seinen wichtigsten Offizieren und wandte sich dann in einem Schreiben an das Rumpfparlament, in dem er es aufforderte, per Dekret all jene Parlamentsmitglieder zurückzurufen, die durch Oberst Pride in seiner Säuberungsaktion von 1648 ausgeschlossen worden waren. Des Weiteren solle die erste und einzige Handlung des neu zusammengetretenen Parlaments darin bestehen, seine eigene Auflösung zu beschließen. Auf diese Weise wäre der Weg offen für ein freies Parlament. Und obwohl sich zu dem Zeitpunkt noch niemand dazu äußerte, bedeutete ein freies Parlament so gut wie sicher die Rückkehr des Königs.
Читать дальше