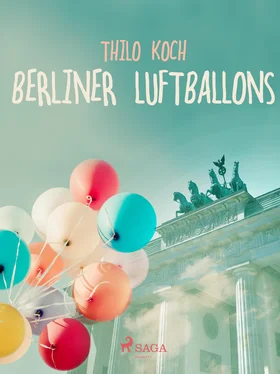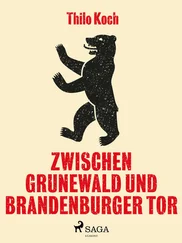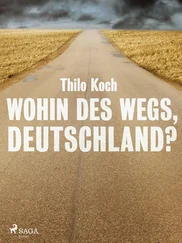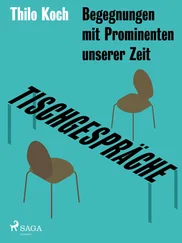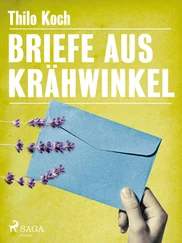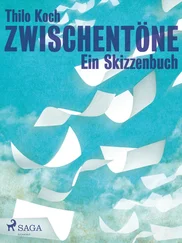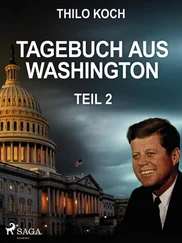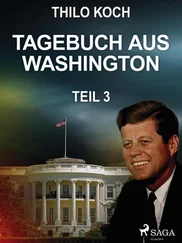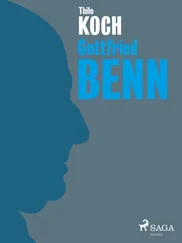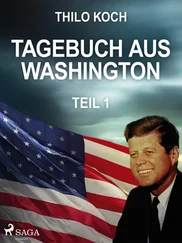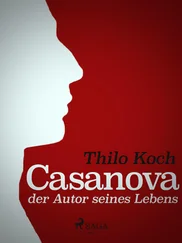»Kinder wie du und ich« – natürlich will dieser mein Sohn Lakritze und ’ne Taschenlampe und ’n jungen Hund in seinen Schuhen vorfinden morgen früh. Aber daß er unschuldig-praktisch, naiv und ohne zu wissen, wer oder was »Ungarn« sind, im Nikolaus – sagen wir es im Zeitungsdeutsch – »einen Faktor für die Ungarnhilfe« sieht – Respekt, Respekt.
Dabei glaubt er mit seinen vollen sieben Jahren schon nicht mehr an den Weihnachtsmann. Wenn er an die menschliche Solidarität glaubt, ist mir das, offen gesagt, auch lieber.
»Der Engländer liebt die Freiheit wie ein rechtmäßiges Weib, er besitzt sie, und wenn er sie auch nicht mit absonderlicher Zärtlichkeit behandelt, so weiß er sie doch im Notfall wie ein Mann zu verteidigen. Der Franzose liebt die Freiheit wie seine erwählte Braut. Er glüht für sie, er flammt, er wirft sich zu ihren Füßen mit den überspanntesten Beteuerungen, er schlägt sich für sie auf Tod und Leben, er begeht für sie tausenderlei Torheiten. Der Deutsche liebt die Freiheit wie seine alte Großmutter.«
Vor gut hundert Jahren ist der Mann gestorben, der das schrieb Wir Deutschen lieben die Freiheit, aber gewiß. Doch lieben wir sie nicht tatsächlich wie etwas verehrungswürdig Altes, idealisiert Kraftloses, eigentlich längst Gestorbenes? Wir bewahren der Freiheit allenfalls ein ehrendes Andenken – genau wie man es auch seiner Großmutter bewahrt.
Es wäre dem ironischen Patrioten Heinrich Heine zuzutrauen, daß er an Rotkäppchens Großmutter dachte, als er 1827 die Notiz »Dreierlei Liebe zur Freiheit« machte. Wollen wir nicht einmal versuchen, das Grimmsche Märchien auf Heinesche Weise nachzuerzählen? Wohlan:
Es. war einmal das liebe, kleine Rotkäppchen, so recht ein herziges Symbol für unser deutsches Volk. Das wurde von der Mutter in den Wald geschickt, damit es seiner Großmutter Kuchen und Wein bringe. Rotkäppchen liebte die alte, kranke Großmutter von ganzem Herzen, wie nur ein deutsches Herz die Freiheit lieben kann, die sich als Märchengestalt tief in den deutschen Wald zurückgezogen hat. »Mach dich auf, geh hübsch sittsam, und lauf nicht vom Weg ab!« sagte die Mutter, und Rotkäppchen erwiderte: »Ich will schon alles gut machen.«
Man weiß, dem armen, lieben kleinen deutschen Rotläppchen begegnete im Wald der Wolf, so recht ein grausliches Symbol für die allzeit schleichende, schnappende, heulende deutsche Obrigkeit im politischen Unterholz unserer Wälder. Rotkäppchen aber wußte nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm, schreiben die Gebrüder Grimm. Sehr wahr, das deutsche Volk erkannte selten rechtzeitig den, der es fressen wollte. Der Wolf verlockte das liebe, kleine, deutsche Rotkäppchen, abseits vom Wege die blaue Blume der Romantik zu sueben. Ei, da jauchzte es, um seiner Großmutter gleich einen ganzen frischen Strauß blauer Blumen mitzubringen, in deren tiefe innere Emigration.
Das schlimme Schicksal Rotkäppchens ist bekannt. Der Wolf fraß, nachdem das deutsche Volk ihm so arglosfreundlich den Weg zum Versteck der Freiheit gewiesen hatte, die alleinstehende, alte, kranke Großmutter. Und darauf auch das Rotkäppchen. Ein Glück nur, daß selbst die schlaue Obrigkeit Fehler macht, und Schlafen mit vollem Bauch ist ein Fehler. So kam, in der Verkleidung des Jägers, Schillers »Männerstolz vor Königsthronen« unterm Fenster der Großmutter vorbei und hörte das Schnarchen des Wolfes. Er entdeckte die satte Obrigkeit im Bette der Freiheit und sprach: »Finde ich dich hier, du alter Sünder? Ich habe dich lange gesucht.«
Wiederum weiß man: Der Jäger schnitt der Obrigkeit den fetten Bauch auf und wiedervereinigte das liebe, kleine, deutsche Rotkäppchen und die liebe, alte, deutsche Großmutter in Frieden und Freiheit. Dem Wolf aber füllte er den hungrigen Bauch mit Steinen, so daß der tot umfiel, als er aus dem Bett der Großmutter springen wollte. Da waren alle drei vergnügt, heißt es bei den Gebrüdern, und: Rotkäppchen aber dachte: Du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dir’s die Mutter verboten hat.
Ist das eine gute Moral von der Geschicht’? Heinrich Heine hätte wohl geschlossen: Wie schön, daß das liebe, kleine, deutsche Rotkäppchen einmal unartig war; so überfraß die Obrigkeit im bösen Wolfspelz sich so gründlich, daß der Männerstolz vor Königsthronen sie endlich zur Strecke brachte und dem deutschen Volk seine liebe, alte Großmutter, die Freiheit, wiederschenkte.
Könnten wir Deutschen nicht wirklich die Freiheit zunächst lieben lernen wie eine gar nicht folgsame, aber sehr hoffnungsvolle Tochter? Der da vor hundert Jahren in der Emigration an »Deutschland in der Nacht« dachte, hat es jedenfalls immer wieder versucht.
»In der DDR haben wir VEB’s und LPG’s mit ihren MTS’; beide entstanden auf Betreiben des ZK der SED. FDGB und FDB helfen bei der Werbung für KVP und FDJ.« Solche Sätze sind für den Uneingeweihten nicht verständlich. Sie stellen eine Art »Neusprache« dar, ein System der Abkürzungen, das ein bezeichnender Ausdruck ist unseres Zeitalters einer allgemeinen, gleichen und öffentlichen Kollektivierung. Abkürzungen verändern, entleeren die Sprache aber nicht nur in dem Teil der Welt, wo Staat-sund Lebensform auf den Kollektivismus schwören. Auch im Westen gebraucht man Begriffe wie EVG, NATO, SEATO, wie BEA, SBZ, EKD – Begriffsschemen, die nichts Greifbares, kein Fleisch und Blut mehr haben.
Die Sprache verrät alles. Wer auf sie hört, hört den Zeitgeist am Werke. Kollektivierung, Konformismus, Abstraktion, Rationalisierung – das alles bestimmt heute den Lauf der Welt, nicht nur den »Neuen Kurs« einer ihrer Hälften. Der Unterschied ist: Im Osten bejaht man als der Weisheit letzten Schluß, was man im Westen als notwendiges Übel hinnimmt oder auch verneinen darf. Ein sehr wesentlicher Unterschied freilich.
In der Sowjetzone spreche man bereits heute eine andere Sprache als in der Bundesrepublik, heißt es. Ein Beispiel, wie man einander schon in der Umgangssprache nicht mehr versteht, geben die verschiedenen Abkürzungen, die man hüben und drüben ganz selbstverständlich gebraucht. Man spricht hier deutsch und dort, aber es ergeben sich von Jahr zu Jahr mehr Rückfragen, wenn der Mann aus Dresden seinem Bruder in Köln von dem volkseigenen Betrieb, in dem er arbeitet, erzählt und natürlich VEB dazu sagt.
Zeichnet sich da nicht eine neue, künstliche, machtpolitisch bedingte Grenze ab, die die natürliche, volkstümliche Sprachgrenze hinter sich läßt? So weit die gleichen Abkürzungen verstanden werden, so weit reicht ein neues gemeinsames Bewußtsein, eine Art neue »ideologische Nation«. Insofern liegt schon heute Helmstedt näher bei Washington und Marienborn näher bei Moskau – als Helmstedt, Bundesrepublik, bei dem wenige Kilometer entfernten Marienborn, DDR. Eine schlimme Vorstellung!
Abkürzungen bezeichnen Wortkollektive, sie sind starr aufragende Signale, die einen Verkehr regeln, dessen gesichtsloses, wesenloses Objekt das Individuum ist, insofern es statistischen Stellenwert hat. Der Wortleib schwindet, es bleibt das Skelett einer unpersönlichen Abstraktion, eine Hülse, in die sich beliebig das Schwarzpulver der Zwecklüge füllen läßt.
Das intakte Wort ist von sich selbst vollkommen erfüllt und mit nichts anderem erfüllbar. Aus der lebendigen Verbindung von Wort und Wort zu Sprache ergibt sich Wahrheit, der Sinn und der Zweck des Sprechens. Wahrheit lebt von der Nuance, die in dieser Verbindung Spiel hat. Abkürzungen aber behaupten sich im Gegenteil durch das Ausstreichen der Nuance; sie machen »totale Sprache«.
Es wäre aber töricht, gegen die Abkürzungen loszugehen. Sie sind eine Wirkung. Die Ursache liegt in dem allgemeinen Verlust an individueller Substanz, die dieses Zeitalter der Kollektivierungen kennzeichnet. Wieviel da noch auszurichten ist? Unsere Sprache, wenn wir ihr zuhören, wird es immer getreulich anzeigen.
Читать дальше