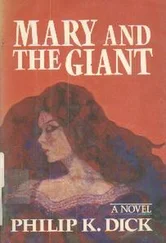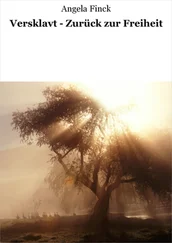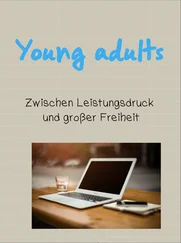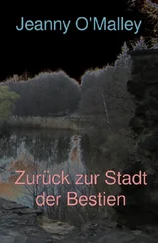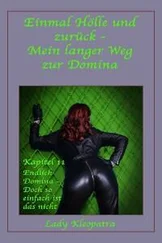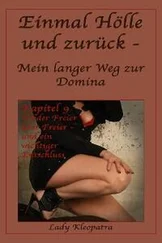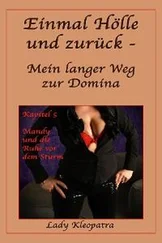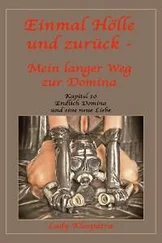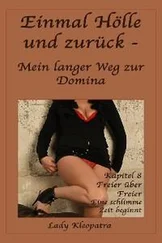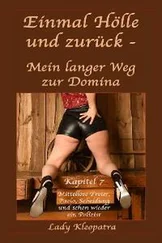Philip Yancey - Zurück zur Gnade
Здесь есть возможность читать онлайн «Philip Yancey - Zurück zur Gnade» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zurück zur Gnade
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zurück zur Gnade: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zurück zur Gnade»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Dabei deckt er bei seiner Suche nach den Ursachen und Hintergründen nicht nur Verhaltensweisen auf, die Gott und seine lebensverändernde Gnade in Verruf bringen. Er führt differenziert und ohne Anklage anhand vieler Beispielgeschichten und konkreter Ideen vor Augen, wie Gottes Gnade wieder unsere Visitenkarte werden kann! Ein Buch, das aufrüttelt, um der Welt das wieder nahe zu bringen, was uns selbst gerettet hat.
Zurück zur Gnade — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zurück zur Gnade», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ein Fluss, der vor einem Haus in Colorado vorbeifließt, ist mir zu einem Bild für Gottes unverdiente Gnade geworden. Wie Wasser fließt auch Gnade bergab. Der Fluss entspringt als kleines Rinnsal in einem schmelzenden Schneefeld hoch in den Bergen, nimmt seinen Weg als Bach, fließt durch wunderschöne Bergseen, wird zu einem reißenden Strom und schließlich zu einem großen blauen See. Wenn ich an diesem See vorbeikomme, geht mir manchmal der Choral There’s a Wideness in God’s Mercy („Dt. etwa: „So weit reicht Gottes Gnade“, Anm. d. Übers.) durch den Kopf.
Vom Theologen Jürgen Moltmann habe ich eine neue Sichtweise auf die Verlorenen entdeckt. Im Zweiten Weltkrieg kam er als deutscher Soldat in ein britisches Kriegsgefangenenlager. Schottische Frauen brachten den Gefangenen Selbstgebackenes und eine Bibel. Moltmann rührte diese Geste an und er begann, in der Bibel zu lesen. Nach dem Krieg kehrte er in seine Heimat zurück, wurde Pastor und Professor für Theologie und war damit in die kirchliche Hierarchie eingebunden. Später jedoch begann er ein religiöses System infrage zu stellen, das Bischöfe, Pastoren und Laien hierarchisch ordnet und sie alle gegen die Ungläubigen abgrenzt. Hatte nicht Jesus seine Nachfolger Schwestern und Brüder genannt? Hatte er damit nicht zu verstehen gegeben, dass sie eher eine Familie als ein Unternehmen waren? Herrschte Gott nicht über die ganze Welt, eingeschlossen diejenigen, die nicht zur Herde zählten?
„Kirche ist da, wo Christus ist“, schloss Moltmann.48 Die manifeste Kirche besteht aus denjenigen, die Christus annehmen und dem Evangelium glauben. Doch es gibt auch eine latente Kirche. „Christus ist aber auch da, wo die Armen, Kranken, Hungrigen und Gefangenen sind: ‚Was ihr einem unter diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan‘ “ (Matthäus 25,40). Man kann die Bibel nicht lesen, ohne laut und deutlich die Botschaft zu hören, dass Gott sich um die Heimatlosen, die Benachteiligten, die Unterdrückten, die Demütigen, die Bedürftigen kümmert – mit anderen Worten um die, die um ihre Verlorenheit wissen und sich danach sehnen, dass man sie findet.49
In den Seligpreisungen heißt es, dass die Ruhelosen und Unzufriedenen – die latente Kirche, um mit Moltmann zu sprechen – Gott vielleicht schon ganz nah sind. Denken Sie einmal darüber nach. Die Reichen handeln so, als hätte dieses Leben niemals ein Ende; die Armen dagegen verspüren Hunger nach etwas, das darüber hinausgeht. Wer trauert, spürt, dass diese Welt sich von Gott abgeschnitten hat, und kommt näher zum Vater, der versprochen hat, dass er alles neu machen wird. Friedensstifter und Barmherzige, wie ihre Motive auch aussehen mögen, streben nach Harmonie, danach, dass die Menschheit wieder wie eine Familie zusammenlebt.
Die Armen im Geiste gehören genauso dazu wie die wirtschaftlich Armen. Christian Wiman, der Redakteur des Magazins Poetry, gebraucht genau dasselbe Wort wie Moltmann, um den Anstoß zu beschreiben, der ihn wieder zum Glauben führte. Er schreibt: „Als ich zu dem Glauben, der latent in mir lebte, ein Ja fand – und ich formuliere das ganz bewusst so vorsichtig, denn da war kein Licht, kein Schutz- und kein Racheengel, der mein Leben entzweiriss schien es mir, als hätte ein winziges Saatkorn des Glaubens endlich eine Blüte hervorgebracht oder, genauer gesagt, als wäre ich in der Wüste auf eine seltene Blume gestoßen und hätte gewusst, obwohl ich sie gerade in diesem Augenblick entdeckt hatte, dass sie in mir schon lange, ein Dürrejahr nach dem anderen, geblüht und all die Zeiten des Unglaubens in mir überlebt hatte.“
Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich einen nicht gläubigen Menschen als jemanden behandle, der unrecht hat, oder als jemanden, der auf dem Weg ist, sich jedoch verirrt hat. Ein hilfreiches Vorbild für mich ist die Rede, die Paulus auf dem Areopag in Athen gehalten hat und die man in Apostelgeschichte 17 nachlesen kann. Statt seinen Zuhörern wegen ihres Götzendienstes mit der Hölle zu drohen, lobt Paulus sie zunächst dafür, dass sie geistlich auf der Suche sind und den „unbekannten Gott“ anbeten. Die gesamte Schöpfung und das menschliche Leben ist Gottes Idee, verkündet Paulus den Athenern: „Von Anfang an war es sein Plan, dass die Völker Gott suchen und auf ihn aufmerksam werden sollten und ihn finden würden – denn er ist keinem von uns fern“ (Apostelgeschichte 17,27). Er argumentiert von einer gemeinsamen Grundlage her und zitiert zwei ihrer Schriftsteller, um grundlegende Wahrheiten zu bekräftigen. Demütig und respektvoll tritt er vor seine Zuhörer und spricht zunächst über das Verlorensein und Entfremdung, bevor er dann einen tieferen Zugang zu Gott eröffnet, den man nicht mit goldenen, silbernen oder steinernen Statuen einfangen kann.
Alles hat seine Zeit. Die uns umgebende Kultur zu kritisieren hat seine Zeit, zuzuhören hat seine Zeit, und vielleicht bringen wir dabei einen Menschen dazu, seinen latenten Durst zu erkennen. „Ich machte mich auf die Suche nach dem Geist und fand Alkohol, ich machte mich auf die Suche nach der Seele und kaufte Stil, ich wollte Gott begegnen, doch man hat mir Religion verkauft“, ruft Rockstar Bono manchmal ins Publikum.50 In einem überfüllten Stadion hörte ich ihn einmal Yahwe singen. In diesem Lied bietet er Gott seine Hände dar, zu Fäusten geballt, seinen Mund, „der so schnell zu kritisieren bereit ist“, und schließlich sein Herz: „Take this heart, and make it break“ (Dt. etwa: „Nimm mein Herz und lass es brechen“, Anm. d. Übers.). Gegen Schluss des Konzertes stimmten zwanzigtausend Fans in den Refrain von Leonard Cohens „Hallelujah“ ein.
Als sich Bono entschloss, öffentlich über seinen Glauben zu reden, suchte er sich einen Mitarbeiter aus, den man nicht erwartet hätte, weil er nichts mit dem Glauben anzufangen wusste. In dem Buch, das daraus entstand, fordert der französische Journalist Michka Assays, ein Agnostiker, Bono auf zu erklären, wie er in der säkular geprägten Welt des Rock ’n’ Roll an das Christentum glauben könnte. Bono beantwortet all seine Fragen. Freimütig räumt er ein, dass die Kirche Fehler gemacht habe, sagt jedoch auch, dass Jesus die Antwort auf seine eigene Suche nach Lebenssinn sei und ihm Ziele geschenkt habe, die über Ruhm und Vergnügen hinausgehen.
Gemeinsamkeiten
Dag Hammarskjöld, Generalsekretär der Vereinten Nationen in der Zeit, als die Welt am schlimmsten unter den Spannungen des kalten Krieges litt, erklärte einmal, dass er im Umgang mit Gegnern zunächst nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner suchte. Wenn er entdeckte, dass zwei gegnerische Parteien auch nur einen Punkt gemeinsam hatten, arbeitete er daran, Vertrauen und eine Beziehung aufzubauen, die möglicherweise zu einem ehrlichen Dialog auch in den schwierigen Fragen führen könnte. Auf Jesus blickte er als sein Vorbild, denn das war Gottes Art, gemeinsamen Grund mit der Menschheit zu finden: „Er saß mit Zöllnern und Sündern zu Tisch und ging mit Huren um.“51
Wenn wir Skeptikern unseren Glauben vermitteln wollen, geht das im Allgemeinen am besten, wenn wir die Gemeinsamkeiten herausstreichen, nicht die Unterschiede. Ich lerne jetzt, der Versuchung zu widerstehen, andere als Gegner oder Missionsobjekte zu sehen. Stattdessen suche ich nach gemeinsamem Grund, nach einem Boden, auf dem wir zusammen stehen können. Viele Menschen in ihrer postchristlichen Phase richten ihr Leben nach dem aus, was ich „Gewohnheiten der Seele“ nenne. Sie leben nach den christlichen Grundsätzen der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, die auch in einer Gesellschaft bestehen bleiben, die sich immer weiter vom Glauben entfernt. „Aber da gehen wie durch dunkle Gassen von Gott Gerüchte durch dein dunkles Blut“, schreibt Rilke.52
Christliche Apologetik beschäftigt sich mit Argumenten für den Glauben. Das ist wichtig, wird aber vielleicht überschätzt, weil die meisten Menschen nicht allzu viel Zeit darauf verwenden, die Wahrheit zu suchen. Vielmehr handeln sie aus ihrem Instinkt heraus. Manche dieser Instinkte sind sehr gut, und viele davon sind noch ein Vermächtnis der christlichen Vergangenheit. Zum Beispiel tritt jeder Mensch aus meinem Bekanntenkreis, der im medizinischen Bereich arbeitet, dafür ein, dass auch Leute behandelt werden müssen, die es nicht „verdienen“, wie zum Beispiel Leute, die einen verantwortungslosen Lebensstil pflegen und ihre Krankheiten selbst verschuldet haben, und das, obwohl eine Behandlung pragmatisch gesehen kaum Sinn ergibt. (In Indien bin ich Brahmanen begegnete, die niemals daran denken würden, Armen oder Kranken etwas zu geben. Sie glauben, dass diese Art der Nächstenliebe bedeute, Menschen zu belohnen, deren Los die Strafe für ihre Taten in einem früheren Leben ist.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zurück zur Gnade»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zurück zur Gnade» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zurück zur Gnade» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.