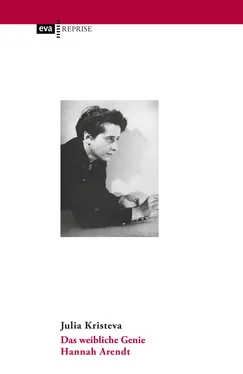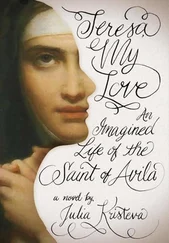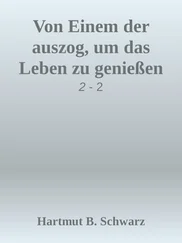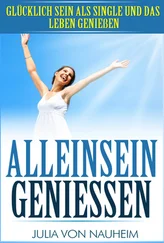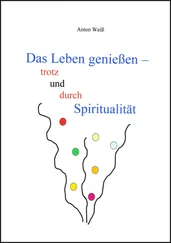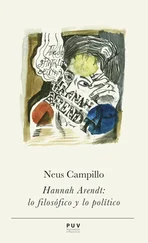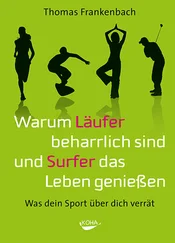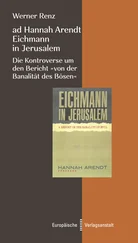Die Genießerinnen, die Verführerinnen, die sich am Fleisch einer Aprikose ebenso berauschen wie am Aronstab des Geschlechts ihres Liebhabers oder den fliederduftenden Brüsten der Geliebten, sind dennoch nicht aus dem Atomzeitalter entschwunden. Wenn dieses zwanzigste nicht nur das Jahrhundert der unheilvollen Erinnerung ist, dann ohne Zweifel dank der Lust und Schamlosigkeit freier Frauen wie Colette, die beides mit der unverschämten Anmut der Aufsässigen auszudrücken verstand. Die Würze der Wörter, die uns roboterhaften Individuen zurückgegeben wurde, ist vielleicht das schönste Geschenk, das eine weibliche Schreibweise der Muttersprache bieten kann.
Zwei Jüdinnen deutscher Sprache, die auf Englisch in New York und in London den Ernst der Politik und die Grenzen des Menschlichen erkundeten, und eine französische Bäuerin, die erneut das Feuer der Materialisten und der raffinierten Ausschweifungen anfachte. Durch ihr Genie werden uns die vielfältigen Gesichter der modernen Zeiten in ihrer komplementären Komplexität und Wahrheit wiedergegeben.
Diese drei Frauen haben mit Männern, ihren Männern, gelebt, gedacht, geliebt, gearbeitet: Dabei erlitten sie mitunter die Autorität eines Lehrers oder hingen von seiner Liebe ab; bisweilen nahmen sie das Risiko des Aufruhrs auf sich, durch den die Unschuld unwiderruflich verloren geht; mehr oder weniger respektvoll errangen sie dabei stets ihre Unabhängigkeit.
Man wird sich vielleicht darüber wundern, daß jene politischen Bücher über den Antisemitismus und den Totalitarismus, die Hannah Arendt berühmt machten, hier nur als ein Teil ihrer Schriften behandelt werden. Uns schien wesentlich, die Entstehung ihrer Forschungen nachzuzeichnen, das Porträt der Denkerfrau, deren wichtigste politische Beiträge andere bereits gelobt oder kritisiert haben. Wir werden sehen, wie sie nach Heidegger das Dasein abhorcht, aber auch in den gewagten und dennoch unumgänglichen Bindungen, die mit den anderen immer neu zu beginnen sind, die Virtuosität des »Erscheinens« an die Stelle der Einsamkeit des »Geworfenseins« setzt. Die Heideggersche »Verlassenheit« inmitten des anonymen »Man« wird plötzlich unkenntlich, wenn Hannah Arendt auf das Wunder vertraut – die »Geburt eines jeden« in der »Zerbrechlichkeit der menschlichen Angelegenheiten«, im politischen Raum. Obwohl diese Liebhaberin des Denkens das Werk des großen Philosophen stets aufmerksam verfolgt, gelingt es ihr, sich von ihm zu befreien, um eine herausragende politische Theoretikerin – eine umstrittene, doch nicht zu übergehende – zu werden. Nicht nur brachte sie als erste die beiden totalitären Herrschaftsformen wegen der ihnen gemeinsamen Zerstörung des menschlichen Lebens miteinander in Verbindung, sie brachte auch als erste das »Erscheinen« als echte Bedingung für die Menschheit zur Geltung in dem Maße, wie es jedem seine irreduzible Singularität offenbart – wenn und nur wenn dieser Jeder den Mut findet, den Gemeinsinn der anderen zu teilen. Und vielleicht ist der Medientrubel seit dem Tod Hannah Arendts nicht nur ein Fluch; zumindest wenn man ihn mit dem Genie dieser Frau denkt, die den politischen Sinn als »Geschmack« für das Zeigen, Beobachten, Sich-Erinnern und Erzählen aufwertete.
Freud hatte gerade das Unbewußte und die Abhängigkeit der Geisteskrankheit von der Sexualität entdeckt. Er erforschte die Klippen der Lust und rechnete mit dem gesellschaftlichen Konformismus ab, der nicht wissen wollte – und immer noch nicht wissen will –, daß menschliche Körper Wesen des Begehrens sind. Dieses Hören auf Eros und Thanatos war von heftigeren, mehr oder weniger ödipalen Auseinandersetzungen des Lehrmeisters der Psychoanalyse mit seinen Schülern begleitet. Während dieser Zeit arbeitete Melanie Klein an der Loslösung. Die Pflege der Kinder hatte sie gelehrt, daß die Destruktivität am Anfang steht und im Wahn kulminiert, jedoch stets Trägerin des Begehrens bleibt. Freud hatte darauf hingewiesen, doch Klein ist es, die alle Konsequenzen daraus ziehen wird. Als Wegbereiterin der Kinderpsychoanalyse neben Anna Freud, jedoch radikaler als diese, eröffnete Melanie Klein die Möglichkeit einer echten Psychoanalyse der Psychose, welche in der Lage ist, den Spiritualismus von Jung zu vermeiden, der sich gegen Freud auf eben dieses Gebiet gewagt hatte. Jenseits des Dogmatismus der erbarmungslosen Erkunderin, die zu sein man sie beschuldigt, erwies sich ihr Werk als etwas, woran man weiterarbeiten kann. Es fand eine Fortsetzung in den originellen und fruchtbaren Ausarbeitungen, die, wenn überhaupt nötig, ihre Richtigkeit bestätigen: W. R. Bion und D.W. Winnicott waren nicht ihre Schüler, doch ihre Fortsetzer. Ohne sie und ohne die moderne Psychoanalyse der Psychose und des Autismus, die im Zentrum der Arbeiten von Melanie Klein stehen, würde uns heute diese die moderne Kultur auszeichnende Orientierung auf die Nähe des Wahns und die Vielfalt der Behandlungsmöglichkeiten fehlen, dank derer wir ihn beeinflussen können.
Daß die Lust nicht nur organisch ist, sondern sich auch in den Worten gibt, unter der Bedingung, daß es diesen gelingt, sich für jene empfänglich zu machen – das hat seit Rabelais und den Sensualisten und Libertins des achtzehnten Jahrhunderts niemand besser zum Ausdruck gebracht als der französische Genius. Doch war es Colettes Privileg, die französische Sprache mit jener heidnischen Würze zu sättigen, die den Charme unserer Zivilisation ausmacht, und zu erzählen, wie die Sinnlichkeit sich in der sexuellen Eulenspiegelei der raffinierten oder in den süßen Lüsten der einfachen Leute verwurzelt. Im Gegensatz zu Hannah Arendt und zu Melanie Klein muß sie nicht über einen Lehrmeister hinausgehen, um ihr Genie zu erfüllen – Willy, dann Jouvenel, ihre Ehemänner, stellten vor allem eine Hilfe, einen Schutz und erst zuletzt ein Hindernis dar. Sie mißt ihre Kräfte unmittelbar mit der Autorität der Muttersprache, was sie dazu führt, sich zugleich der Vernunft und der Weiblichkeit zu konfrontieren, die eine wie die andere zu lieben, die eine wie die andere zu verwandeln. Ihr einziger wahrer Rivale wird Proust sein, dessen narrative Suche in ihrer sozialen und metaphysischen Komplexität über die Abenteuer von Claudine und ihrer Komplizinnen hinausgeht; aber Colette läßt ihn weit hinter sich in der Kunst, die keineswegs verlorenen Genüsse einzufangen.
Diese drei Erfahrungen, diese drei Werke einer enthüllenden Wahrheit realisierten sich inmitten des Jahrhunderts und zugleich an seinen Rändern. Nicht wirklich ausgegrenzt, nicht wirklich randständig stehen Arendt, Klein und Colette dennoch »außer der Reihe«. Sie verwirklichen ihre Freiheit als Erkunderinnen abseits der herrschenden Strömungen der Institutionen, Parteien und Schulen. Hannah Arendts Denken steht an der Schnittstelle der Disziplinen (Philosophie? Politologie? Soziologie?), es steht quer zu den Religionen und ethnischen oder politischen Zugehörigkeiten, es erhebt sich gegen das establishment von »rechts« ebenso wie von »links«. Die Forschungen von Klein sind eine Herausforderung für den Konformismus der Freudianer und vollziehen, ohne Angst vor Untreue gegenüber der psychoanalytischen Orthodoxie der Epoche, einen echten Bruch in der Erkundung des Ödipus-Komplexes, des Phantasmas der Sprache und der Vorsprache. Erst provinziell und skandalträchtig, dann mondän, aber immer noch populär, schließt sich Colette dem literarischen Akademismus zuletzt nur an, um in ihrer scharfsinnigen Bloßstellung der sozialen Komödie und ihrem sinnlichen Aufruhr fortzufahren. Erneuernd, weil nicht konform, hat das Genie der drei Frauen auch diesen Preis: Die Aufsässigen schöpfen aus ihm ihre Begeisterung, sie bezahlen aber auch mit Ächtung, Verständnislosigkeit und Verachtung. Gemeinsames Schicksal der Genies … und der Frauen?
Das Leben , der Wahn , die Wörter : Diese Frauen machten sich zu ihren hellsichtigen und leidenschaftlichen Erkunderinnen, indem sie ihre Existenz ebenso wie ihr Denken einbrachten und die Hauptfragen unserer Zeit aufgrund ihres besonderen Blickwinkels für uns erhellten. Wir werden sie zu lesen versuchen, ohne bei den wenigen, inzwischen von der öffentlichen Meinung sofort mit ihren Namen verbundenen, berühmten Themen stehenzubleiben. Hannah Arendt ist nicht zu beschränken auf die »Banalität des Bösen« und den »Eichmann-Prozeß« oder auf die Identifizierung von Nazismus und Stalinismus. Melanie Klein bleibt nicht bei der »frühreifen paranoischen Projektion« und »dem Neid und der Dankbarkeit« stehen, die vom »Teilobjekt« mütterliche Brust bestimmt werden, oder bei der »multiplen Kluft«, die endogene Psychosen hervorbringt. Ebensowenig wie die Provokation der Garçonne , die Skandale veranstaltet, um besser in der Akademie Goncourt zu herrschen, die Magie Colettes erschöpft. Das sind nur einige der Bäume, die oft sehr viel reizvollere, aber auch gefährlich komplexere Wälder unsichtbar machen.
Читать дальше