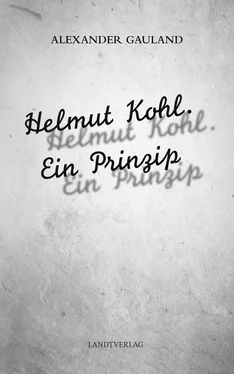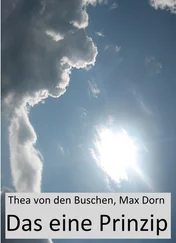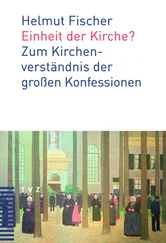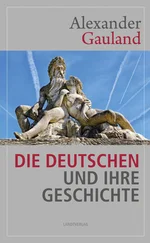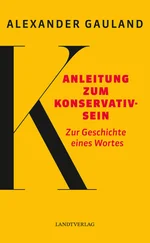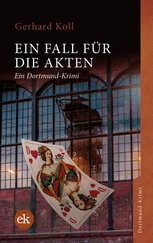Die nachwachsende Generation, in jüngster Zeit abwertend als »Jalta-Generation« tituliert 24, wandte sich deshalb entschlossen nach Westen. Die einen suchten der irrationalistischen deutschen Tradition durch die Hinwendung zum linken Hegel und einem »westlich gelegenen Marx« zu entkommen 25, die anderen entdeckten in Burke und Tocqueville jenen demokratischen Konservativismus, den Heidegger und Carl Schmitt in Deutschland zuerst verdrängt und schließlich zerstört hatten. Sosehr die 68er-Revolte auch »Linke« und »Rechte« trennen sollte, einig blieben sie sich in der Überzeugung, daß es einen gesonderten deutschen Weg nicht mehr geben konnte. Fast spurlos verschwanden die letzten Vertreter einer nationalen Tradition aus dem literarischen und öffentlichen Leben. Reinhold Schneider, Hans-Joachim Schoeps und Ludwig Dehio wecken heute nur noch vage Erinnerungen an eine kulturelle Traditionslinie zwischen Weimar und Potsdam, die im Niemandsland endete. Allein Gerhard Ritters Versuch, das Recht des von der Exekutive geprägten kontinentalen Machtstaates gegen die von der Legislative beherrschten insularen Mächte England und Amerika zu behaupten, gewann in der »Fischer-Kontroverse« noch einmal eine gewisse Dynamik. Doch obwohl Ritter in der Kriegszieldiskussion eher recht und Fischer eher unrecht hatte, waren es gerade die Ritterschen Grundprinzipien einer machtstaatlichen, vom Westen getrennten preußischdeutschen Tradition, die seinem Standpunkt die Wirkung raubten. Während die »Rechten« das westliche Deutschland konsequent in die transatlantischen Institutionen einfügten, bekämpften die »Linken« diese Institutionalisierung ihrer mentalen Westbindung als Restauration des Kapitalismus. Entlang dieser Scheidelinie verlief auch der 68er-Konflikt. Was für die einen ein Gewinn an Homogenität und Weltoffenheit war, erscheint den anderen als ein Verlust an Urbanität und geistiger Tiefe.
Karl Heinz Bohrer hat in seinen bitteren Marginalien zum Provinzialismus 26das Versagen der bundesrepublikanischen »classe politique« im Golfkrieg gegeißelt und ihr ihre Flucht aus dem Politischen vorgeworfen. Dabei hat er den Verlust der alten politischen Führungsschichten für die »intellektuelle Begrenzung und die kulturelle Niveaulosigkeit« der neuen kleinbürgerlichen Politikergeneration verantwortlich gemacht, die er in Kohl und Lafontaine repräsentiert sieht. Nicht erst der Betroffenheitskult in der Nachfolge der 68er, sondern bereits das Aufgeben der existentiellen metaphysischen Dimension in den 68er und 70er Jahren habe Deutschland als eine geistige Möglichkeit ausgelöscht. Doch die Bindung an den Westen setze eine eigene akzeptierte Identität voraus, die das Erbe nicht schematisch in rational und irrational unterteile, da ebendiese Selbstverstümmelung der tiefere Grund für den Mangel an Existenzwillen und Handlungsbereitschaft in der alten Bundesrepublik sei.
Diese Kritik, die jüngst Botho Strauß in seinem »Anschwellenden Bocksgesang« wiederaufgenommen hat 27, zielt zugleich auf jene »political correctness», die schon die Frühromantik in den deutschen Sonderweg einbiegen sieht und mit Ernst Jüngers Arbeiter auch seine Marmorklippen verwirft. Die alte Bundesrepublik, so ihre Kritiker, habe ein Milieu hervorgebracht, das »betont kommunikativ, aber evasiv, liebenswürdig, aber ängstlich, programmatisch-ideologisch, aber undeutlich und unkonkret« sei. 28»Daß ein Volk sein Sittengesetz gegen andere behaupten will und dafür bereit ist, Blutopfer zu bringen, das verstehen wir nicht mehr und halten es in unserer liberal-libertären Selbstbezogenheit für falsch und verwerflich.« 29Diesen nicht unberechtigten Einwänden gegen unsere »alltägliche Vernünftigkeit« kann man nur mit einem Rückgriff auf Edmund Burke begegnen, der das »bundesrepublikanische Sittengesetz« bereits in seiner Auseinandersetzung mit dem Extremismus der Französischen Revolution formuliert hat: »Alle Regungen, ja alle menschlichen Freuden und Genüsse, jede Tugend und jede kluge Handlung ist auf einen Kompromiß, eine Balance, gegründet, wir wägen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten ab, wir nehmen und geben, wir nehmen einige Rechte nicht in Anspruch, damit wir uns anderer erfreuen können, und wir wollen lieber glückliche Bürger als spitzfindige Disputanten sein.« 30Nachdem die Deutschen lernen mußten, daß die Freund-Feind-Unterscheidung Schmittscher Observanz zur Krisenbewältigung nicht geeignet ist, entschieden sie sich für die Konsenssuche als ein Gegenmodell. Nicht Ausgrenzung, sondern Einhegung wurde die Zauberformel der alten Bundesrepublik. Es war der Abschied von dem tragischen Versuch, »mit welch geistigen und moralischen Mitteln auch immer – uns selbst als besondere Kategorie, die Metaphysik des Ichs gegen eine internationale Regel ins Feld zu führen». 31
Kurzschlüsse, die in Verurteilungen münden, sind immer gefährlich – dennoch gab es natürlich eine Verbindungslinie von Fichtes nationaler Metaphysik über die Verwerfung der Modernität und der rationalistischen Tradition durch den »Rembrandt-Deutschen« hin zu »Bruder Hitler». Diese Verbindungslinie, die das Scheitern des deutschen Weges nach Europa symbolisiert und an deren Ende die Ersetzung des »Ich« durch das »Es« in der Heideggerschen Philosophie stand, brach 1945 ab. Daß dabei auch kulturelle Verluste zu beklagen sind, steht außer Frage. Doch die Gewinne überwiegen. Zum ersten Mal ist die parlamentarische Demokratie westeuropäischer Prägung fest in Deutschland verankert. Zum ersten Mal ist es den Deutschen gelungen, Konfliktlösungsmodelle zu entwickeln, deren Fehlen die Republik von Weimar zerstört hat, zum ersten Mal hat sich in Deutschland eine zivile bürgerliche Gesellschaft gebildet, hat Deutschland Abschied genommen vom lutherischen Gemeinschaftsideal. Das erste Mal haben die Deutschen ein gesellschaftliches Mindestmaß an Toleranz ausgebildet, zum ersten Mal hat auch eine politische Klasse in Deutschland pragmatischen Realismus als Tugend begriffen. Die Staatsräson der Bundesrepublik stützt sich nicht wie die des Kaiserreiches auf zwei Augen, deren Erlöschen den Staat zum Schiff ohne Steuermann werden ließ.
Vor diesem Hintergrund ist die Welt, in der wir noch leben, leicht zu skizzieren. Die Bundesrepublik ist eine demokratische Industriegesellschaft, deren Klassenstruktur weit schwächer ausgebildet ist als die der klassischen Demokratien. Dies bedeutete von Anfang an die Suche nach dem Kompromiß als einer Strategie zur zivilisierten Beilegung von Konflikten, wenn nicht gar zu ihrer Vermeidung. Die Schlüsselworte der westdeutschen Gesellschaft sind Stabilität und Konsens. Schon am Beginn der zweiten deutschen Demokratie stand mit der sozialen Marktwirtschaft ein Ordnungsbegriff, der Ausgleich und Partnerschaft signalisierte. Alle Begriffe, die im öffentlichen Leben der Bundesrepublik eine Rolle gespielt haben, atmen diesen Geist der Konfliktvermeidung. Mitbestimmung, Friedenspflicht, innerer Friede, sozialer Friede, soziales Netz, Sozialpartnerschaft, Sicherheitspartnerschaft, konzertierte Aktion und Solidarpakt. Zu keiner Zeit hatte jene kalte Marktgesellschaft, die Margaret Thatcher und Präsident Reagan vorschwebte, in diesem Lande eine Chance. Die manchmal beklagten Verkrustungen – ob beim Ladenschluß, in der Tarifpolitik oder auf dem Arbeitsmarkt – sind die Folge eines leidenschaftlichen Sicherheitsbedürfnisses, das in dem Wahlkampfslogan der 50er Jahre: »Keine Experimente« einen überzeitlichen und allgemeingültigen Ausdruck fand. Das Bild des Staates als einer Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit hat sich weit von der Hegelschen Staatsmystik entfernt. Dem Streben nach gesellschaftlichem Konsens entspricht die Ausrichtung der deutschen Politik und ihrer Institutionen auf die politische Mitte. Risikovermeidung um jeden Preis mag auch die Folge des Fehlens einer homogenen Führungselite sein, da dieser Mangel fast zwangsläufig durch das Streben nach Konsens und institutionellem Zwang zu politischer Gemeinsamkeit ausgeglichen werden muß? 32Wie in der Innenpolitik, so bestand in der alten Bundesrepublik am Ende auch Konsens über die Außenpolitik, obwohl hier anders als bei den gesellschaftlichen Grundlagen die leidenschaftliche politische Debatte am Anfang stand und alle Grundentscheidungen gegen den Widerstand einer beträchtlichen Minderheit durchgesetzt werden mußten. Das galt für die Wiederaufrüstung, die NATO-Mitgliedschaft, die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, die Brandtsche Ostpolitik und die Nachrüstung. Was heute klar und einleuchtend erscheint, war am Anfang weit umstrittener als die gesellschafts- und wirtschaftspolitische Ausrichtung der Republik. Das eigentlich Neue an der alten Bundesrepublik ist die Selbstverständlichkeit, mit der ihre Bürger sich als Teil des Westens und seiner politischen Kultur, als Teil einer immer enger zusammenwachsenden Gemeinschaft europäischer Nationen empfinden, europäische Integration und atlantische Ligaturen gehören heute (noch!) zum Kernbestand deutscher Staatsräson. 33
Читать дальше