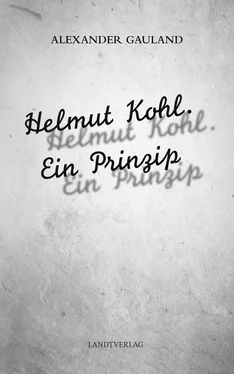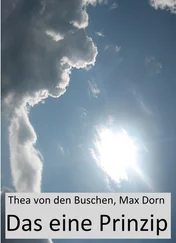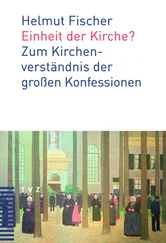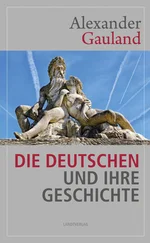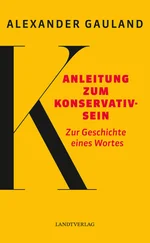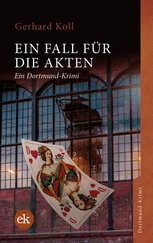Nach komplizierten Verhandlungen mit der CSU wurde Helmut Kohl als Kanzlerkandidat der Unionsparteien in die Bundestagswahlen 1976 geschickt. Doch die gemeinsame Erklärung verhieß nichts Gutes für die Zukunft: »Die CSU hält an ihrer Bewertung fest, daß ihr Vorsitzender der geeignete Kandidat ist. Die CSU wird im Interesse der gemeinsamen Sache ebenso wie die CDU Helmut Kohl als Kanzlerkandidaten unterstützen.« 13Daß die Union mit 48,6 Prozent der Stimmen nur knapp die absolute Mehrheit verfehlte, war eine beachtliche Leistung Kohls. Doch die FDP sprang nicht, und Helmut Schmidt blieb Bundeskanzler. Helmut Kohl verspielte seinen Erfolg noch am gleichen Abend. Sein trotziges »Ich will Bundeskanzler werden – ich habe die Wahl gewonnen« wäre in Mainz passend gewesen, in Bonn klang es provinziell. In Mainz mochte es richtig sein, daß der stärksten Partei die Initiative zur Regierungsbildung zusteht, in Bonn ging es um die Macht, und da hatten ein paar tausend Stimmen gegen die »Machtübernahme« von Helmut Kohl entschieden.
Die nun folgenden Jahre wurden die schwierigsten überhaupt. Wenige Wochen nach der Bundestagswahl kündigte Franz Josef Strauß die Fraktionsgemeinschaft im Bundestag auf. Es war ein Akt purer Irrationalität, denn ein »Bruderkampf« zwischen CDU und CSU hätte beide Parteien jene Stimmen gekostet, die sich Strauß durch ein eigenes Stück auf der Bonner Bühne holen wollte. Es war letztlich irrelevant, ob es eine »bürgerliche Mehrheit« gab, denn es gab auf jeden Fall eine gegen Franz Josef Strauß. Kohls Entschlossenheit rettete die Einheit. Als die CSU-Abgeordneten um ihre Mehrheiten in Bayern zu fürchten begannen, kehrte Strauß in die »babylonische Gefangenschaft« zurück.
Doch die Unterschiede in der Beurteilung blieben, und dieser Riß verlief mitten durch die CDU. Kohl wußte, daß eine Regierung Wahlen verliert und nicht die Opposition sie gewinnt. Er hielt nichts von oppositioneller Hektik. Er mußte warten, bis Helmut Schmidt und seine Partei sich soweit auseinandergelebt hatten, daß die FDP keinen Partner mehr hatte, erst dann hatte er eine Chance. Strauß und seine innerparteilichen Kritiker sahen die FDP dagegen auf unabsehbare Zeit »historisch« an die SPD gekettet und rüttelten an den Gitterstäben. »Freundliche« Worte über Kohls Führungseigenschaften machten die Runde. Der Abgeordnete Todenhöfer schrieb, im Schlafwagen käme die Union nicht an die Macht, und der Verlierer Barzel bemängelte, daß noch nie ein Kanzler so gemütlich regiert habe wie der jetzige. Zu keiner Zeit hatte Helmut Kohl weniger Freunde als an der Jahreswende 1978 / 79. Man braucht nur die Überschriften damals erschienener Artikel zu lesen und glaubt sich in ein Geisterhaus versetzt: »Kohls Talfahrt – guter Mann ohne Glück« ( Welt vom 17. 5. 1979); »Die Ära Kohl geht zu Ende« ( Quick vom 7. 6. 1979); »In der CDU wächst die Unzufriedenheit mit Kohl« ( FAZ vom 10. 1. 1979); »Zum Verlieren bestellt« (Rudolf Augstein im Spiegel , 3/1979). Der Bonner Korrespondent der Frankfurter Rundschau registrierte damals, daß die Kohl-Postkarten aus der Buchhandlung am Bundeshaus verschwunden waren. Auf seine Nachfrage bekam er die Antwort: »Wir haben ihn aussortiert, denn wir sind immer unserer Zeit voraus.« 14Hinzu kam, daß sich der Oppositionsführer mit dem Kanzler schwertat. Helmut Schmidt war ein begnadeter Schauspieler, der gut ausgeleuchtet die geringen Erfolge einer zerstrittenen Koalition wie Preziosen darbot. Arrogant bis zur Unverschämtheit, wurde der »Weltökonom« doch von den Wählern bewundert, die ihm ihre Interessenvertretung eher zutrauten als dem provinziellen Pfälzer. Zwar war die Republik rheinisch und süddeutsch geprägt, doch Idiom, Habitus und Anspruch des sozialdemokratischen Bundeskanzlers ließen vage Reminiszenzen an Friedrich, Bismarck und Stresemann wach werden. Dieser Mischung war Kohl anfangs nicht gewachsen, in rhetorischen Auseinandersetzungen zog er regelmäßig den kürzeren. Bei Helmut Schmidt war es mehr Schein als Sein, bei seinem Gegenspieler schien, besser gesagt: schimmerte nichts.
Zur Jahreswende versandte Biedenkopf ein Memorandum, in dem er die Trennung von Partei und Fraktionsvorsitz verlangte und letzteren natürlich für sich beanspruchte. Das Papier fand Kohl in der Post, als er aus dem Winterurlaub zurückkehrte, den Inhalt hatte er zuvor schon den Zeitungen entnehmen dürfen. Auf dieses Ereignis anspielend, hat Kohl einmal auf die Frage, warum er nicht längst schon seine Memoiren in Angriff genommen habe, entgegnet: »Lieber nicht, ich müßte zu viel menschlich Unanständiges enthüllen.« 15Die Intrige scheiterte. Wie so oft vorher und nachher hatte Biedenkopf keine Mehrheit in den entscheidenden Gremien und stimmte am Ende selbst gegen den eigenen Vorschlag. Doch die Krise hielt an. Im Frühjahr machte Kohl instinktiv oder wohlüberlegt das einzig Richtige – er zog seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur zurück und schlug den niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht vor. Die Fraktion entschied sich für Franz Josef Strauß, der nun beweisen konnte, was in ihm steckte. Kohl unterstützte den Kandidaten nach Kräften; 44,5 Prozent in der Bundestagswahl 1980 bestätigten allerdings den allgemeinen Befund – die Wähler wollten keinen Bundeskanzler Strauß. Grollend zog sich der Geschlagene nach Bayern zurück. Helmut Kohl hatte die Talsohle durchschritten. Die sozialliberale Koalition ging nur zwei Jahre später zu Ende, und Helmut Kohl wurde – so wie er es immer gewollt hatte – Bundeskanzler einer CDU/ FDP-Regierung. Den Wunsch von Strauß, sofort wählen zu lassen und so die FDP zu vernichten, ignorierte er. Helmut Kohl fürchtete eine absolute Mehrheit, die ihn den Unwägbarkeiten eines Außenministers Strauß ausgeliefert hätte. Auch wußte Kohl, daß spätestens die nächste Bundestagswahl eine absolute Mehrheit wieder relativiert hätte, ohne daß der Union dann ein sicherer Partner zur Verfügung stehen würde. Die Koalitionsverhandlungen gestalteten sich problemlos. Das Bündnis mit der FDP erforderte außenpolitische Kontinuität in der Ost- und Deutschlandpolitik, innenpolitisch wurde das Lambsdorff-Papier, die Scheidungsurkunde der sozialliberalen Koalition, zum Ehevertrag des neuen Bündnisses. Haushaltskonsolidierung, Verringerung der Staatsquote und Begrenzung der Sozialausgaben bestimmten den Neuanfang. Gefahren drohten von der Verratslegende der SPD, die Alfred Dregger die hessischen Landtagswahlen kostete und die geschickt zu einem für Helmut Kohl abträglichen Vergleich mit Helmut Schmidt benutzt wurde. »Jetzt hätten wir endlich einmal einen Bundeskanzler gehabt und nun haben wir Aussicht auf keinen», formulierte Martin Walser für die Intellektuellen, und die Stimmung der »classe politique« der westlichen Demokratien brachte die Sunday Times auf die Formel: »Nach dem großen Bundeskanzler folgt jetzt ein langer.« 16Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 6. 3. 1983, bei der die Union 48,8 Prozent der Stimmen erhielt und die FDP erhalten blieb, demonstrierte, daß die Intellektuellen nicht das Volk sind und daß die Wähler den Grund für den Wechsel der FDP begriffen und gebilligt hatten.
Die neue Legislaturperiode sah einen Bundeskanzler ohne Fortune. Ausgerechnet ein eher konservativer Politiker hatte Schwierigkeiten mit dem Apparat und den Institutionen. Unregelmäßige Kabinettssitzungen und die Unfähigkeit einiger Mitarbeiter des Kanzlers, seine Arbeit sinnvoll mit Hilfe des Apparates zu ordnen, belebten das Wort von der Führungsschwäche neu. Der neue Bundeskanzler war zudem kein Freund der Medien und diese ihm selten gewogen. Skandale und Affären begannen den Horizont zu verdüstern. Die Wörner-Kießling-Affäre war nicht nur ein Beispiel für die Unfähigkeit eines Ministers und die Ungeschicklichkeit des Kanzleramtes, sie offenbarte auch Defizite der »politischen Kultur« des Kanzlers. Daß diese Affäre nach Umfrageergebnissen und nicht nach moralischen Maßstäben entschieden wurde, entfremdete dem Kanzler auch Meinungsführer aus dem konservativen publizistischen Spektrum. Dies setzte sich mit dem Entwurf eines Amnestiegesetzes für unrechtmäßig vereinnahmte Parteispenden fort. Zwar handelte es sich bei der Flick-Affäre um ein Erbe aus sozialliberaler Zeit und eine Verfehlung aller politischen Kräfte gegenüber der Wirtschaft, der man die rechtswidrige Spendenpraxis nahegelegt hatte, die Art des Vorgehens jedoch wurde allein Kohl zur Last gelegt, während die FDP trotz Anklage und Verurteilung ihres Wirtschaftsministers den Eindruck moralischer Läuterung erwecken konnte. Helmut Kohl hatte zu Beginn seiner Kanzlerschaft eine »geistig-moralische Wende« versprochen, nun holte ihn das Echo dieser letztlich substanzlosen Ankündigung ein. Auch mußte er sich in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode mit den Angriffen von Strauß auf seinen Außenminister Genscher herumschlagen, der Kontinuität verkörperte, wo Strauß die Wende einforderte. Reagans nicht ganz freiwilliger Besuch in Bitburg spaltete die öffentliche Meinung in Deutschland und rief erhebliche Irritationen im Ausland hervor. Daß die Bundestagswahlen 1987 keinen Wechsel brachten, hatte die Regierung neben dem anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg vor allem der SPD zu verdanken, die noch immer am Schmidt-Syndrom litt und ihren Kanzlerkandidaten Johannes Rau nicht geschlossen unterstützte. Bei dieser Ausgangslage waren 44,3 Prozent für die CDU/CSU mager und lösten sofort einen neuen Streit um Wahlkampfstrategie und Lagerdenken zwischen CDU und CSU aus. Allein die Nachrüstung, die Helmut Schmidt in einen unlösbaren Konflikt mit Fraktion und Partei gestürzt hatte, wurde von der Koalition geschlossen getragen und trotz der größten Massendemonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik auch durchgesetzt. Das Verdienst hieran gebührt in erster Linie Helmut Kohl.
Читать дальше