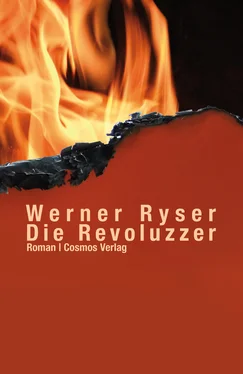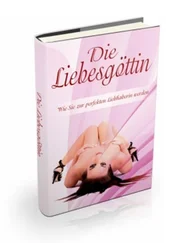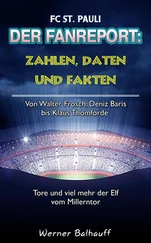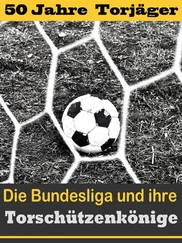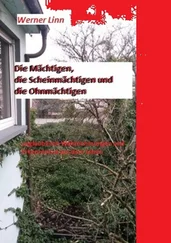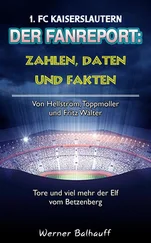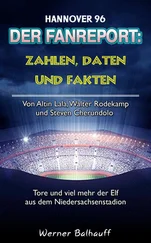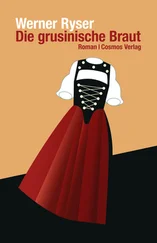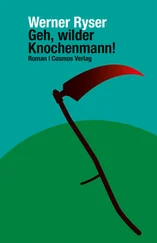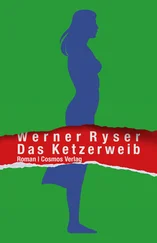Dorothea sah ihrem Vater nach. Sie hasste ihn. Er war ein machtbesessener, auf seine Würde bedachter städtischer Patrizier, der das Glück seiner Mitmenschen bedenkenlos mit Füssen trat, wenn es um seine eigenen Interessen ging. Manchmal geschah dies gar aus einer blossen Laune heraus. Nicht nur Mathis, auch sie selbst war ein Opfer der väterlichen Willkür.
Mathis war zwei Jahre älter als sie. In ihrer Jugend waren sie unzertrennlich gewesen. Sie begleitete ihn auf die Weide und in den Wald. An seiner Seite half sie bei der Heuernte mit. Er brachte ihr das Melken bei. Einmal durfte sie dabei sein, als eine Kuh kalbte. Dorothe nannte er sie – bis zu jenem Tag vor vier Jahren, als ihr Vater zwischen seinen Geschäften in der Stadt wieder einmal für zwei oder drei Tage nach Sankt Wendelin kam. Preiswerk machte dem damals Achtzehnjährigen unmissverständlich klar, dass er als Sohn des Pächters seine Tochter als Jungfer Dorothea anzusprechen habe. Er hatte ihn unterm Kinn gefasst und gezwungen, ihm in die kalten Augen zu schauen. «Jungfer und Dorothea. Dorothea, nicht Dorothe. Sie ist schliesslich keine Bauerndirne. Hast du das verstanden?» Und als der junge Mann eingeschüchtert schwieg, lauter: «Hast du das verstanden?»
«Ja, Herr», presste Mathis zwischen den Zähnen hervor.
«Na also, es geht doch.» Remigius Preiswerk wandte sich an Mathis’ Vater, der schweigend danebenstand. «Wenn du auf dem Hof Pächter bleiben willst, Johann», knurrte er, «dann sorg dafür, dass die Ordnung der Dinge gewahrt bleibt.»
Später, beim Nachtessen, oben in der Wohnung, begehrte sie gegen den Alten auf. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen: «Ich bin nicht die Jungfer Dorothea!», schrie sie. «Nicht für Mathis.»
Er zog die Brauen zusammen. «Jungfer Dorothea und später Madame und der Name des Mannes, den ich für dich aussuchen werde.»
«Nein.» Sie ballte die Fäuste.
«Nein?» Remigius Preiswerk packte sie, legte sie übers Knie und verprügelte sie mit seinem Stock. «Wer bist du?», brüllte er, immer wieder. «Wer bist du?» Er liess erst von ihr ab, als sie ihm schluchzend bestätigte, sie sei die Jungfer Dorothea.
Am andern Tag, als sie sich vor dem Hof begegneten, schauten sich die beiden Jungen verstört an. «Grüss dich, Mathis», sagte sie schliesslich.
«Grüss Euch.» Er schaute sie kurz an und lief dann in Richtung Wald davon.
Damals war etwas in ihr zerbrochen. Zwei Jahre später wurde Dorothea, ohne dass man sie nach ihrer Meinung gefragt hätte, standesgemäss mit dem mehr als doppelt so alten Christoph Staehelin verheiratet. Nachdem dieser während Jahren als Offizier in einer der vier Basler Kompanien in Frankreich gedient hatte, wurde er Oberst bei der Landmiliz. Die Ehe war nicht glücklich. Trotz Dorotheas Bitten und Drängen weigerte sich Staehelin, ein ausgesprochener Libertin, sein Verhältnis mit einer Dame von zweifelhaftem Ruf aufzugeben.
Dass sie zur Heirat den Hof Sankt Wendelin als Brautgabe erhalten hatte, war für sie ein Trost. Staehelin war kurz nach der Hochzeit einmal dort gewesen. Aber das Landleben behagte ihm nicht. Dorothea hingegen verbrachte die Zeit zwischen Johanni und Michaelis meist auf dem Hof.
Mathis schloss, vom ungewohnten Licht geblendet, die Augen. Die Tür zu seinem Kerker war endlich aufgeschlossen worden, und eine Laterne erleuchtete das Verlies. Gestern hätte seine Hochzeit stattfinden sollen. Jetzt würde man ihn laufenlassen.
«Das stinkt ja wie in einem Schweinestall», sagte Brodbeck angewidert und trat einen Schritt zurück. Der Landvogt hatte sich persönlich zu ihm in die Unterwelt bemüht. Eine Wache begleitete ihn. «Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt», knurrte er.
«Ja, Gnädiger Herr», sagte Mathis, gewillt, den Zorn zu bezähmen, der ihm geholfen hatte, die vergangenen Tage zu überstehen.
«Nun, der Ratsherr Preiswerk war der Meinung, die fünf Tage, zu denen ich dich verurteilt habe, seien für einen Flegel wie dich zu wenig, um ihn zur Besinnung zu bringen. Wir werden dich deshalb bis Ende Woche hierbehalten.» Brodbeck sah seinen Gefangenen lauernd an.
Mathis biss sich auf die Unterlippe
«Du hast nichts dazu zu sagen?»
«Nein, Herr», sagte er gepresst.
«Weiterhin Wasser und Brot!», befahl der Landvogt der Wache. «Und nun sperr die Türe wieder zu!»
Wie betäubt liess sich Mathis auf die Pritsche fallen. Seit Remigius Preiswerk ihm zu verstehen gegeben hatte, dass er keinerlei freundschaftlichen Verkehr zwischen ihm und Dorothea dulde, hatte er den Sohn seines Pächters mit Misstrauen beobachtet. Mathis wusste, dass der Tyrann an jenem Abend seine Tochter gezüchtigt hatte. Er war damals im Hof unter dem offenen Fenster gestanden, ohnmächtig, mit geballten Fäusten.
Mathis hatte sich geschämt, dass er unfähig war, sie vor ihrem Vater zu schützen. Er war überzeugt, ihrer nicht wert zu sein. Seither hatte er sich von Dorothe – für ihn war sie Dorothe geblieben – ferngehalten. Und er hatte auch stets darauf geachtet, dem Alten nicht in die Quere zu kommen. Weshalb hatte Remigius Preiswerk trotzdem seine Kerkerhaft verlängert? Aus schierer Boshaftigkeit? Ging es ihm darum, seine Macht zu demonstrieren und ihn, den leibeigenen Untertanen, klein zu halten?
Mathis spürte, wie sich zum Zorn der vergangenen Tage der Hass gesellte, ein kalter, abgrundtiefer Hass: auf den Landvogt, auf Remigius Preiswerk, auf die Gnädigen Herren von Basel. Und er fühlte, dass dieser Hass ihn künftig begleiten würde.
Am 22. Juli blieb Dorothea Staehelin in ihrer Wohnung. Sie wusste, dass Mathis heute im Verlauf des Tages aus seiner Haft entlassen würde. Das niederträchtige Handeln ihres Vaters erfüllte sie mit Scham, und die Vorstellung, dass Mathis glauben könnte, sie sei damit einverstanden gewesen, quälte sie. Was sollte sie tun oder sagen, wenn sie ihm draussen vor dem Haus gegenüberstehen und er an ihr vorbeigehen würde, ohne sie zu beachten?
Sie hatte sich mit einer Stickerei ans Fenster gesetzt, aber sie mochte nicht arbeiten. Sie dachte an das schwärmerische junge Mädchen, das sie einst gewesen war. Ihr Herz war weit geworden, wenn sie das Geläut der Herden und den morgendlichen Gesang der Vögel gehört hatte. So hatte sie es jedenfalls in einem Brief an ihre Freundin, Anna Sarasin, formuliert. Was sie ihr aber nicht geschrieben hatte: In Mathis Jacob, dem Sohn des Pächters, sah sie das lebende Vorbild für den allerliebsten Schäfer in seinem Rokokokostüm, das in der Manufaktur von Meissen hergestellt worden war und im elterlichen Haus zum Goldenen Falken am Nadelberg die Kredenz zierte.
Vom Vorhang halb verborgen, schaute sie immer wieder aus dem Fenster. Endlich, um die Vesperzeit, sah sie, wie Mathis vom Wald her auf den Hof zuschritt: ein Soldat der Landmiliz, das Gewehr an einem Riemen über die Schulter gehängt. Ihr Herz klopfte wie wild, und sie spürte, wie ihr das Blut in die Wangen schoss. Seine Uniform war verschmutzt, sein Gesicht ausgezehrt vom zehntägigen Fasten, sein schwarzes, struppiges Haar fiel ungekämmt über die Ohren, und seine unrasierten Wangen und das Kinn schimmerten bläulich. Das war nicht mehr der romantische Schäfer ihrer Jungmädchenträume, das war ein Krieger, der stattlichste Mann, dem Dorothea je begegnet war.
Mathis schaute zum Fenster hoch. Ihre Blicke kreuzten sich. Zaghaft hob sie die rechte Hand. Huschte ein Lächeln über sein Gesicht? Sie glaubte, es gesehen zu haben. Sie wollte es gesehen haben.
Dorothea liebte das Land am Oberen Hauenstein mit seinen steilen Hügeln, den schroffen Kalksteinfelsen, dem lichten Mischwald und den Waldweiden. Sie liebte den weiten Blick nach Norden über die Hochebenen des Tafeljuras bis zum fernen Schwarzwald. Sie liebte Sankt Wendelin, ihren Hof, mit seinen aus hellem Jurakalk gefügten Bruchsteinmauern und dem mit Ziegeln bedeckten Satteldach. Es beschirmte den grossen Stall, das Tenn und die beiden Wohnungen, von denen sie jene im ersten Stockwerk für sich bestimmt hatte. Sie oben, die Jacobs unten. Besitzer und Pächter, städtische Herrschaft und ländliche Untertanen, oben und unten – wie es im Baselbiet Brauch war.
Читать дальше