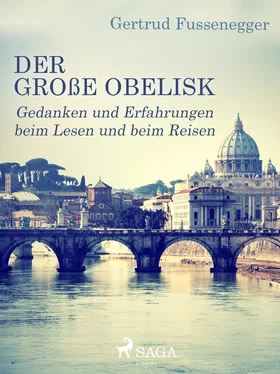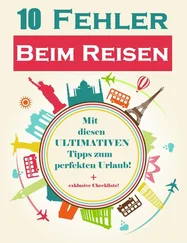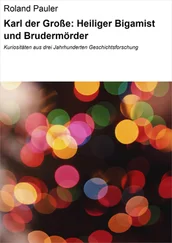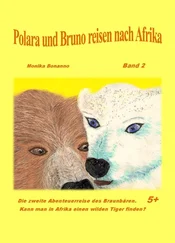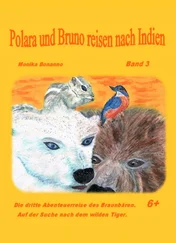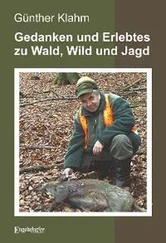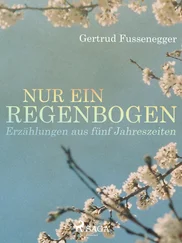Wieder ein feierlicher Beginn der Arbeit; wieder waren das Kollegium der Kardinäle, das Corps der Botschafter und tausend und abertausend Menschen versammelt; wieder waren die Befehle des Papstes verkündigt und eingeschärft worden: niemand dürfte die Schranken durchbrechen, niemand mit einem Wort die Stille stören. Wieder Messen, Gebete und dann ein Trompetensignal. An den vierzig Winden setzten sich abermals 900 Menschen und diesmal 140 Pferde in Bewegung. Stunde um Stunde verging. In stummer Spannung hielten die Tausende aus und sahen zu, wie sich der Koloß langsam, ganz langsam, fast so unmerklich wie der Zeiger einer Uhr aus der Waagrechten hob. Schon war er weit aufgestiegen, schon trennten ihn nur noch wenige Winkelgrade von der Senkrechten, da – plötzlich – stockte die Arbeit. Einige Winden liefen leer, andere blockierten, das System der Flaschenzüge und Verspannungen versagte. Die Vorarbeiter blickten sich hilfesuchend nach dem Architekten um. Der Architekt stand ratlos. Auch der Papst war aufmerksam geworden, Kardinäle und Botschafter reckten die Hälse. Was war denn geschehen? So sorgfältig Fontana alles berechnet, wieder berechnet, geprüftund überlegt hatte, eins war ihm doch entgangen: das Riesengewicht des Obelisken hatte die Seile derart ausgedehnt, daß die mühsam erstellte Maschinerie nicht mehr funktionierte. Der Koloß stand auf der Kippe und war nicht mehr weiterzubewegen. Sollte das ungeheure Unternehmen in der letzten Minute mißglückt sein?
Da plötzlich ist an den Schranken unten ein kurzes Schieben, Stoßen, Vorwärtsprellen: ein Mann hat sich an die Barrieren durchgekämpft, hat sich herübergeschwungen und läuft vor, läuft in den freien, abgeriegelten verbotenen Raum, und dabei schreit er, schreit etwas vorerst kaum Verständliches, doch schreit er’s noch einmal, da wird es deutlich und lautet: „Tut Wasser an die Seile! Tut Wasser an die Seile!“
Zwei, drei oder fünf Sekunden lang ist die ganze Szenerie bewegungslos. Fontana steht und starrt den Fremden an, die Arbeiter stehen und starren gleichfalls, der Chor der Botschafter und Kardinäle atemlos, vorgebeugt und lauschend, und selbst der Papst, der sich aus seiner Sedia erhoben hat, verharrt so, und sein altes, häßliches, runzeliges Bauerngesicht, das eben erst bis in die Lippen erblaßt war, ist ganz aufgerissen vor Staunen, Überraschung und Nichtbegreifen, Nichtbegreifen, in dem sich doch von Sekundenbruchteil zu Sekundenbruchteil Begreifen anbahnt, vorformt, durchformt und dann hervorbricht in den beinahe röchelnd hervorgestoßenen Worten: „Ja, Wasser, tut Wasser an die Seile!“
Da hat sich das Bild rund um den auf der Kippe schwebenden Obelisk auch schon durchaus verändert, aus zuckender Ratlosigkeit zuvor, Unbeweglichkeit danach bricht plötzliche Emsigkeit aus, ein Hasten und Rennen zu den Brunnen, ein Schöpfen und Schleppen, mit einem Male sind, weiß Gott woher, Eimer vorhanden, Krüge und Schläuche, und auf die armdicken Seile ergießt sich Schwall um Schwall.
Was danach geschah, können wir uns leicht vorstellen: die Seile zogen sich wieder zusammen, sie verkürzten sich auf die Länge, mit der der Architekt zuvor gerechnet und auf die er seine Winden und Züge eingestellt hatte. Das System funktionierte wieder, und bald stand der Obelisk aufrecht und fest auf seinem Postament.
Hier halte ich inne, um von der Erzählung zurückzukommen auf meine Frage: Was ist das Poetische? Was können wir poetisch nennen?
Ich meine, wir haben soeben ein Beispiel gehört, ein Beispiel wenigstens dafür, wie sich das Poetische aus einer Fabel ergeben, sich als Effekt einer Handlung einstellen kann.
Die Geschichte beginnt wie so viele historische Anekdoten im Raum historischer Kategorien: der Obelisk als Beute der Macht, als Zeichen der Macht, die Jahrhunderte überdauernd. Dann tritt eine neue Macht auf den Plan, die des Papstes, die den Obelisk neuen Zwecken zuführen will. Der päpstliche Befehl, die technische Vorbereitung, der Vorgang der Übertragung … das alles sind Berichte, die vielleicht ganz interessant klingen, die vielleicht unseren historischen Sinn ansprechen, die unter Umständen sogar malerisch-romantische Szenerien vor unser inneres Auge zaubern. Poetisch sind sie nicht. Zwar: wenn wir von dem befohlenen Schweigen hören, von dem verbotenen Raum, da siedeln sich in uns möglicherweise schon unterschwellige Ahnungen an, daß der Vorgang nicht so ohne weiteres ablaufen wird. Doch es sind eben nur Ahnungen; schließlich tritt die Stockung ein. Sie setzt ein deutliches Moment der Spannung. Trotzdem! Poetisch ist sie noch nicht. Erst in dem Augenblick, wo aus der anonymen Menge, aus der gesichtslosen Masse plötzlich einer, ein einziger hervorspringt und unter Einsatz seines Lebens das rettende Wort ruft, hier erst erfolgt der Umschwung, der Sprung hinüber in eine andere Zone, in die Erweisung des Poetischen. Denn, nicht wahr?, in diesem Augenblick ist dieser Mensch, dieser eine – eben noch gar nicht sichtbar Gewesene, er ist größer, wichtiger als der Architekt, der das Unternehmen leitet, als alle seine Helfer, größer als die Zuschauer auf der Kardinalstribüne, größer als der Papst und, ich möchte beinahe sagen, größer sogar als der Obelisk, dieses stumme, mit geheimen Mächten geladene Symbolum. Vor dem nüchtern-sachlichen Wissen dessen, der Bescheid weiß, vor seinem Mut, seiner Mannhaftigkeit verblaßt auch der Obelisk für einen Augenblick und gibt den Blick frei auf den Menschen in dessen voller sachbezogener Vernünftigkeit.
Hier haben wir die zarte Überraschung, die sinnvolle Sinnesverkehrung, den erheiternden Effekt der antithetischen Position. Der Namenlose wird zum Retter, der Niemand zur Schlüsselfigur. Er bringt in das Schauspiel mechanischer Kräfte einen neuen Gesichtspunkt ein, er ändert die Physik des Vorgangs, und die Überraschung, die seine Figur auslöst, gehört zu den Überraschungen, die das Poetische mit sich führt.
Hier wird Poesie geleistet.
Aber die Geschichte ist nicht zu Ende, leider. Denn der poetische Ansatz bleibt als solcher stehen und kommt im weiteren Verlauf nicht zum Tragen.
Noch während man auf die Weisung des Unbekannten mit größtem Eifer und in höchster Hast am Werk ist, Wasser herbeizuschaffen und die Seile zu begießen, kommt natürlich und ganz unvermeidlich der martialische Bargello herbei, um seines Amtes zu walten. Er nimmt den Mann in Haft, er führt ihn ab. Doch ehe er ihn noch in den Kerker bringen kann, schmettern schon die Trompeten, schießen die Kanonen, läuten die Glocken von Rom Sieg und Gelingen. Der Obelisk ist aufgestellt, und da kommt auch schon ein Bote gelaufen und keucht seinen Auftrag: Seine Heiligkeit der Papst habe befohlen, den Mann, der gerufen habe, vor seinen Thron zu bringen. Das geschieht, und nun stellt sich heraus, daß der Mann Bresca heißt und ein Schiffer ist aus San Remo bei Genua und deshalb Erfahrung hat mit Tauen und Seilen, die sich bei Regenwetter zusammenziehen, bei Trockenheit ausdehnen, und der auf diese Weise erkannte, woran es lag, daß sich Fontanas geistreiche Apparaturen im letzten Augenblick als unbrauchbar erwiesen.
Der Papst dachte nun freilich nicht mehr daran, den Mann zu bestrafen, im Gegenteil, er fragte sogar, welche Gunst er sich erbitte, welchen Lohn, und da sagte der Mann, er erbitte sich das Recht, am Palmsonntag den Römern die Palmblätter zu verkaufen, die sie dann zur Weihe trugen – ein bombensicheres Geschäft. Und wirklich: Bresca erhielt das Recht, und es wurde dann auch auf seine Nachkommen übertragen, und so wurde Bresca Palmblätterverkäufer und ein reicher Mann, und auch seine Familie wurde reich und blieb es jahrhundertelang.
Hier ist die Zone des eigentlich Poetischen schon wieder verlassen. Hier schlägt die Anekdote aus der symbolischen Dimension zurück ins Banausisch-Erbauliche, hier pendelt sie aus dem Bereich zarter Überraschung in den der Banalität, wo sich vielleicht noch sprichwörtliche Wahrheiten zu bewähren haben wie „Guter Rat ist Goldes wert“ oder „Eine Hand wäscht die andere“.
Читать дальше