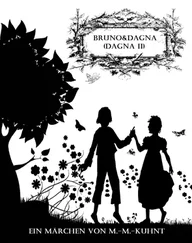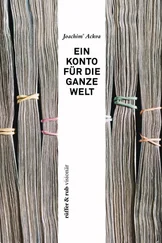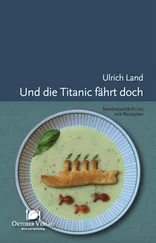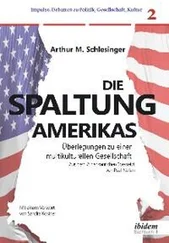Das paßt nun wiederum zu den Erkenntnissen, zu denen Thor Heyerdahl in seinem zusammen mit Per Lilliestrøm verfaßten Buch Ingen Grenser (»Keine Grenzen«) gelangt. Darin erzählt Heyerdahl, daß er auf einer Konferenz auf Island die Frage der in der Saga erwähnten vinländischen Trauben angeschnitten habe, worauf allgemein die Ansicht vertreten wurde, das Wort »vin« 3, so, wie es in den Sagas verwendet wird, beziehe sich tatsächlich auf gegorenen Traubensaft und nicht auf Weideland. »Es wurde darauf hingewiesen, daß das Wort ganz anders betont wird, wenn von einer Weidefläche die Rede ist«, schreibt Heyerdahl.
Er berichtet, daß die isländischen Tagungsteilnehmer davon überzeugt waren, daß die Vinlandreisenden wirklich wilde Trauben gefunden hatten. Er erzählt, der Historiker Páll Bergþórsson habe ihm einen Bogen aus seinem Herbarium geschenkt, auf dem wilde Trauben gepreßt waren, die er selber im August 1996 in der St. Lorenz-Bucht gepflückt hatte. Diese Trauben hatte er als Vitis riparia identifiziert, eine wilde Traubenart, die auf Englisch »Riverbank Grape« genannt wird. Dies stimmt mit botanischen Fachbüchern überein, die angeben, daß diese Trauben in so weit nördlichen Gegenden wie der Provinz Québec vorkommen. Aber so weit im Osten wie Neufundland sind sie niemals registriert worden. Das muß jedoch nicht heißen, daß Heyerdahl sich geirrt hat. Vor tausend Jahren herrschte in Neufundland ein milderes Klima als heute und deshalb können die Vitis riparia durchaus vor tausend Jahren, als Leif Eirikssohn in L’Anse aux Meadows an Land ging, dort heimisch gewesen sein. Es ist natürlich auch möglich, daß die Vinlandfahrer die St. Lorenz-Bucht erforscht und dort Weintrauben gefunden haben, auch wenn die Sagas das nicht erwähnen.
Daß so dicht bei den »Leifsbuden« (wie die Häuser der Siedlung später genannt wurden) wilde Trauben gefunden worden sind, ist noch kein Beweis dafür, daß die anschauliche Beschreibung der Sagas über den Traubenfund zutrifft. Es kann jedoch möglicherweise zu neuen diesbezüglichen Untersuchungen anregen.
Aber auch Helge Ingstad bringt gute Argumente für seine Theorie. Er beruft sich unter anderem auf einen Artikel, den der schwedische Sprachwissenschaftler Sven Söderberg 1910 in der Zeitung Sydsvenska Dagbladet veröffentlicht hat. Laut Söderberg gibt es keinerlei Zusammenhang zwischen Weintrauben und dem Namen Vinland, diese Assoziation beruhe auf einem sprachlichen Mißverständnis. Söderberg führt die Silbe »Vin-« in Vinland zurück auf das altnordische Wort vin , das Grasfläche oder Weideland bedeutet.
Ingstad, möglicherweise der Norweger, der zu diesem Thema die Saga am gründlichsten studiert hat, weist in seinem Buch Oppdagelsen av det nye land (»Entdeckung des neuen Landes«) daraufhin, daß es in Norwegen ungefähr tausend Ortsnamen gibt, in denen die Silbe vin in der genannten Bedeutung auftaucht, zum Beispiel Bjørgvin (der alte Name der Stadt Bergen) oder Vinje . Ingstad schreibt: »Der Name Grasland war bei den altnordischen Auswanderern, für die Weideland für ihr Vieh eine Lebensnotwendigkeit darstellte, von höchster Bedeutung.«
Der Name Vinland wird erstmals von dem deutschen Historiker Adam von Bremen erwähnt, der in seinem umfassenden Werk Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (»Die Geschichte des Bistums Hamburg«), das er vermutlich um das Jahr 1075 vollendete, folgendes schreibt: »Außerdem hat er« (der dänische König Svein Estridssohn) »eine weitere Insel erwähnt, die in jenem großen Meer von vielen aufgesucht worden ist, und die Vinland genannt wird, weil dort Weinreben wachsen, die köstlichsten Wein ergeben.«
Das Werk Adams von Bremen gilt als eine ungeheuer wichtige Quelle für die Geschichte Nordeuropas, in der es jedoch auch zu nachweislichen sprachlichen Mißverständnissen kommt. Adam schreibt unter anderem, die Insel Grönland habe ihren Namen erhalten, weil die dort wohnenden Menschen vom Meer grün gefärbt würden, und die Silbe kvæn im Landschaftsnamen Kvænland sei vom Wort kvinne (norwegisch für »Frau«) abzuleiten, während wir heute wissen, daß sie von den Kvenen herstammt, einer westfinnischen Volksgruppe.
Da Adam von Bremens Buch das erste uns bekannte Schriftstück ist, in dem die Reisen nach Vinland erwähnt werden, ist es möglich, daß seine Fehldeutung von den isländischen Saga-Verfassern übernommen wurde.
In der Wikingerzeit gab es viele Städte in Norwegen, die vin im Namen trugen, und da bedeutete es Gras. Dies kam auch auf Jæren vor, wo Eirik der Rote herstammte. Eirik muß diese Bedeutung des Wortes also gekannt haben und es ist denkbar, daß er sie mit nach Grönland genommen hat.
Immer wieder ist die Frage gestellt worden, woher die anschauliche Beschreibung, die die Saga vom Traubenfund liefert, denn stammen mag, wenn in Vinland gar keine Trauben wachsen konnten. Ist das dichterische Freiheit? Nein, meint Helge Ingstad: »Wenn die Autoren der Sagas von den vinländischen Weintrauben berichteten, dann galt das bei ihnen nicht als Dichtung, sondern als Tatsache, die sich auf ein anerkanntes und gelehrtes europäisches Werk berufen konnte. Die Isländer waren von solchen Informationen sicher begeistert. Nicht nur gelangte ihre Entdeckung damit gewissermaßen zu akademischen Weihen, sondern erhielt auch noch den romantischen Nimbus einer Art Schlaraffenland mit Weintrauben, Mengen von wildwachsendem Getreide und anderen Gütern. Für die Isländer gewannen damit die Unternehmungen ihrer Vorfahren noch einmal neuen Glanz.« Ingstad fügt hinzu: »Es lag sicher auf der Hand, daß diese willkommenen Mitteilungen aus anerkannter Quelle auch zu Unterhaltungszwecken herangezogen wurden. Natürlich fühlten isländische Autoren sich angesichts dieser fesselnden Motive dazu verlockt, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen.«
Die Diskussionen über den Namen Vinland sind nicht mehr so wichtig, seit das Ehepaar Anne Stine und Helge Ingstad die altnordische Siedlung bei L’Anse aux Meadows freigelegt und damit ein für allemal die genaue Lage Vinlands nachgewiesen hat. Doch die Vinland-Debatte zeigt, welche Bedeutung der korrekten Saga-Interpretation zukommt. Ein Teil der dort beschriebenen Ereignisse und Zustände trifft absolut zu, anderes ist unklar, wiederum anderes ist nachweislich reine Erfindung. Die Verfasser der Sagas waren selber keine Augenzeugen der von ihnen beschriebenen Ereignisse. Ihre Aufgabe war, das, was sie gehört und gelesen hatten, aufzuschreiben, nachdem die handelnden Personen längst verstorben waren. Aber wir dürfen nicht alles glauben, was wir hören oder lesen, schon gar nicht dann, wenn diese Berichte über Generationen von Mund zu Mund weitergereicht worden sind. Außerdem sollten wir nicht vergessen, daß die Verfasser der Sagas manchmal durchaus ein Interesse daran hatten, bestimmte Personen oder bestimmte Ereignisse in einem gewissen Licht zu schildern.
Der erste Winter in Vinland geht dem Ende entgegen. Leif und seine Männer sind mit dem bisher Erreichten durchaus zufrieden. Sie sind an der von Bjarni entdeckten Küste an Land gegangen und haben die Umgebung erforscht. Und sie sind zu einem großartigen Ergebnis gekommen: Hier können wir leben! Jetzt will Leif nach Hause fahren und denen, die auf Grönland warten, die gute Nachricht mitteilen.
Er schaut sich um, als sie die Landspitze am Auslauf des kleinen Fjords umrunden. Er wirft einen letzten Blick auf die Grashäuser oberhalb des Strandes und auf die grünen Wiesen, die sich bis zum Wald im Hintergrund ziehen. Er weiß, daß er eine Leistung vollbracht hat, von der noch lange die Rede sein wird, und er fühlt sich endlich als Mann. Er ist nicht mehr nur der Sohn Eiriks des Roten, des Neusiedlers. Jetzt ist er selber der Entdecker eines neuen Landes. Und er weiß, wie er es nennen wird: Vinland, das gute Land.
Читать дальше
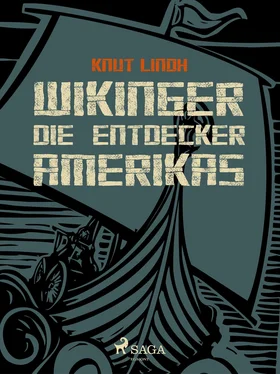
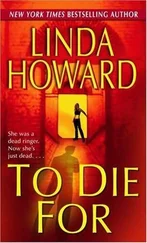



![Linda Zuckerhof - Die geile SUB [Hardcore BDSM]](/books/490936/linda-zuckerhof-die-geile-sub-hardcore-bdsm-thumb.webp)