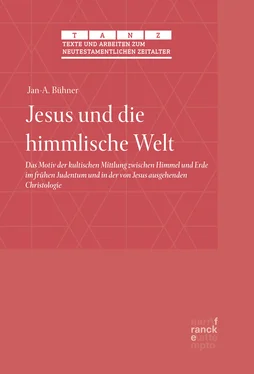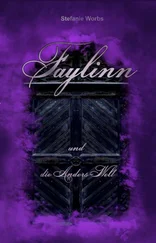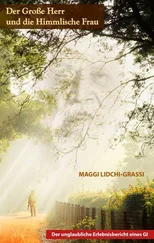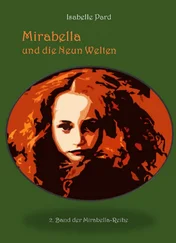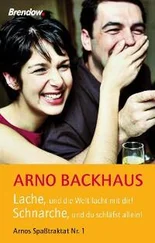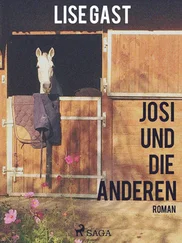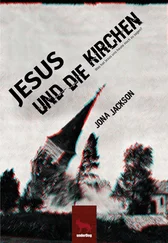Schmidt verwies dazu auf R. Otto, der vom „numionse(n) Eindruck Jesu auf seine Schüler“26 und davon sprach, Jesus sei entsprechend analogen Phänomenen der religiösen Gruppenbildung „… ein Heros bei Lebzeit …“27 gewesen. Schmidt fasst zusammen: „Wie der Zaddik seiner Gemeinde, seinen Jüngern, so ist auch Jesus zu seinen Lebzeiten, aber auch als der Erhöhte, der pneumatische, das πνεῦμα seiner Gemeinde, seinen Jüngern gegenwärtig gewesen.“28
Konsequenterweise spricht Schmidt von Jesus als dem Kultstifter des Urchristentums.29 Diese bestechende These, die die dem Kultus eigene Mittlerschaft zum Himmel auf den irdischen Jesus zurückführen will, hat in der Forschung kaum Anklang gefunden: Sie ist zu strukturalistisch und zu sehr allgemein religionsphänomenologisch gehalten – um den romantischen Beigeschmack nicht zu betonen – und arbeitet weder religions- noch traditionsgeschichtlich. Der Sprung von der formgeschichtlichen Gattungsbestimmung ‚Kultlegende‘ in das dafür vorausgesetzte Milieu der Tradenten bleibt ein Postulat, das durch die Analogisierung mit dem Chasidismus des 18. Jahrhunderts keine ausreichende Basis erhält.
Dennoch enthält Schmidts Arbeit Hinweise, wie religions- und traditionsgeschichtlich weitergearbeitet werden könnte: Die kultischen Denkformen mit ihren mythischen, über die innerweltliche Geschichte hinausweisenden himmlischen Komponenten sind ja offenbar noch im späten Chasidismus in Analogie zum kultischen Ritual des Jerusalemer Tempels verstanden worden. Dies führt zur Frage nach einer möglichen traditionsgeschichtlichen Rückbindung der chasidischen Kultrezeption an die frühjüdische Zeit. Die Qumran-Texte haben grundsätzlich auf das Recht dieser Fragestellung hingewiesen: Die Ideologie des Kultes ist schon in vor-neutestamentlicher Zeit umgesetzt worden in eine nicht mehr am Tempel hängende, pneumatische Gemeindelehre.
Damit entsteht die den Ansatz von Schmidt traditionsgeschichtlich tragende Frage, ob Jesu Eschatologie und seine Beziehung zum Himmel in eine Tradition der Rezeption und Umsetzung des schöpfungsordnenden Anspruchs des Jerusalemer Kultes gehören.
In Fortsetzung seiner Untersuchung zum traditionsgeschichtlichen Zusammenhang neutestamentlicher und frühkirchlicher Kultmotive mit der Tempelideologie des Judentums hat J. Jeremias in seinem Beitrag ‚Jesus als Weltvollender‘, 1930, diese kultgeschichtlichen Zusammenhänge auf die Frage nach den theologischen Leitmotiven Jesu zugespitzt.30 Jeremias kontrastiert, ganz im Sinne der ‚Kultgeschichtler‘, den abendländischen Rationalismus und seinen auf Entwicklung bedachten Geschichtsbegriff mit dem zyklischen des Alten Orients und der Bibel: Geschichte beruhe auf dem Wissen um eine Schöpfungsordnung und den zyklischen Versuchen, durch kultische Vermittlung zu ihr zurückzukommen.31 Jesu Auftreten stehe so unter dem Anspruch, die eschatologische Rückkehr zum Urstand der reinen, himmlisch-irdisch verbundenen, einen Schöpfung einzuleiten.32
Jeremias orientiert sich zunächst am Rahmengerüst des triplex munus, wobei er eine Steigerung mit Kulmination im königlichen Amt sieht.33 Auffällig und interessant ist freilich, dass Jeremias den Anspruch Jesu auf Weltvollendung stark als quasi hochpriesterliches Wirken zeichnet. Er nehme die vielfältigen, kultisch tradierten Kosmos-Symbole auf; er beziehe sein Auftreten auf das Bild vom Mantel des Hohenpriesters mitsamt seiner kosmischen Symbolik,34 er sei Baumeister des himmlisch-eschatologischen Heiligtums;35 er beziehe auf sich die Kultmotive, die kosmische Ernährung und Versorgung anzeigen;36 er dränge, stärker als dies je der Tempel konnte, Sünde, Tod und Teufel zurück;37 ja sein Vollmachtsanspruch münde in seinem jenseits allen Davidismus liegenden Menschensohn-Amt. Als dieser sei er Herr der himmlischen, eschatologischen Kultordnung.38
Der Anspruch auf Weltvollendung, die Jesus einleitet, äußert sich nach Jeremias also in einer Übernahme orientalischer und jüdischer Kultsymbolik. Der königliche, auf die ganze Schöpfung zielende Herrschaftsanspruch Jesu ziehe deshalb eine hochpriesterliche Vollmacht auf sich, weil er die kultisch verwaltete und erschlossene Schöpfungsordnung, am Tempel Jerusalems vorbei, in den eschatologischen Urzustand der gereinigten Einheit von Himmel und Erde bringen wolle.
Jeremias verzichtet auf ein Auszeichnen kultgeschichtlicher Zusammenhänge, sondern verbleibt stärker auf der motivgeschichtlichen Ebene. Zusammenhänge bestehen vor allem mit dem unten zu referierenden Buch Lohmeyers über ‚Kultus und Evangelium‘. Die bei Jeremias und Lohmeyer – durch eine Betonung der gemeinsamen, Jesus und Urgemeinde, Bibel und Alten Orient verbindenden Motive – mögliche Betrachtung auch der Jesus-Tradition im einheitlich – kultgeschichtlichen Sinne hat in der weiteren Forschungsgeschichte dennoch immer wieder dem mit der Kultgeschichte in ihrer hellenistischen Anfangsphase verbundenen Ausweichen auf einen doppelten Ansatz Platz machen müssen. Von diesem Trend sind auch spätere Arbeiten geprägt, die die Kultfrömmigkeit der Qumran-Gemeinde in Hinsicht auf das Neue Testament untersuchen.
Beckers forschungsgeschichtlich bedeutsame Arbeit zur Soteriologie der Qumrantexte39 nennt als religionsgeschichtlich mit dem NT und der Jesus-Tradition vergleichbare Struktur das hebräische Sphärendenken, in dem sich Gottesherrschaft und Satansherrschaft gegenüberstünden und aus dem heraus es dem qumranitischen Kultdenken möglich sei, zu einer Qualifizierung der Gegenwart unter dem himmlischen und eschatologischen Aspekt der Gottesherrschaft zu kommen. Diese religionsgeschichtlich in den Grundzügen wohl unumstrittenen Strukturen versucht Becker auch beim irdischen Jesus als wirksam zu erweisen. Er nimmt also, wenn man so will, den Impetus der ‚einheitlichen Linie‘ der Kultgeschichtler auf, kultisch getragenes religiöses Weltempfinden bei Jesus wiederzufinden. Es ist ja überhaupt deutlich, dass mit der Entdeckung der Qumrantexte die Position der ‚einheitlichen‘ kultgeschichtlichen Betrachtung gestärkt wurde, da auch hier sich priesterlich-prophetisches Reform-Charisma einzelner Lehrer mit einem neuen Kultverständnis der Gemeinde verband.
Wie sieht nun aber das Jesusbild aus, das Becker auf dieser Grundlage entwirft? „War Michael in M das entscheidende Haupt, das für Gott den Kampf ausfocht, so ist es bei den Synoptikern keine Gestalt aus der damaligen Vorstellung der Himmelswelt, sondern ein konkreter Mensch. Genauer gesagt: Jesus selbst weiß sich als der an Stelle Gottes Kämpfende.“40 Jesus habe einen einmaligen Auftrag, eine einzigartige Vollmacht, sein Tun und Reden seien einmalig; seine christologische Vollmacht sei in ihrer Einmaligkeit irgendwie latent vorhanden, noch nicht in das religionsgeschichtlich Vergleichbare hinein expliziert.41 „Jesus versteht sich als Gottes eschatologisches Wort und als sein entscheidendes letztes Handeln für die Menschen.“42 Letztlich ist es ein „unausweisbare(r) Vollmachtsanspruch“ und eine „unmittelbare Autorität“43; in all dem geschieht das „Sichereignen der Gottesherrschaft hier auf Erden …“44
Es ist deutlich, dass Becker hier jeden religionsgeschichtlichen Vergleich abbricht: Ist das Kultdenken der Qumranleute auf himmlische Fürsprecher angewiesen, so steht im Neuen Testament an deren Stelle ein ‚konkreter Mensch‘; zu dieser ungeschichtlichen, modernen Kategorie des ‚konkreten Menschen‘, der offenbar außerhalb eines himmlische ‚Merkwürdigkeiten‘ implizierenden Weltbildes in schlichter Gottunmittelbarkeit steht, treten dogmatische, die zudem durch eine bestimmte Kerygmatheologie geprägt sind. Brachte bei Weiss und anderen Jesu Sittlichkeit die kultische Verehrung durch die Gemeinde zustande, so ist es hier das unausweisbare Wort Gottes, das seinen Träger zum Urheber des Zur-Herrschaft-Kommens Gottes macht. ‚Konkreter Mensch‘ und ‚unausweisbarer Vollmachtsanspruch‘ hängen am ebenso richtigen wie fatalen hermeneutischen Grundsatz, wonach gilt: ‚individuum est ineffabile‘. Zum Erweis des Rechtes dieses Satzes muss aber unseres Erachtens der religionsgeschichtliche Vergleich soweit wie möglich getrieben werden; diesen aber von vornherein abzubrechen, bleibt Folgerung aus einem unbewiesenen Postulat. Becker unterstellt sich einem höchst zeitbedingten dogmatischen Programm, das er gegen seine eigene religionsgeschichtliche Arbeit ausspielt.
Читать дальше