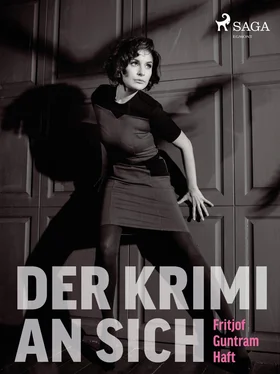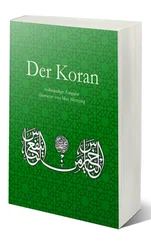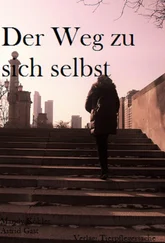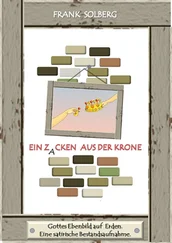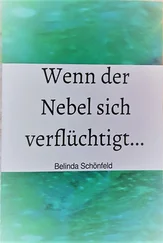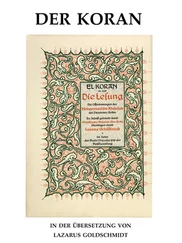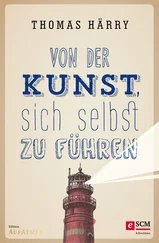In England schuf der Arzt und Schriftsteller Arthur Conan Doyle die Figur des »Sherlock Holmes« (1887). Dieser lebte in London in der Baker Street 221b, und wenn Sie einmal dorthin kommen, sollten Sie sein Wohnhaus aufsuchen, wo noch viele Gegenstände an ihn erinnern, so seine Dunhill-Pfeife, seine Deerstalker-Mütze und sein Inverness-Mantel. Holmes war »Consulting detective«, also Privatdetektiv, der im Unterschied zum »police detective« für Klienten tätig wurde. Sein Mitbewohner und Gesprächspartner war der Arzt Dr. John H. Watson, der als Stichwortgeber und Gesprächspartner das Vorbild für unzählige derartige Partner in modernen Krimis abgeben sollte (etwa im Derrick: »Harry, hol schon mal den Wagen.«) Seinen ersten Krimi veröffentlichte Doyle im Alter von 27 Jahren unter dem Titel »A Study in Scarlet« . In ihr lernen Holmes und Watson sich kennen und beziehen die Wohnung in der Baker Street. Ein gewisser Tobias Gregson gibt ihnen den ersten Auftrag. In einem verlassenen Haus wurde ein Ermordeter namens Drebber gefunden. An der Wand steht mit Blut geschrieben das deutsche Wort »Rache« . Holmes soll den Fall aufklären. Er findet einen Ehering bei ihm. Um den Mörder anzulocken, gibt Holmes eine Zeitungsanzeige auf, wonach ein Ehering gefunden worden und bei Dr. Watson abzuholen sei. Tatsächlich kommt eine alte Frau, Mrs. Sawyer, um den Ring abzuholen, den ihre Tochter angeblich verloren hat. Holmes folgt ihr, indem er auf ihre Droschke springt, aber am Ziel ist die Droschke leer. Es kommt dann die Polizei, und es gibt noch einen zweiten Toten. Die Polizei verhaftet wie üblich den Falschen, ehe Holmes dem Richtigen Handschellen anlegt. Es war – nein, nicht der Gärtner – es war der Kutscher.
In der Folgezeit waren zahlreiche Autoren erfolgreiche Krimischreiber, Edgar Wallace mit dem Hexer, Agatha Christie mit Hercule Poirot und Miss Marple, Georges Simenon mit Kommissar Maigret und viele andere. Heute ist ihre Zahl unübersehbar und wächst stetig an. Während das Gedichteschreiben – von gelegentlich »mit letzter Tinte« verfassten Ausnahmen abgesehen – stagniert, rollt eine wahre Krimiwelle über uns hinweg. Sie hat noch längst nicht ihren Scheitelpunkt erreicht. Die Wellenforscher sprechen von einer drohenden Monsterwelle, die man auch als Krimi-Kaventsmann 5 bezeichnen kann. Erbarmen ist hier so wenig zu erwarten wie auf dem Atlantik.
Der Krimi, ob wahr oder erfunden, erfüllt also eine wichtige literarische Funktion. Er zeigt uns, wozu wir fähig wären, wenn wir nicht so gehemmt wären. »Ich habe noch niemals von einem Verbrechen gehört, von dem ich mir nicht hätte vorstellen können, dass auch ich es hätte begehen können«, soll Goethe einmal zu Eckermann gesagt haben. Ich bin nicht sicher, daß er das wirklich gesagt hat, aber Goethe ist jemand, dem man das zutraut, und das ist praktisch dasselbe. Seine Aussage trifft sicher auch auf Sie und mich zu. Ich könnte Ihnen etliche Personen nennen, die ich sehr gerne mit einem Einschussloch in der Stirn sehen würde. Ein gut geplanter Mord ist ein »Genuß« , wie eine bekannte Brauerei zum Schluß eines jeden Tatorts im TV der wohlig erschauernden Community so treffend mitteilt. Die Produktion von Krimis in Form von Büchern, Fernsehserien und Filmen boomt daher, und sie wird immer mehr boomen bzw. Kaventsmänner produzieren.
Bei dieser Flut gibt es einen wichtigen Unterschied zur Liebesgeschichte und zu allen anderen inzwischen entstandenen Literaturgattungen (Roman, Novelle, Drama, Gedicht usw.). Anders als bei diesen können Sie das Schreiben von Krimis erlernen. Bei einem Gedicht ist das ganz und gar unmöglich. Stellen Sie sich vor, Sie säßen an einem Sommerabend allein vor einer Holzhütte auf einem von Wäldern umgebenen Berg. Sie hätten einen Korb mit mehreren geleerten Flaschen Würzburger Stein neben sich stehen, wären also betrunken, und in den Tälern würde sich der Nebel ebenso ausbreiteten wie in ihnen die Rührung. Ist der neblige Abend nicht ein Sinnbild des Vergehens im Leben? Sie wollten das in einem Gedicht beschreiben? Gelänge Ihnen das? Nein, never, na bitte! Und jetzt geben Sie bei Google die Zeile »Über allen Gipfeln ist Ruh« ein und lesen Sie, wie Goethe diese Aufgabe gelöst hat. Oder stellen Sie sich vor, Sie hätten zu Fuß den Brocken erklommen und stünden nach stundenlanger Keucherei nun oben und sähen vor lauter Nebel überhaupt nichts. Könnten Sie das in Gedichtform ausdrücken? Garantiert nicht! Heinrich Heine konnte es dagegen und schrieb in das Gästebuch der Gipfelwirtschaft:
»Viele Steine
Müde Beine
Aussicht keine
Heinrich Heine.«
So etwas kann man nicht lernen, trotz aller gegenteiligen Behauptungen der Veranstalter von kreativen Schreibkursen.
Bestensfalls kommt so etwas heraus wie ein Beispiel, das ich einmal in einer Illustrierten gelesen habe. Es ging um einen Sturm und um den Seemann Uwe, der gerade irgendwelche Schiffbrüchige rettete. Daraus sind mir zwei Zeilen im Gedächtnis geblieben:
»S'ist Uwe, ruft es durch die Gischt
Ich gucke, doch ich sehe nischt!«
Die verzweifelten Bemühungen, reimen zu wollen, ohne reimen zu können, erleben wir ständig auf Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, karnevalistischen Veranstaltungen – es ist furchtbar. Auch Google hilft da nicht weiter. Ich habe einmal dort das Stichwort »Hochzeitsgedicht« eingegeben, und das erste von 1.983.678 Gedichten begann wie folgt:
»Zur Hochzeit sind wir heut geladen
das finden wir ganz wunderbar.
Dem jungen Paar möchten wir raten
pflegt Eure Liebe Jahrfür Jahr.«
Grrrrrrrrrr!
Im 19. Jahrhundert dichtete Friederike Kempner, der schlesische Schwan bzw. die schlesische Nachtigall, so schauerlich, daß der Schriftsteller Alfred Kempner, der nicht mit ihr verwandt war, seinen Geburtsnamen in Alfred Kerr änderte, weil sie »die schlechtesten je auf diesem Planeten bekanntgewordenen Verse« geschrieben habe. So dichtete sie über eine Stadt in Frankreich:
»Ihr wißt wohl, wen ich meine
Die Stadt liegt an der Seine.«
Da half auch nicht, daß die Frau oftmals recht hatte, so in dem Vierzeiler:
»Besessen ist die Welt
Von Eigennutz und Geld
Und alles zum
Verzweifeln dumm!«
Friederike Kempner fand viele Nachahmer, so daß man geradezu von einer Pseudo-Kempneriana spricht. So dichtete ein Anonymus unter ihrem Namen zu Johannes Kepler:
»Ein ganzes Blatt der Weltgeschichte
Du hast es vollgemacht!«
Also, Freunde von den Schreibseminaren. Das Reimen kann man nicht lernen. Beim Krimi ist das anders. Ob grüne Witwe im Münchener Nobelvorort Grünwald, ob emeritierter Juraprofessor, ob Fernsehmoderator im Ruhestand, ob Senioranwalt, den die Juniopartner hinausgemobbt haben, ob Kabarettist, den die Realität überholt hat – was immer auch – ein, Krimi schreibt sich fast von selbst. Im Grunde ist das vorliegende Buch daher überflüssig. Aber zwischen »schreibt sich von selbst« steht das Wörtchen »fast«. Hier scheiden sich die Böcke von den Schafen und die Spreu vom Weizen. Die Konkurrenz ist groß. Mein Buch wird Ihnen helfen, zu den Böcken respektive zum Weizen zu gehören.
Aber auch für die Krimi-Leser und -Zuschauer habe ich das vorliegende Buch geschrieben. Was bedeutet es, wenn der Tatortkommissar zu dem Verdächtigen drohend sagt: »Ich kann Sie auch auf das Präsidium vorladen.« Oder wenn er die Tür zu einer fremden Wohnung eintritt und seinem Gehilfen zuruft: »Gefahr im Verzug!« Oder wenn er dem verstockten Verdächtigen eine klebt und erklärt: »Wir ermitteln in einem Mordfall!« Warum kommen die Kommissare immer zu zweit? Und etwas allgemeiner gefragt: Was ist das eigentlich, ein Verbrechen? Wann ist der Krimi spannend, wann nicht? Woran erkennen Sie im Buchladen, ob ein dort ausgelegter Krimi den Kauf lohnt? Warum brechen so viele Verdächtige am Schluß zusammen und legen ein Geständnis ab, obwohl ihnen nichts nachzuweisen ist. Was ist ein Indiz, was ein Beweis? Fragen über Fragen. Ich will sie alle und mehr beantworten.
Читать дальше