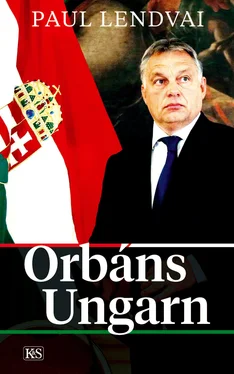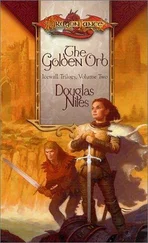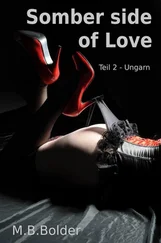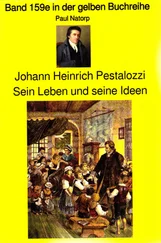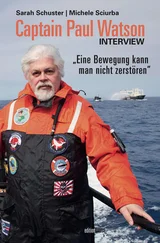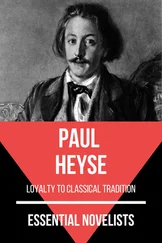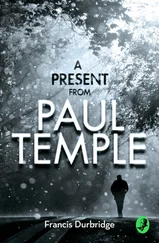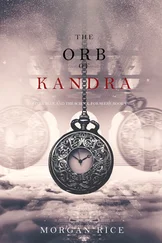Sein Freund Simicska galt auch während des Militärdienstes wegen seiner kritischen Haltung zu den sowjetischen Versuchen, die gewerkschaftliche Opposition in Polen zu unterdrücken, als schwarzes Schaf. Eine ganze Reihe von späteren Fidesz-Politikern, so auch seine engsten Freunde in der Studentenzeit, wie Gábor Fodor und László Kövér, haben in der Armee ähnliche Erfahrungen wie Orbán gemacht. Der aus einer sozialdemokratischen Arbeiterfamilie stammende und fast vier Jahre ältere Kövér, der stets zu übertriebenen Formulierungen neigt, hat einmal in einem Rückblick auf seine Soldatenzeit die Armee sogar als »Mini-Auschwitz« bezeichnet!
Die am Anfang dieses Kapitels erwähnte Gruppenbildung fiel zeitlich mit der politischen Aktivität in der Studentenvertretung an der Rechtsfakultät und vor allem mit der Einrichtung des Bibó-Kollegiums 7für Jusstudenten 1983 zusammen. Nicht an der Universität, sondern in diesem Kollegium entstand ein Netzwerk von persönlichen und politischen Freundschaften, das direkt und indirekt nicht nur die Karriere der einzelnen Figuren, sondern durch ihren späteren Aufstieg die ganze politische Landschaft des postkommunistischen Ungarn geprägt hat. Dass Orbán zuerst mit Simicska und dann fast zwei Jahre mit Gábor Fodor das Zimmer im Kollegium in der Ménesi-Straße 12 in Buda geteilt hat, bedeutete eine intime Kenntnis voneinander, die die persönlichen Reaktionen im Wechselspiel von Zusammenarbeit, Rivalität und Feindschaft der folgenden Jahrzehnte immer wieder mitbestimmt hat. Auch heute wohnen dort zu zweit oder zu dritt in den nur etwa zwölf Quadratmeter großen Zimmern 60 Studenten und Studentinnen, die monatlich rund 12.000 Forint (etwa 40 Euro) für die Benützung der Zimmer zahlen müssen.
Dass diese Insel der Autonomie und Selbstbestimmung in den Achtzigerjahren existieren, ja sogar blühen konnte, verdankten die Studenten vor allem drei Faktoren: den allgemeinen Reformen und Lockerungen in der Spätphase des Kádár-Regimes, der Tatsache, dass der Direktor des Kollegiums, der nur um fünf Jahre ältere István Stumpf, selber Reformer war und als Schwiegersohn des mächtigen, langjährigen Innenministers István Horváth über einen persönlichen Spielraum verfügte, und nicht zuletzt der tatkräftigen Unterstützung durch den aus Ungarn stammenden Multimillionär George Soros, der ab 1986 das Kollegium und die politisch aktiven Studenten sowie ihre Zeitschrift »Századvég« mit namhaften Subventionen (Sprachkurse, Stipendien, Auslandsreisen und Druckkosten) förderte. Das Bibó-Kollegium befindet sich in jener zweistöckigen Villa mit großem Garten im vornehmen Viertel von Buda, die, Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut, vor dem Zusammenbruch der Doppelmonarchie auch als Stätte der Begegnung für liberale und linke Intellektuelle diente.
Durch Vorträge und persönliche Kontakte haben Orbán, Fodor, Kövér und ihre Gesinnungsfreunde enge Kontakte mit den intellektuellen und politischen Wortführern der linksliberalen Opposition geknüpft. Die Kontakte, intensiviert durch gemeinsames Fußballspiel und familiäre Bande zwischen den einstigen Gymnasiasten, Rekruten und Zimmernachbarn, blieben auch nach dem Abschluss des Studiums engmaschig. Orbán war nicht zufällig bald nach der Gründung des Kollegiums, bereits 1984, 21-jährig zum Vorsitzenden des Leitungsausschusses der 60 Studenten gewählt worden.
»In der Politik geht es erstens um Macht, zweitens um Macht, und drittens um Macht.« Diese Aussage des deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftlers Ernst Fraenkel ist nach wie vor uneingeschränkt gültig, meint der Soziologe Rainer Paris: »Führen kann deshalb nur, wer auch führen will, wer also, selbst wenn er dazu gedrängt wurde, sich von einem bestimmten Moment an grundsätzlich dazu entschließt und die Führerrolle offensiv annimmt und bejaht.« 8
Der absolute Wille zur Macht hat das Charakterbild Viktor Orbáns schon als Studentenführer und während seiner ganzen politischen Karriere geprägt, auch wenn er es vermochte, nicht zuletzt dank willfähriger medialer Vermittlung, überwiegend nur als zielbewusster Politiker wahrgenommen zu werden, als Politiker mit Charakter, Bescheidenheit und einer weißen Weste. Er verstand es, bei Bedarf von ungeschickten oder untragbar gewordenen Funktionären seiner eigenen Partei rechtzeitig abzurücken und sich für Pannen nicht »haftbar« machen zu lassen.
Sein einstiger enger Freund, Mitbewohner des gemeinsamen Zimmers und späterer Rivale aus dem Bibó-Kollegium, Gábor Fodor: »Er hatte schon in den Achtzigerjahren jene herrschsüchtige, intolerante Denk- und Verhaltensweise, die man heute bei ihm sieht. Auch die prinzipienlose Berechnung steckte in ihm. Aber nicht nur das. Er war daneben auch offen, aufrichtig und sympathisch.« Die Bewertung Orbáns als ein von den Anhängern bewunderter, von den Gegnern gefürchteter Mann mit allgemein anerkannter Führungskraft ist während seines ganzen Lebens ambivalent geblieben.
Kapitel 3
GLANZ UND ELEND EINES JUNGPOLITIKERS
Wenn man die verblüffende Entwicklung seit dem Systemwechsel im Allgemeinen und den einzigartigen Aufstieg der Fidesz-Partei, vor allem seit 1998 und erst recht seit 2010, im Besonderen verstehen will, muss man zuerst die persönlichen, politischen und letztlich unüberbrückbaren Querelen in der kleinen Kerngruppe in Erinnerung rufen. Als Viktor Orbán und 36 andere Studenten am 30. März 1988 den Bund der jungen Demokraten (Fidesz) als eigenständige Jugendorganisation im großen Saal des Budapester Bibó-Kollegiums gründeten, beschäftigte diese gewagte Herausforderung der zerfallenden kommunistischen Staatspartei zuerst nur die Geheimpolizei, die sofort – allerdings vergeblich – versuchte, die Gründungsväter unter Druck zu setzen. Niemand von den drei Dutzend Jus- und Ökonomiestudenten Mitte Zwanzig hätte wohl damals gedacht, dass sie in diesem etwa 30 bis 35 Quadratmeter großen Saal im Erdgeschoss der einst von einem sozialistischen Arzt (József Madzsar) und seiner Frau (Alice Jászi), einer berühmten Tanzkünstlerin und Pädagogin, errichteten Villa, im Hintergrund mit einem großen Garten, die vielleicht erfolgreichste Partei in der ungarischen Geschichte gründen würden.
Das Gründungsdokument deklariert das Ziel der Schaffung einer neuen, selbständigen und unabhängigen Jugendorganisation, die die politisch aktive, radikale, reformistische Jugend sammeln will. Zwei Bedingungen sind für die Mitgliedschaft maßgeblich: Die Altersgrenze wird zwischen 16 und 35 Jahren festgelegt, und man darf nicht dem Kommunistischen Jugendverband angehören. Bereits nach vier Wochen zählte der Fidesz eintausend Mitglieder. Die breite Öffentlichkeit erfuhr allerdings erst nach der aufsehenerregenden Rede Orbáns am Heldenplatz am 16. Juni 1989 überhaupt von der Existenz der neuen Gruppierung.
Die neuen politischen Parteien
In diesem Jahr wurden die Weichen für den Übergang von der Diktatur zur Demokratie gestellt. Nachdem Michail Gorbatschow dem ungarischen Regierungschef Miklós Németh bereits im März 1989 klipp und klar gesagt hatte, dass sich der Kreml weder dem Mehrparteiensystem noch der Zulassung des Privateigentums widersetzen würde, begann in der Staatspartei die Phase der ungezügelten Machtkämpfe. Auch in Ungarn führte die Entwicklung, wie schon früher in Polen, zur Gründung eines Runden Tisches, um zwischen Opposition und Staatspartei Verhandlungen einzuleiten. Viktor Orbán und László Kövér nahmen für den Fidesz an diesen Sitzungen aktiv teil.
Die neuen politischen Parteien und Gruppen schossen wie Pilze aus der Erde: Bis Ende 1988 zählte man 21 und bis Ende 1989 sogar 60 verschiedene Gruppierungen. Die weitaus stärkste und landesweit am besten organisierte Partei war das bürgerliche MDF (Ungarisches Demokratisches Forum), geführt vom späteren Ministerpräsidenten József Antall. Der im November 1988 gegründete Bund der Freien Demokraten (SzDSz) – mit dem Philosophen János Kis als Vordenker an der Spitze – setzte die Traditionen der bereits im Untergrund höchst aktiven demokratischen Opposition unter den neuen Gegebenheiten fort. Der SzDSz galt zusammen mit dem Fidesz als die Speerspitze der antikommunistischen Opposition. Von den in dieser Zeit entstandenen Gruppen überlebten als politisch wichtige Parteien nach der Wende nur noch zwei wiedergegründete Vorkriegsparteien: die Kleinen Landwirte und die Christdemokratische Volkspartei. Die wiedererstandene Sozialdemokratische Partei verschwand nach zwei Monaten in der Versenkung. Die von den Reformkommunisten gegründete Sozialistische Partei (MSzP) versuchte vergeblich, diese Rolle zu übernehmen.
Читать дальше