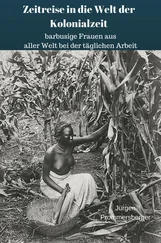Der Sohn stand in der Küche, sah zu und lernte.
Er hatte bereits eine kleine Fettschicht um den Bauch. Eine dünne Fettlage auf den Hüften. Etwas dickere Oberschenkel als alle anderen. Eine etwas größere Brust.
Vielleicht wurde das seine liebste Kindheitserinnerung. Das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Bei etwas dabeizusein, das sonst niemand tat. Zuerst mussten sie vorbei am Husebylager, wo die Gardisten untergebracht waren und wo sich die Armee in unterirdischen Höhlen versteckte. Ganz weit hinten saß der Verteidigungsminister Nils Kristoffer Handal an einem riesigen Schreibtisch mit Löschpapier, Füllfederhaltern, einer grünen Lampe und einem Telefon mit direkter Verbindung zu Eisenhower in Washington und zu den Festspielen in Bergen, zu deren Gründern er fast zehn Jahre zuvor gehört hatte. Das wüssten alle, behauptete die Mutter. Er wusste auch, dass es im Lager ein Schwimmbecken gab, das Menschen ohne Gewehr während der Sommermonate benutzen durften. Sein Vater hatte in letzter Zeit mehrmals gesagt, im Juni werde er seinen Sohn mitnehmen, damit der endlich schwimmen lernen könnte.
Erst wenn das riesige Militärlager hinter ihnen lag, konnten sie nach Mærradalen hin abbiegen. Die engen Pfade hinunter zum Lager der Obdachlosen. Mit einer Katze auf dem Schoß vor der dünnen Bretterwand. Die freundlichen Penner, die dicke Klumpen in einen Zinkeimer spuckten. Die runzligen Gesichter mit den Bartstoppeln und den verfilzten Haaren. Funkelnde braune und blaue Augen. Das Lächeln, das trotzdem so rätselhaft war. Die plötzlichen Tränen. Gedanken, die formuliert, freigelassen und beantwortet werden wollten. Sardinenbüchsen. Rentierklopse. Vaters Knäckebrot. Die Erwachsenen redeten miteinander. Und er setzte sich in eine Ecke und phantasierte. Hörte zu, was die anderen sagten. Ihre Wörter waren ungefährlich. Freundlich. Es ging um Hosen, Hemden, Reisig und Heizöfen. Alte Geschichten aus den Tagen des Krieges. Einige waren torpediert worden. Das war offenbar nicht so lustig. Vor allem einer, der Freundlichste, der die schönsten Katzen hatte, brach in Tränen aus, sobald er darüber redete. Dann musste sich der Vater zu ihm beugen, ihn in den Arm nehmen und ihm die Haare streicheln wie einem kleinen Kind.
»Ich habe Angst, dass es wieder Krieg gibt«, schluchzte der Mann und putzte sich die Nase mit einem schmutzigen gelben Taschentuch, das von altem Rotz ganz starr war.
»Wir werden alles tun, um das zu verhindern«, sagte der Vater ernst.
Danach fuhren sie mit der U-Bahn zu Ulf. Stiegen am Valkyrien plass aus. An dieser kleinen Haltestelle unter dem Bogstadvei, wo niemals viele Leute waren. Er fand es dort ein bisschen unheimlich und griff nach der Hand seines Vaters, wenn sie die Treppen hoch und hinaus ins Nachmittagslicht gingen. Die stillen vornehmen Straßen mit den vielen Fischgeschäften auf dem Weg zu Ulf. Ulf wohnte nicht weit von Tante Svanhild, aber Tante Svanhild wusste nichts von Ulf, und das war sicher auch besser so. Ulf saß nachmittags nicht mit übereinandergeschlagenen Beinen da, trank Sherry und rauchte Ascot. Ulf saß vor seinen Papieren, Büchern und Kampfschriften und schaute den Vater aus zusammengekniffenen Augen an, während er neue Angriffe auf das Weltkapital plante, auf das riesige kranke Tier, das im Verteidigungsministerium der USA hauste. NATO gegen Warschauer Pakt. Es war dann, als ob er mit dem Bruder spielte und sie auf dem Küchenboden mit ihren Brotformen zusammenstießen. Straßenbahn spielen war nicht ungefährlich. Es war ebenso riskant wie NATO und Warschauer Pakt. Eines Tages könnte es knallen. Und es machte ihm Sorgen, dass sein Vater sich vor fast allem so sehr fürchtete. Bei Ulf war das anders. Der schien das alles fast witzig zu finden. Die Vorstellung der vielen Demonstrationen und Protestmärsche, die sie organisieren würden. Die Artikel, die sie schreiben würden. An diesem Tag sprachen sie über den gemeinsamen Markt, die EFTA, das soeben unterzeichnete Freihandelsabkommen. Eine Hoffnung für das neue Europa, sagte der Vater, und Ulf nickte zustimmend. Die EWG war schon gegründet worden, zwei Jahre zuvor durch den Vertrag von Rom. Und jetzt würden sich Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien, die Schweiz, Österreich und Portugal zusammentun, um ihre Beziehungen untereinander zu stärken. Weder der Vater noch Ulf interessierte sich für die Handelspolitik an sich, sondern für die zugrundeliegende Vision: »Nie wieder Krieg auf europäischem Boden.«
Ihm fiel auf, wie die beiden Männer sich beim Reden gegenseitig anstachelten. Es konnte dort oben auf dem Dachboden eine aufgeheizte, fast revolutionäre Stimmung entstehen, ab und zu kamen Personen dazu, die lange, dicke und verschmutzte Mäntel trugen und sich am Gespräch beteiligten. Sie sahen aus wie Deserteure oder wie Angestellte der Norwegischen Eisenbahn. Und alle trugen eine Brille. Er hatte schon längst begriffen, dass man eine Brille brauchte, wenn man sich Revolutionär nennen wollte. Ulf hatte eine Brille, jedenfalls zum Lesen. Der Vater hatte zum Glück keine. Also war er kein Revolutionär. Das beruhigte ihn. Er hatte die Demonstrationen, bei denen erwachsene Menschen Schlagwörter riefen und einander mit den Fäusten drohten, nie gemocht.
Manchmal packte der Vater auch für Ulf Knäckebrot mit Butter und Ziegenkäse ein. Dann begriff er, dass Ulf nicht im Geld schwamm, aber das tat sein Vater ja auch nicht.
Langsam ging ihm auf, dass sein Vater ein überaus gütiger Mann war.
6
Der seltsame General Charles de Gaulle lässt zur gewaltigen Verzweiflung und Verärgerung des Vaters in der Sahara eine Plutoniumbombe zünden, und Frankreich wird die vierte Atommacht auf der Welt. »Hurra für Frankreich«, schreibt der General in einem Telegramm an Atomminister Pierre Guillaumat.
»Was für eine Schande«, sagt Vater.
»Dass die wirklich einen eigenen Atomminister haben«, sage ich. Aber Vater hört nicht zu. Er zieht seinen Mantel an und sagt zu Mutter, er gehe jetzt zu Ulf.
»Heute schon wieder?«
»Ja«, sagt Vater. In solchen Situationen kann er energisch sein.
Ich finde es verwirrend, dass sich nach einem dermaßen schwerwiegenden Ereignis die ganze Welt auf ein Kaff in der Sierra Nevada in Kalifornien namens Squaw Valley konzentriert, wo zwei Wochen lang Ski- und Schlittschuhlaufen angesagt sind. Sogar Vater interessiert sich dafür, klebt am Radio und notiert Rundenzeiten. Tormod und ich sind selbsternannte Sekundanten. Die gesamten Olympischen Winterspiele sind wie ein Schlussverkauf von Sieg und Niederlage. In der Zeitung sehe ich ein Bild des Eislaufstadions, in dem Roald Aas und Knut Johannesen, der Kupper’n genannt wird, ihre Triumphe feiern werden. Der Boden dort ist nicht flach. Es gibt mitten auf der Bahn eine Art Berg, oder vielleicht eine Schneewehe. Doch dann kommt Håkon Brusveen aus Vingrom bei Lillehammer. Er sollte eigentlich gar nicht dabei sein, denn er war nicht gut genug. Aber dann rief der Journalist Sverre Fodstad von Aftenposten im Schloss an und König Olav sagte: »Ich sehe es gern, dass Brusveen mit nach Squaw Valley fährt.« Brusveen gewinnt die fünfzehn Kilometer vor Jernberg und Hakulinen. Als einige Tage darauf der Staffellauf beginnt, ist es in Norwegen Abend, und alle sitzen nägelkauend vor dem Radio. Brusveen soll die letzten Etappen übernehmen. Grønningen, Brenden und Østby haben für einen soliden norwegischen Vorsprung gesorgt, als der Junge aus Vingrom die Loipe betritt. Zu diesem Zeitpunkt will die gesamte norwegische Bevölkerung, inklusive uns dreien, die wir zu Hause in Røa vor dem Radio sitzen, dass die Nation eine weitere Goldmedaille einheimst. »Hurra für Norwegen!« Aber Brusveen ist nicht gut genug. Er wird von Hakulinen mit weniger als einer Sekunde geschlagen, und hätte man das Stöhnen hören können, das an diesem Abend in allen Mietskasernen, Einfamilienhäusern, Bauernhöfen und Waldhütten erklang, dann hätte das einen gewaltigen Krach ergeben, wie niemand ihn je zuvor vernommen hatte. Diese Vorstellung faszinierte mich. Alle verließen ihre Radios und waren sauer.
Читать дальше