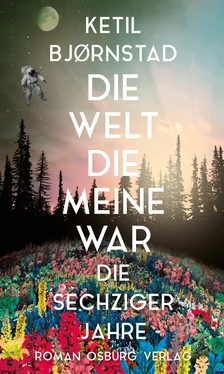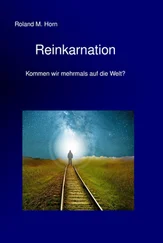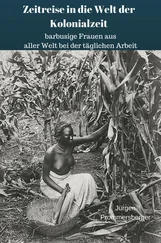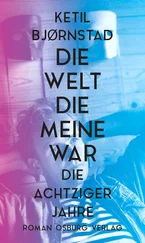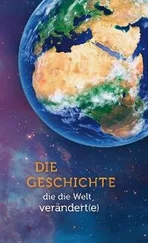Am nächsten Morgen ging die Fahrt nach Paris weiter. Janine Gallimard sollte später erzählen, dass die Reisegesellschaft sich in ein makabres Gespräch über Einbalsamierung verwickelt hatte. Camus meinte, es könne von Vorteil sein, nach dem Tod einbalsamiert zu werden. »Denn dann könnte ich Janine noch immer in ihrem Wohnzimmer Gesellschaft leisten.«
»Quelle horreur«, hatte Madame Gallimard geantwortet, dann begann ihr Mann, noch schneller zu fahren. Worauf Camus von der Rückbank her rief: »He, mein Freund. Hat es hier jemand eilig?«
Sie hielten zum Mittagessen beim Hotel de Paris et de la Poste in Sens, einem weiteren Restaurant mit zwei Michelin-Sternen, das nur noch anderthalb Stunden von der Hauptstadt entfernt lag. Sie aßen extra blutige Blutwurst, Boudins noirs auf Pommes reinette, und tranken eine Flasche Burgunder. Dann ging es weiter über die langen und fast beängstigend geraden Alleen in Richtung Hauptstadt.
Es nieselte jetzt.
Später sollte sich Janine erinnern, dass sie im Augenblick vor dem Unfall kein Geräusch von dem explodierenden Reifen gehört hatte, wohl aber Michels Ausruf »Merde!« Der Wagen geriet sofort ins Schlingern. Ihre Erinnerung setzte wieder ein, als sie zu sich kam, sie saß auf der Straße im Schlamm und rief vergeblich nach Floc, der für immer verschwunden war.
Der Wagen hatte einen Baum getroffen, dann noch einen, dann hatte er sich überschlagen. Später konnten Pressefotografen bezeugen, dass das Auto eine fünfzig Meter lange Schramme in den Asphalt gezogen hatte. In einem Radius von 150 Metern wurden Wrackteile gefunden. Der Chryslermotor lag auf der anderen Straßenseite, vom Rumpf getrennt. Die Uhr im Armaturenbrett war bei 1.55 stehengeblieben. Ein Lastwagenfahrer, der sich als Zeuge meldete, sagte, er sei unmittelbar vor dem Unfall von Gallimard überholt worden. »Die hatten bestimmt über 150 Stundenkilometer drauf.«
Die beiden Frauen, die auf der Rückbank gesessen hatten, waren unverletzt. Camus dagegen war vom Beifahrersitz gegen das Armaturenbrett und danach mit gebrochenem Genick durch das Plexiglasfenster hinten im Wagen geschleudert worden. Er war sofort tot, die Rettungsmannschaft brauchte zwei Stunden, um die Leiche aus dem Wrack zu bergen, nachdem diese mit dem Kopf unter dem Kofferraum gefunden worden war. Michel Gallimard war bei Bewusstsein und fragte: »Bin ich gefahren?« Er starb fünf Tage später an einer Gehirnblutung.
Der Arzt, der den Totenschein unterzeichnete, hieß Marcel Camus. In Camus’ Koffer befanden sich die dicht beschriebenen 144Seiten des Manuskriptes von Le premier homme, eine Schulübersetzung von Shakespeares Othello und eine französische Übersetzung von Nietzsches Die fröhliche Wissenschaft . Dazu die unbenutzte Zugfahrkarte nach Paris.
Bei früheren Gelegenheiten hatte Camus oft gesagt: »Die dümmste Art zu sterben ist durch einen Verkehrsunfall.«
Michel Gallimards alter Lehrer, René Etiemble, untersuchte den Unfall sorgfältig und gründlich auf französische Weise und konnte aus den Wartungsprotokollen für den Wagen entnehmen, dass einer der Hinterreifen schon zweimal eine Panne gehabt hatte. Jean Daninos sagte später, er habe Gallimard davor gewarnt, mit diesen offenkundig abgenutzten Reifen zu fahren. Und Etiemble kam zu dem Schluss, sie seien »in einem Sarg gefahren«.
Eine von Camus’ letzten Tagebucheintragungen lautete: »Ich weiß, dass ich alles getan habe, um dich von mir loszulösen. Ich habe mein Leben lang, sobald ein Mensch mir Zuneigung entgegenbrachte, alles getan, damit er sich zurückzog … Aber seitdem bin ich meinerseits allen entglitten, und irgendwie wollte ich, dass mir alle entglitten.«
Der früher so enge Freund und Widersacher Jean-Paul Sartre schrieb im France-Observateur: »Wir hatten es nicht so leicht, wir beide, aber das hat nichts zu bedeuten. Selbst, einander niemals wieder zu begegnen ist nur eine andere Weise des Zusammenlebens.«
4
Er liegt schon lange still da und wartet, hofft, nicht gesehen zu werden. Er liebt seine Eltern. Betet sie beide auf unterschiedliche Weise an. Dennoch weiß er, dass sie einmal begreifen werden, dass dieses Kind, das er mit seinem launischen Körper darstellt, ein Irrtum war, etwas, das sie vergessen konnten, und das sie vielleicht vergaßen, wenn er still genug war, wenn er zu Hause vorsichtig genug die Türen öffnete und schloss, und wenn er nicht mit ihnen darüber sprach, was in der Schule vor sich ging.
Noch hatten sie nicht begriffen, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Aber er hat es an den Blicken gemerkt. Die ersten Tage und Monate in der Schule waren ebenso licht gewesen wie die rosa Farbe an den Wänden des Klassenzimmers. Er fuhr jeden Morgen gemeinsam mit seinem Bruder mit der Straßenbahn von Røa nach Smestad. Das waren fünf Haltestellen. Und wenn sie bei dem roten Klinkerbau ausstiegen, traf der Bruder Klassenkameraden, während er zumeist allein den Weg hinunter zu den alten Deutschenbaracken ging, in denen die Schule am Smestaddam untergebracht war. Er hatte nicht das Bedürfnis, sich irgendjemandem aufzudrängen. Die Unsichtbarkeit, die er zu Hause anstrebte, versuchte er auch im Klassenzimmer zu erobern. Der sein, der sich niemals zeigte. Der niemals gesehen wurde. Das Sicherste war es, allein zu sein. Dann konnte niemand ihm etwas nachweisen.
Der Lehrer schien aus einer anderen Welt geholt worden zu sein. Mild und energisch. Streng, aber nicht gefährlich. Sowie er die Arme hob, wurde es still. Warum war das so, dass der eine den Zauberstab des Gehorsams in Händen hielt, während andere vergeblich gegen eine Wand aus Lärm die Klasse anschrien?
Eines Tages sprach der Lehrer über das Böse . Das hatten wir in uns.
Ja, dachte er, als er da in seiner Schulbank saß. Es war das Böse, das ihn dazu gebracht hatte, die Menschen zu verletzen, die er liebte. Als Tante Svanhild an jenem Abend zur letzten Straßenbahn nach Hause gegangen war, stand er leer und verzweifelt in der Türöffnung und blickte ihr hinterher. Er wollte nicht, dass sie ging. Er wollte ihr hinterherlaufen, die Arme um sie schlingen und rufen, dass er dumm gewesen sei, dass er nicht wisse, was in ihn gefahren war, dass es auf der ganzen Welt keinen Menschen gebe, den er lieber zu Besuch haben wollte als sie.
»Gesteht!«, sagte der Lehrer.
Ja, dachte er. Aber er sagte nichts. Zu gestehen würde auch bedeuten, sich sichtbar zu machen.
»Denn auch wenn ihr Kinder seid, habt ihr gesündigt«, sagte der Lehrer.
Niemand wollte das erste Geständnis ablegen. Draußen war Winter. Der Schnee türmte sich zu Wehen auf, nur nicht auf der Ullernchaussee, wo Salz gestreut worden war und die Autos vorsichtig in braunem Matsch hin und her fuhren.
Er sehnte sich nach Stille.
Aber in dieser Stille hier konnte er es nicht aushalten. Diese Stille war wie das Geräusch von Metallplatten, die sich ineinander bohrten. Sie war der Schrei, den er immer im Traum hörte, ehe er aufwachte.
Er hob die Hand.
»Ja«, sagte der Lehrer, streng und beifällig zugleich.
Er schaute sich um. Diese vielen Gesichter. Dreißig Kinder in seinem Alter. Aber er dachte nie daran, dass sie Kinder waren. Kluge Gesichter. Freundliche. Gemeine. Geruch und Ausdünstungen der vielen Körper. Ungewaschene Kleider und Pullover, die vage nach Parfüm rochen. Die Schlimmsten unter den Jungs, die nach ranzigem Fett und schalem Zigarettenrauch rochen. Die schönsten Mädchen, die nach Pfirsich und Flieder dufteten.
»Ja?«, wiederholte der Lehrer.
Er starrte das unscheinbarste Mädchen an, die mit den glatten blonden Haaren. Die in Huseby wohnte. Die Hübscheste. Die, die nie ein Wort sagte.
Er hatte sie nie angerührt. »Ich hab sie umgestoßen.«
Sie wurde rot, denn er starrte sie noch immer an. »Du warst gemein zu ihr?«
Читать дальше