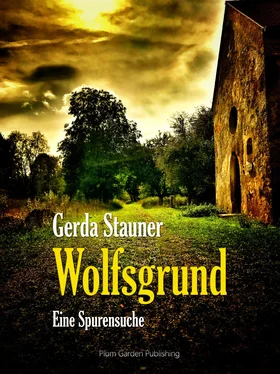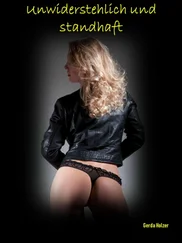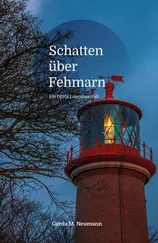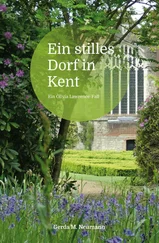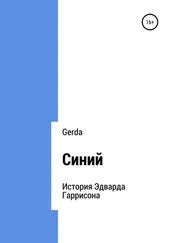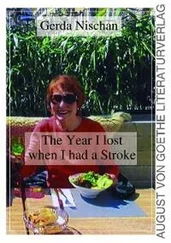„Bist du dir da sicher? Vielleicht hat einfach jemand vergessen, den Stammbaum weiterzuführen?“
„Ich bin mir sicher. Nach dem Tod meiner Mutter habe ich mich lange mit unseren Vorfahren und deren Geschichte beschäftigt. Ich habe alte Briefe gelesen, Fotos sortiert und Geburts- und Sterbeurkunden studiert. Es ist niemand mehr da. Nur wir beide. Wie es scheint, sterben die Beerbauers mit uns aus. Soviel ich weiß, hast du keine Kinder. Und dass ich keine habe, kann ich dir mit Sicherheit sagen.“
Ihr Tonfall ist weder verbittert noch drückt er Bedauern aus. Melchior hat das Gefühl, als ob Annette mit dieser Tatsache kein Problem hätte. Ganz anders als er. Tausend unterschiedliche Gedanken und Bilder tauchen auf. Franzi, Fichtenried, sein Großvater Anderl und seine Großmutter Theres. Seine Knie werden wieder weich und er kann nicht anders, als sich auf seinen Bürostuhl fallen zu lassen. Plötzlich sieht er nur noch ein Bild vor sich: einen struppigen Wolf, der einsam durch das verlassene Dorf Schmidheim streift.
Jetzt reiß dich zusammen! Der Sklaventreiber ist wieder da. Diesmal ist Melchior dafür dankbar. Seine Gedanken werden wieder klar.
„Über Schmidheim selbst weißt du vermutlich nichts?“
Es ist eine rhetorische Frage. Wie erwartet verneint Annette. Melchior will das Gespräch so schnell wie möglich beenden. Auch wenn er positiv von seiner Großcousine überrascht ist und sofort eine Verbindung gespürt hat, fällt es ihm nun schwer weiterhin locker und leicht zu plaudern. Er verabschiedet sich höflich und wünscht ihr viel Erfolg für ihre Mission. Melchior schafft es mit letzter Kraft, nicht abweisend und schroff zu werden. Ganz kurz flackert ein Wunsch in ihm auf: Vielleicht hätte er ihr die Wahrheit sagen können? Doch so schnell dieser Gedanke gekommen ist, so schnell verschwindet er auch wieder.
Die Minuten verstreichen wie Sekunden. Melchior sitzt mit starrem Blick an seinem Schreibtisch, kratzt sich an der Stirn, fährt mit den Fingern den faltig gewordenen Hals entlang und prüft dabei die Elastizität seiner Haut. Diese lässt von Jahr zu Jahr nach. Er wird alt.
Das Bild des einsamen Wolfes taucht wieder auf und mit ihm ein Unwohlsein, das der Journalist immer noch nicht einordnen kann. Verzieh dich aus meinen Gedanken, will er brüllen. Lass mich in Frieden. Du und ich, wir haben nichts gemeinsam.
Sein Blick fällt auf die Zeitanzeige auf seinem Bildschirm und er gähnt. Nur noch zwei Stunden, dann muss er den Text für die Redaktion fertig haben. Der innere Antreiber in ihm erwacht. Er scheucht den Redakteur in die Küche und lässt ihn einen starken Espresso kochen. Melchior nimmt die dickwandige Tasse mit zum Schreibtisch und öffnet die Email des Pressesprechers.
Die nächsten dreißig Minuten liest er aufmerksam alle Dokumente über Schmidheim und die beiden Ablösewellen rund um das Gebiet des heutigen Truppenübungsplatzes, notiert sich Jahreszahlen, Dorfnamen und wichtige Eckdaten. Dann sucht er nach einem Aufhänger für den Beitrag, nach einem guten Einstieg. Er bleibt bei einem alten Zeitungsartikel aus dem Herbst 1951 hängen, der den letzten Schultag einer Handvoll Schmidheimer Schüler beschreibt. Wie sie vom Lehrer mit einer besonderen Ansprache verabschiedet werden, wie sie unter den mitleidigen Blicken der Mitschüler das Schulhaus verlassen, mit einem großen Fragezeichen im Gesicht. Wie sie daheim auf die eigenen Eltern treffen, die ebenfalls wie gelähmt wirken und den Kindern keinen Halt in dieser Ausnahmesituation bieten können.
Melchior ist erstaunt, wie empathisch der Schreiber eines kleinen Lokalblatts vor fast siebzig Jahren die Situation beobachtet und beschrieben hat. Er sieht förmlich die Verwirrung der Kinder vor sich, spürt fast die ablehnende Haltung der Eltern, die nicht gelernt haben, für ihre eigenen Söhne und Töchter da zu sein und ihnen in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Die einfühlsamen Schilderungen passen so gar nicht in die 1950er Jahre, in denen der Ton eher rau und streng war. Aber ihm bietet die außergewöhnliche Sichtweise des Journalisten nun eine optimale Vorlage, einen grandiosen Einstieg in die Geschichte, die er nun schreiben wird, und er freut sich auf die vor ihm liegende Aufgabe.
Mit minimaler Verspätung schickt er den Text an die Redaktion. Nach nur fünf Minuten erscheint auf seinem Handy ein nach oben zeigender Daumen. Volltreffer, freut er sich. Für heute hat Melchior es geschafft, wieder einmal. Langsam lässt die Anspannung nach. Obwohl er schon so viele Jahre schreibt, spürt er immer noch den Kitzel, wenn er über einer interessanten Geschichte sitzt und die richtigen Worte dafür finden muss. Doch nachdem er fertig ist, der Text irgendwo in den Tiefen des Verlagshauses hin und her wandert und sich die Bits und Bytes schließlich zu später Stunde im Druckzentrum in schwarze Buchstaben auf hellem Zeitungspapier verwandeln, fühlt er sich leer und ausgebrannt. Oft geht er dann los, in die Stadt, trinkt irgendwo ein Bier oder ein Glas Rotwein. Melchior könnte sich auch daheim einen Feierabenddrink gönnen, aber dann wäre er alleine. So hat er zumindest das Gefühl, er wäre unter Menschen. Großartige Gespräche führt er nicht. Hin und wieder klopft ihm jemand auf die Schultern und lobt einen seiner Texte. Das reicht ihm. Mehr an Unterhaltung braucht er nicht. Das signalisiert er seinem jeweiligen Gegenüber auch deutlich. Mittlerweile akzeptieren das die anderen Gäste seiner diversen Stammkneipen und lassen ihn in Ruhe seinen Feierabend genießen.
Diese Leere spürt er auch jetzt ganz deutlich. Der Journalist ist sich sicher, dass er mit dem Text genau den richtigen Ton getroffen hat. Er wird die Leser berühren. Schon jetzt denkt er an die Briefe und Nachrichten, die ihn erreichen werden. Überschätzt er sich? Nein, er ist nur schon so lange in seinem Job, er weiß, was die Menschen lesen wollen. Er hat die Zeitspanne der zweiten Ablösewelle im Jahr 1951 - von der Verkündung der Entscheidung bis zur Vertreibung der Einwohner vergingen nur drei Monate - aus der Sicht einiger Menschen aus Schmidheim beschrieben. Er hat versucht, sich in die jeweiligen Menschen hineinzudenken und den überraschenden und gleichzeitig bedrohlichen Verlust der Heimat zu beschreiben. Es ist ihm erstaunlich leicht gefallen und gut gelungen.
Melchior entscheidet sich gegen die Stadt und für ein Glas Rotwein in den eigenen vier Wänden. Draußen ist es kalt und er müsste sich warm einpacken, das ist ihm zu umständlich. Er fährt den Computer runter, schaltet sein Telefon auf stumm und wählt im Radio das Klassikprogramm. Er öffnet eine Flasche Rotwein, die er selbst im letzten Herbst aus der Toskana mitgebracht hat. Die dunkelrote Flüssigkeit schmiegt sich ölig an die bauchige Rundung des Weinglases. Er lässt den Roten einige Male kreisen, atmet eine entfernte Erinnerung an Kirschen, Holz und Waldboden ein und setzt sich in seinen Lesesessel.
Draußen ist es schon lange dunkel. Auch wenn sich das Frühjahr schon längst angekündigt hat, mit gelben Narzissen, scharlachroten Tulpen und violetten Krokussen, muss er noch einige Wochen warten, bis die Zeitumstellung erfolgt. Erst dann kann er wieder längere Abende mit hellem Tageslicht genießen. Melchior könnte die stahlgraue Stehlampe anstellen, entscheidet sich aber dagegen. Er bleibt im Dunkel seiner Wohnung sitzen, in der nie vollkommene Finsternis herrscht. Zu viel Licht von draußen drängt herein. Lichtverschmutzung. Welch abstraktes Wort, wie er findet. Aber hier und jetzt erfasst er wohl zum ersten Mal die Bedeutung. In seiner Umgebung gehen die Lichter nie aus. Die Wohnungen der Nachbarn strahlen oft bis weit nach Mitternacht in hellen, warmen Gelbtönen. Die Straßenbeleuchtung wirkt dagegen wenig einladend und eher anonym auf ihn. Wann hat er zum letzten Mal die Sterne gesehen? In der Stadt ist dies unmöglich, dafür müsste er raus aufs Land fahren.
Читать дальше