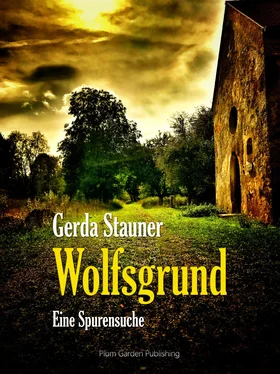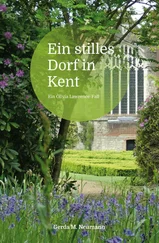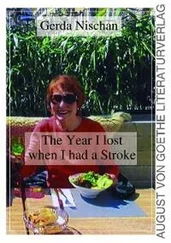„Darf ich Ihnen noch eine abschließende Frage stellen?“ Melchior hat sich wieder einigermaßen im Griff, seine Neugierde ist wieder da, seine wichtigste Eigenschaft als Journalist.
„Klar.“
„Wie würden Sie damit umgehen, wenn Sie von heute auf morgen ihre Heimat verlassen müssten?“
Der andere blickt ihn unverwandt an. Die rechte Augenbraue zuckt leicht nach oben und verleiht ihm einen erstaunten Ausdruck.
„Wissen Sie, ich bin hier in der Nähe geboren und aufgewachsen. Ich mache meine Heimat aber nicht an einem Haus oder Dorf fest. Ich fühle mich dort zu Hause, wo ich ich selbst sein kann.“
„Und das wäre dann wo?“
„Jetzt gerade, in diesem Moment, ist es genau hier. An diesem Ort, den vielleicht vor ein paar Stunden ein Wolf durchstreift hat. Diese Vorstellung macht mich glücklich. Wie Sie sehen können, bin ich Jäger. Ich will den Wolf aber nicht jagen. Vielleicht teilen wir uns künftig die Arbeit und das Revier und er reißt ein paar Wildschweine, die ich dann nicht zur Strecke bringen muss. Hier an diesem Ort habe ich das Gefühl, dass alles in Einklang ist. Vielleicht liegt es daran, dass sich der Mensch hier weitgehend aus dem natürlichen Lauf der Dinge heraushält.“
„Also könnten Sie ohne diesen Ort hier nicht leben? Ist hier ihre Heimat?“
„Das habe ich so nicht gesagt. Hier fühle ich mich im Moment wohl, hier erlebe ich glückliche Augenblicke und spüre eine Art Verbindung mit meiner Umgebung. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich diese positive Assoziation auch anderswo erfahren kann. Ich stelle mir vor, dass Heimat ein Teil von mir ist, den ich in mir trage. Ich nehme ihn also immer mit, egal wohin ich gehe.“
Melchior ist schon wieder sprachlos. Der Mann ihm gegenüber ist weit davon entfernt, in das stereotype Bild eines oberpfälzer Ureinwohners zu passen. Wenn der Redakteur ehrlich ist, hatte der Begriff „Heimat“ bisher immer etwas Negatives für ihn: Heimatromane, Heimatlieder, Heimatbräuche. Bisher verband er damit Menschen, die sich um jeden Preis ihrem Herkunftsort und ihrer Umgebung unterordneten, um sich zugehörig fühlen zu können. Dass dieses Wort auch positiv besetzt, dass es in einer Person selbst verankert sein kann und somit nicht einschränkt, nicht zur Unterordnung aufruft, auf diese Idee wäre er nie gekommen.
Auf der Rückfahrt zum Verlag lassen Melchior die Bilder der brachliegenden Gegend, der wiederaufgebauten Kirche, der verlassenen und eingefallenen Häuser Schmidheims nicht mehr los. Seit er sich vom Pressesprecher verabschiedet hat, fühlt er eine ungeahnte Ruhe in sich. Es ist, als ob dieser einsame Ort alles in ihm zum Stillstand gebracht hätte. Alle drängenden Fragen sind verstummt. Der Spruch „Mit sich im Reinen sein“ fällt ihm ein. Ist er das?
Er fährt in die Tiefgarage der Zeitung, trägt penibel genau die Uhrzeit und die Anzahl der gefahrenen Kilometer in das Fahrtenbuch ein und gibt den Schlüssel an der Empfangstheke ab. Auf dem Weg zum Fahrstuhl, der ihn innerhalb von Sekunden in das Großraumbüro bringen wird, hält er plötzlich inne und gähnt. Der Gedanke an die Suche nach einem freien Platz im lauten Getöse des sterilen und kalten Großraumbüros wirkt lähmend auf ihn. Schlagartig werden seine Glieder tonnenschwer und er fürchtet, dass ihm schwarz vor den Augen werden könnte. Melchior ist sich sicher, dass sich sein Zustand mit dem Eintreten in den Newsroom noch weiter verschlechtern würde. Die Müdigkeit überfällt ihn oft in ganz unvorhergesehenen Situationen, manchmal sogar im Gespräch mit anderen. Er macht auf dem Absatz kehrt, nickt der Empfangsdame kurz zu und verlässt das Gebäude durch die lautlos auseinandergleitenden Glastüren des Haupteingangs. Die frische Luft vertreibt das taumelige Gefühl sofort.
Er blinzelt einer grellen, aber kalten Märzsonne entgegen. Gegenüber, vor dem gerade neu eröffneten Café, legt eine junge Frau rote Wolldecken auf die dunklen Stühle hinter den silbernen Metalltischen. Er überquert die Straße, setzt sich auf einen leeren Platz und holt sein Smartphone aus der Tasche. Umständlich tippt er eine Nachricht an die Redaktionsleiterin, die zwanzig Jahre jünger sein muss als er selbst, und verspricht ihr den Text mit den passenden Bildern bis Redaktionsschluss. Sekunden später kommt ein schlichtes „OK“ zurück. Sie kennt ihn als gewissenhaften Redakteur und hat die Geschichte wahrscheinlich schon in diesem Moment wieder vergessen. Wo und wann er seine Berichte schreibt, ist ihr egal. Für sie zählt nur, wie viel Platz sie freihalten muss, wie viele Pixel das Bild hat und wie viele Spalten der Text. Alles Weitere überlässt sie seinem Können und vertraut auf seine jahrelange Erfahrung, das weiß er.
Melchior bestellt einen doppelten Espresso, ein Garant, um sich wachzuhalten, dazu ein Glas Leitungswasser. Er lässt seinen Blick über das Gelände auf der anderen Straßenseite wandern. Ein riesiges Stück Bauland, eingegrenzt von Eisenbahnschienen, dem Verlagsgebäude und Wohnbauten, tut sich vor ihm auf. Im Showroom nebenan sind die Wohnträume zahlreicher Doppelverdienerfamilien auf Hochglanzprospekten ausgestellt. Schon bald werden riesige Bagger die braune Erde aufreißen und Unmengen von Beton in die dunklen Löcher hinabfließen. Arbeitskräfte aus Osteuropa, die während der Bauzeit in schmucklosen Containern neben der Baustelle hausen müssen, werden in Schichtarbeit Fertigbauteile zusammenfügen und so die unverschämt teuren Gebäudekomplexe errichten. Hatte sich nicht ein örtlicher Bauträger letzte Woche in der Presse damit gebrüstet, ein kürzlich realisiertes Stadtquartier mit Neubebauung ohne nennenswerte Gewinne veräußert zu haben? „Zum Wohle der Stadt“, das waren seine Worte. Melchior fragt sich ernsthaft, wie dieser dies trotz der schwindelerregend hohen Quadratmeterpreise und der billigen Arbeiter aus dem Osten oder sonst woher schaffen konnte. Bei dem Gedanken daran, wie sich scheinbar alle Bauvorhaben in dieser Stadt zu gleichförmigen, gesichtslosen Wohntürmen entwickelt haben, schüttelt Melchior den Kopf und versucht, sein Unwohlsein mit dem letzten Schluck Espresso zu vertreiben.
Er steht auf und macht sich zu Fuß auf den Weg zu seiner Wohnung. In drei Stunden muss der Artikel stehen.
Zuhause am Schreibtisch holt er seine Notizen heraus und überfliegt diese. Sein Mobiltelefon piept und zeigt eine neu eingegangene Email an. Er tippt umständlich den sechsstelligen Code zum Entsperren ein und ruft die Nachricht ab. Der Pressesprecher hat ihm wie versprochen jede Menge Material über Schmidheim geschickt. Auf gut Glück öffnet Melchior die Datei „Ehemalige Bewohner.doc“ und scrollt durch die Liste mit Familien- und dazugehörigen Hausnamen. Bei „Bichlmeier - Hausname Blombauer“ bleibt er intuitiv stehen. Melchior schaut in seinen Notizen nach, ob der Pressesprecher diesen Namen erwähnt hatte. Fehlanzeige. Woher kennt er ihn nur? Ein ungutes Gefühl überkommt ihn. Hat es etwas mit Fichtenried zu tun? Mit seiner ehemaligen Heimat verbindet der Redakteur eher unschöne Gedanken. Allein seine Großeltern Anderl und Theres und seinen besten Freund Franzi hat er in positiver Erinnerung. Aber in Fichtenried gab es keine Familie Namens Bichlmeier. Oder doch? Ihm fällt der Stammbaum ein, den ihm seine Großcousine Annette vor einiger Zeit zugeschickt hatte. Schnell hat er den Ordner gefunden, in dem das Papier abgeheftet ist. Er nimmt das DIN A3 Blatt heraus, faltet es auseinander und findet tatsächlich den gesuchten Namen gleich zweimal notiert: Sabina Bichlmeier und Agathe Bichlmeier. Mit dem rechten Zeigefinger fährt er die feinen Linien und Verästelungen nach, bis er schließlich auf seinen eigenen Namen stößt. Beide Frauen waren mit seinem Urgroßvater Anton Beerbauer verheiratet, Agathe hat sich mit dem Witwer nach dem Tod von Sabina vermählt und ist in direkter Linie seine Urgroßmutter und Mutter seines Großvaters Anderl. Geboren wurde sie im Jahr 1874 in Schmidheim.
Читать дальше